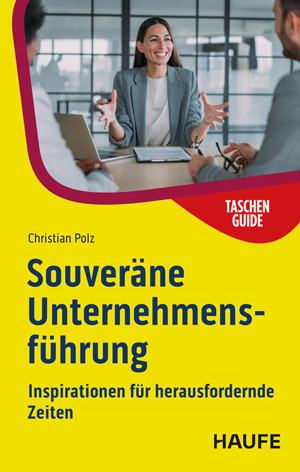Aktuelle Events
Zeit für den Abschied?
Gut zu wissen: Das sind die wichtigsten Exit-Optionen für Start-ups.

Es gibt viele Motivationen für Unternehmer*innen, sich teilweise oder auch ganz aus ihrem Start-up zurückzuziehen. Während sich einige den Managementherausforderungen späterer Unternehmensphasen nicht gewachsen sehen, möchten andere den zeitlichen und finanziellen Druck hinter sich lassen. Daneben gibt es noch Serial Entrepreneurs, die regelmäßig neue Geschäftsideen entwickeln, diese verfolgen möchten und hierfür die mit dem aktuellen Start-up verbundenen Verpflichtungen abgeben müssen. Die Motivation hat dabei einen wesentlichen Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung der Nachfolge. Steht ein Rückzug aus dem Unternehmen an, gilt es für Gründer*innen, die Zukunftsfähigkeit ihres Start-ups zu sichern – ein Prozess, der einer gründlichen Vorbereitung bedarf.
Welche Nachfolgevariante eignet sich für wen?
Grundsätzlich stehen hier mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Dabei hat jede Exit-Variante einen unmittelbaren Einfluss auf die künftige Rolle des/der Verkaufenden im Unternehmen und bringt zudem spezifische Anforderungen mit sich. Deshalb ist eine frühzeitige Beschäftigung mit den verschiedenen Optionen und deren Eignung für das Erreichen der eigenen Ziele unerlässlich.
Bevor auf die einzelnen Exit-Optionen eingegangen wird, muss zunächst eine variantenübergreifende und unerlässliche Voraussetzung geklärt werden: die Ersetzbarkeit des/der Gründer*in beziehungsweise des Gründungsteams. Sind nämlich Produkt oder Geschäftsbeziehungen, sei es zu Kund*innen oder Investor*innen, zu stark mit der Person des/der Verkaufenden verbunden, so kann der Exit den Kaufpreis des Start-ups signifikant beeinträchtigen oder gar das Ende für das etablierte Geschäftsmodell bedeuten. Start-ups sollten daher von Beginn an als eigenständige, von Personen möglichst unabhängige Institution aufgebaut werden. So kann beispielsweise die rechtzeitige Einbindung der Mitarbeitenden in die wichtigsten Geschäftsbeziehungen dabei helfen, eine reibungslose Übergabe in einem Exit-Szenario sicherzustellen.
Abgabe der operativen Tätigkeiten
Ist dieses Kriterium gegeben, können Unternehmer*innen eine für ihre Ziele geeignete Exit-Variante auswählen. Hierbei liegt die erste Entscheidung zwischen einem vollständigen und einem teilweisen Exit. Der Teil-Exit bietet sich für alle an, die sich entweder schrittweise aus ihrem Start-up zurückziehen oder die Geschicke des Unternehmens mithilfe des Mitspracherechts noch ein wenig mitgestalten möchten.
Hier führen zwei Wege zum Ziel: Der erste ist der Rückzug aus dem operativen Geschäft, bei dem die jeweiligen Unternehmensanteile im Besitz des/der Gründer*in bleiben. Als Nachfolgende kommen sowohl Mitarbeitende als auch externe Geschäftsführer*innen infrage. Eine unternehmensinterne Übergabe fällt Gründer*innen aufgrund der meist vorhandenen Vertrauensbasis infolge jahrelanger Zusammenarbeit oftmals leichter, erfordert jedoch eine geeignete zweite Ebene im Unternehmen. Auch hier zahlt sich frühzeitiges Handeln aus – beispielweise die Ausbildung eines/einer potenziellen Nachfolgenden durch Einbindung in das Management. Besonders effektiv lässt sich dies gestalten, wenn die Mitarbeitendenbindung zuvor im Rahmen eines ESOP (Employee Stock Option Plan) oder VSOP (Virtual [Employee] Stock Option Plan) noch weiter intensiviert wurde.
Die Nachfolge durch eine(n) externe(n) Geschäftsführer*in bietet dem/der Gründer*in hingegen den Vorteil, trotz externer Geschäftsführung personell und wirtschaftlich für sein/ihr Start-up verantwortlich zu bleiben und somit weniger Kontrolle abgeben zu müssen. Allerdings bedeutet dies auch eine entsprechend geringere zeitliche und finanzielle Entlastung.
Veräußerung der Unternehmensanteile
Der zweite und meistgewählte Weg in den Teil-Exit stellt der Verkauf von Unternehmensanteilen dar. Während manche Unternehmer*innen damit lediglich einen Teil ihres Vermögens in risikoärmere Anlageformen transferieren möchten, kombinieren andere den Verkauf mit dem Rückzug aus dem operativen Geschäft: Je nach Menge der verkauften Anteile geht der Teil-Exit damit fließend in einen vollständigen über. Im Gegensatz zum isolierten Rückzug aus dem operativen Geschäft führt der Anteilsverkauf in der Regel dazu, dass die Vorstellungen des/der Gründer*in nicht mehr maßgebend für die Geschäftsführung sind. Die Balance zwischen Ausstieg und Einflusserhalt kann hierbei jedoch mit der Menge der verkauften Anteile relativ präzise gesteuert werden – selbstverständlich unter der Einschränkung der ebenfalls zu berücksichtigenden Käufer*inpräferenzen, welche maßgeblich vom Investor*innen-Typ abhängig sind. Beispielsweise bevorzugen Corporate-Venture-Capital-Einheiten meist vollständige Übernahmen, wohingegen VC-Investor*innen in der Regel nur Teilübernahmen durchführen.
Bei der Wahl des/der Käufer*in kann zwischen zwei Gruppen unterschieden werden: unternehmensinterne und -externe Investor*innen. Erstere sind zumeist Mitarbeitende, die im Rahmen eines Management-Buy-Outs (MBO) die Gesellschafterrolle des/der Unternehmer*in übernehmen. Dabei kommen für Letztere dieselben Vorteile wie bei der internen Übergabe des operativen Geschäfts zum Tragen. Fällt die Entscheidung hingegen auf eine(n) externe(n) Käufer*in, so stehen die Optionen Trade Sale und Börsengang (IPO) zur Verfügung. Bei einem Trade Sale stellt der/die Käufer*in meist ein anderes, größeres Unternehmen dar, das mit der Übernahme beispielsweise die Erschließung neuer Märkte oder auch den Zukauf von Know-how, beispielsweise neuer Technologien, zur Stärkung der eigenen Wettbewerbsposition anstrebt. IPOs sind hierzulande als Exit-Form eher seltener zu beobachten. Grund dafür sind die hohen Anforderungen, die Börsengänge an Start-ups stellen. So müssen unter anderem Emissionskosten von bis zu zehn Prozent des Emissionsvolumens gestemmt, ein aufwendiges Börsenprospekt erstellt sowie ein professionelles Controlling, Risikomanagement und Investor-Relations-Team aufgebaut werden – für viele Start-ups eine zu hohe Belastung.
Was gilt es, bei der Finanzierung zu beachten?
Ist die Entscheidung bezüglich der Nachfolgevariante gefallen, kommt der Punkt der Finanzierung ins Spiel. Diesbezügliche Gedanken können Verkaufende grundsätzlich dem Käufer überlassen. Bei MBOs stellt Fremdkapital – meist ein Bankkredit – die wichtigste Finanzierungsform dar. Voraussetzung dafür ist, dass das zu verkaufende Start-up bereits Gewinn erwirtschaftet, mit dem die Kapitaldienstfähigkeit gewährleistet wird. Da Banken in der Regel eine gewisse Eigenkapitalbeteiligung fordern, sind die meist kapitalschwächeren Käufer*innen bei einem MBO oftmals auf das Eigenkapital von Beteiligungsgesellschaften angewiesen. Dieses wird häufig in Form von Mezzanine-Kapital bereitgestellt. Dazu gründet der/die Käufer*in eine Erwerbsgesellschaft, die mit dem für den Kauf benötigten Kapital ausgestattet wird. Durch die Zusammenarbeit mit einer Beteiligungsgesellschaft profitieren Käufer*innen nicht nur von der ermöglichten Fremdkapitalfinanzierung und dem zusätzlichen Mezzanine-Kapital, sondern auch von deren Know-how und Netzwerk. So können unter anderem die klassischen Anfängerfehler bei Nachfolgen vermieden werden – beispielsweise bei der Finanzierungsstruktur.
Fazit
Nachfolgen bestimmen über die Unternehmenszukunft – bei Mittelstand und Start-ups gleichermaßen. Um die eigene Nachfolge möglichst wunschgerecht realisieren zu können, sollten sich Gründer*innen frühzeitig mit der Thematik auseinandersetzen – erstens, um sich über die eigenen Präferenzen klar zu werden, und zweitens, um das eigene Unternehmen auf die präferierte Exit-Variante vorzubereiten. „Nachfolge-Anfänger*innen“ empfiehlt sich zudem die Zusammenarbeit mit erfahrenen Expert*innen wie Beteiligungsgesellschaften zur Vorbeugung vermeidbarer Fehler. Und ein letzter Appell an alle, die sich momentan noch gar keine Nachfolge vorstellen können: Das Leben hält oftmals die ein oder andere Überraschung bereit, und der Aufwand, sich die Nachfolgeoption offen zu halten, ist die Entscheidungsfreiheit in späteren Jahren wert.
Der Autor Dr. Steffen Huth ist seit 2021 Geschäftsführer der BMH Beteiligungs-Managementgesellschaft Hessen mbH. Die BMH bündelt die öffentlichen Beteiligungsinteressen und Finanzierungsinstrumente für Frühphasen-, Wachstums- und Mittelstandsunternehmen in Hessen.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Warum internationale Unternehmen Österreich als F&E-Standort wählen
Weshalb internationale Unternehmen ihre F&E-Aktivitäten in Österreich ausbauen, welche Rolle Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Start-ups spielen und wie die Austrian Business Agency (ABA) dabei unterstützt, erzählen Martin Gruber (NXP Semiconductors), Stefan Poledna (TTTech Auto) und Gerald Seifriedsberger (GE HealthCare Austria) im Interview.

Österreich zählt zu den innovationsstärksten Ländern Europas und gehört im European Innovation Scoreboard zur Gruppe der „Strong Innovators“. „Maßgeblich zu unserer Position tragen internationale Unternehmen bei, die Österreich gezielt als Standort für Forschung und Entwicklung (F&E) nutzen und zahlreiche Innovationen hervorbringen. Die österreichischen Niederlassungen internationaler Konzerne leisten einen maßgeblichen Beitrag für den Innovationsstandort Österreich – sie sind mit 2,6 Milliarden Euro für mehr als die Hälfte der unternehmensfinanzierten F&E-Ausgaben verantwortlich”, so Marion Biber, Head of INVEST in AUSTRIA bei der Standortagentur ABA.
Österreich ist in den letzten Jahrzehnten generell viel innovativer geworden: Zwischen 2000 und 2023 wuchsen die F&E-Ausgaben hierzulande um 73 Prozent – deutlich stärker als im EU-Durchschnitt mit 24 Prozent.

Forschung und Entwicklung
Forschung und Entwicklung sind zentrale Treiber für wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt. Österreich bietet für beide Bereiche optimale Rahmenbedingungen – nicht zuletzt durch ein europaweit einzigartiges Fördermodell, das direkte (durch die FFG) und indirekte Forschungsförderung (durch die Forschungsprämie) kombiniert.
Internationale Unternehmen treffen hier außerdem auf eine dichte Forschungslandschaft, und ein Ökosystem, in dem Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Start-ups nicht Ausnahme, sondern Alltag ist.
Steirischer Ort mit globaler Wirkung
Viele der Unternehmen, die in Österreich forschen und entwickeln, agieren im B2B-Bereich und bleiben daher für Endkonsument*innen oft unsichtbar. Einer dieser Player ist NXP Semiconductors, ein niederländischer Halbleiterkonzern mit rund 35.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Einer der wichtigsten F&E-Standorte befindet sich im steirischen Gratkorn.
Dort arbeiten heute rund 650 Expert*vinnen aus 45 Nationen an Zukunftsthemen wie Edge AI, Cybersecurity und Post Quantum Cryptography. “Der Standort Österreich ist ganz essentiell für uns und für die Entwicklung von innovativen, neuartigen Halbleiterprodukten. NXP Österreich ist für uns als internationalen Konzern ein sehr wichtiger Forschungs- und Entwicklungsstandort”, so Martin Gruber, Vice President Corporate Strategy bei NXP Semiconductors. Besonders stark vertreten ist NXP im Mobility- und Automotive-Bereich, aber auch in Industrial- und IoT-Anwendungen.
Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital
Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.
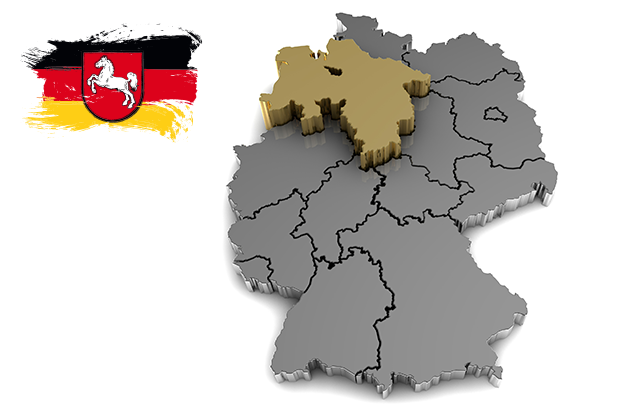
Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.
Ganzheitliche Unternehmensführung: Das große Ganze im Blick behalten
Gründer*innen und junge Selbständige sollen ganzheitlich denken und handeln. Sicherlich: Das ist gerade zu Beginn der Selbständigkeit eine Herausforderung, aber das langfristige Denken zahlt sich auf der Strecke aus. Die folgenden Impulse geben erste Anstöße zu einer ganzheitlichen Unternehmensführung, durch die du deine Unternehmensperformance steigerst.

Eine junge Gründerin brennt für ihre Geschäftsidee. Sie geht in die Umsetzung – und arbeitet. Und arbeitet. Und arbeitet. An sich selbst denkt sie dabei zuallerletzt. Oder gar nicht.
Gründer Nummer 2 beschäftigt sich Tag und Nacht mit seinen Werten, die er als Unternehmer auf jeden Fall beachten will. Dabei „vergisst“ er den (sowie erstaunlich überschaubaren) Businessplan.
Eine weitere Gründerin glaubt, alles allein stemmen zu müssen. Und denkt nicht daran, dass sie „irgendwann“ auf Mitarbeiter*innen angewiesen sein könnte, die zum Unternehmen und zu ihr passen. So kommt es zu Fehleinstellungen. Mit der Teamführung fremdelt die introvertierte Einzelgängerin gewaltig. Sie führt und motiviert alle gleich.
Und Gründer Nummer 4, der ein moralisch angreifbares Produkt anbietet, merkt zu spät, dass er mehr Zeit und Geld in die Lobbyarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit hätte investieren sollen.
Impuls 1: Denke ganzheitlich und sei erfolgreich
Erkennst du dich in den (freilich etwas übertriebenen) Beispielen wieder? Gemeinsam ist den vier Gründer*innen die oft allzu eindimensionale Perspektive: Es fehlt an der Überzeugung, geschäftlicher Erfolg und ein performantes Unternehmen seien möglich, wenn von Anfang an alle – oder zumindest viele – Aspekte in den Fokus rücken. Aus meiner Sicht ist bei der Unternehmensführung die Fähigkeit entscheidend, ganzheitlich zu denken, über den Tellerrand des operativen Geschäfts hinauszublicken und die Kreativität auf die Verbesserung des Kernbusiness zu richten. Alles Weitere – wie das Management der Prozesse in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen (Produktion, Verkauf, Marketing, Werbung, Forschung & Entwicklung, Controlling) – hängt von deiner Befähigung zur ganzheitlichen Unternehmensführung ab.
Impuls 2: Setze im systemischen Rahmen Prioritäten
Die Gründung gelingt eher, wenn du die Kompetenz aufbaust, dich selbst, die Mitarbeiter*innen und das Unternehmen souverän zu führen. Hinzukommen sollte der konstruktive Umgang mit Vertretern aus Öffentlichkeit, Politik und Medien, mit Lieferanten und Kund*innen. Das heißt: Es geht um Selbstführung, Mitarbeiter*innen- und Teamführung, Unternehmensführung und Stakeholderführung.
Klar ist: Nicht zu jeder Zeit musst und sollst du allen Bereichen dieselbe Aufmerksamkeit zukommen lassen. Alles hat seine Zeit. Darum: Setze Prioritäten, fokussiere dich auf das, was hier und heute von elementarer Wichtigkeit ist. Das ist nicht immer so leicht und sofort zu erkennen. Wer jedoch alle Aspekte in den Blick nimmt und dann Schwerpunkte setzt, ist der Konkurrenz oft einen Schritt voraus.
Impuls 3: Beweise strategischen Weitblick
Zu Beginn der Gründung ist wahrscheinlich die Unternehmensführung von besonderer Relevanz. Zentral ist eine ganzheitliche, strategische und zielorientierte Vorgehensweise. Plane jeden Entwicklungsschritt möglichst exakt, sorge aber auch für kreative Frei- und Spielräume. Triff Entscheidungen stets auf einer faktenbasierten Grundlage. Bedenke die Auswirkungen und Konsequenzen deiner Entscheidungen sowie deines Handelns auf alle Bereiche und alle beteiligten Personen – Mitarbeiter*innen, Kund*innen, Lieferanten. Schau nach vorn, und das möglichst weit.
Impuls 4: Führe Markt-, Branchen-, Kund*innen- und Konkurrenzanalysen durch
Die Forderung nach einem strategischen Weitblick ist rasch erhoben. Was kannst du konkret tun? Analysiere, welche Chancen und Möglichkeiten dein Markt und deine Branche bieten. Bedenke zugleich die Engpässe, Risiken und Gefahren. Wie ist es um den Bedarf und die Wünsche und Erwartungen deiner Zielgruppen und Kund*innen bestellt? Und was treibt die Konkurrenz? Gibt es Kooperationsoptionen? Wo kannst du etwas vom Wettbewerb lernen und übernehmen?
Viele Firmen sind im Verkaufsbereich gut aufgestellt, vernachlässigen jedoch die Einkaufsseite und das Beschaffungsmanagement. Darum: Beobachte die Einkaufsseite, um frühzeitig Lieferengpässe und Abhängigkeiten von Lieferanten zu identifizieren. Greift im Supply Chain ein Rädchen nicht mehr in das andere, entstehen rasch Engpässe – und so geraten Just-in-Time-Produktionen in Gefahr.
Impuls 5: Pflege Beziehungen und networke
Stakeholdersouveränität setzt das Management des eher indirekten Umfeldes voraus, in dem du dich bewegst. Es geht nicht nur um Kund*innen und andere Marktteilnehmer*innen, sondern ebenso um Öffentlichkeit, Verbände, Medien, Politik und Gesellschaft im weitesten Sinn. Prüfe, welche gesellschaftlichen Trends und politischen Entwicklungen sich mittel- und langfristig auf dein Business auswirken könnten. Konkret: Werden in naher Zukunft Gesetze, Richtlinien oder Ähnliches erlassen, die du beachten solltest, etwa Steuergesetze?
Überlege, ob es zielführend für dich ist, Pressekontakte zu knüpfen, Lobbyarbeit zu betreiben, die Mühsal der Verbandsarbeit auf dich zu nehmen und dein Netzwerk kontinuierlich auszubauen. Indem du mit Gleichgesinnten, die vor ähnlichen Herausforderungen wie du stehen, kooperierst, lassen sich gemeinsame (Branchen)Interessen mit einer größeren Schlagkraft vertreten.
Impuls 6: Führe Mitarbeiter*innen und Teams in den Flow
Für Gründer*innen ist bei der Mitarbeiter*innen- und Teamführung entscheidend, zunächst einmal die besten Leute zu interessieren und zu gewinnen. Arbeite an deiner Arbeitgeberattraktivität. Kümmere dich vom ersten Tag der Einstellung an um die Menschen, sodass sie spüren, wie wichtig es für dich ist, gemeinsam mit ihnen Ziele zu erreichen. Frage nicht nur, was sie für dein Unternehmen und dich leisten können, sondern auch, was du für sie tun kannst.
Versuche, jeden dort abzuholen, wo er steht – erwirb dazu ein Führungswissen, mit dem gelingt, auf alle Mitarbeiter*innen individuell einzugehen. So entsteht Flow.
Co-Active-Coaches geben mit stärkenfokussiertem Coaching Hilfe zur Selbsthilfe, entwickeln die Potenziale der Mitarbeiter*innen weiter und unterstützen sie bei der Persönlichkeitsentfaltung. Co-Active-Coach – könnte das dein langfristiges Ziel sein? Denn nicht alle sieben Impulse müssen zugleich umgesetzt werden. Beginne damit, als aufmerksame*r und verstehende*r Zuhörer*in vor allem Fragen zu stellen und ein Vertrauensverhältnis in Gang zu setzen.
Impuls 7: Denke auch mal an dich selbst
„Irgendwann“ ist es an der Zeit, bei allem Elan und Engagement für die Gründung zu prüfen, wo du als Unternehmer*in und als Mensch und Person bleibst. Halte Rückschau und frage dich, ob die Selbstständigkeit (noch immer) in dein und zu deinem Lebenskonzept passt. Gibt es einen Match zwischen den unternehmerischen Zielen und deinen persönlichen Lebenszielen? Finden sich deine individuellen Werte in deinem Unternehmen wieder? Kannst du sie dort leben? Macht dich deine Arbeit auch persönlich stärker?
Fazit: Versuche stets, systemisch zu denken und zu handeln und alle vier Führungsbereiche zu berücksichtigen. Dann ist die Unternehmensperformance oft die logische Folge.
Tipp zum Weiterlesen und -arbeiten
Der Autor Christian Polz, Inhaber und Geschäftsführer von Team-Polz, hat als Experte für Transformation, Agilität, Führung, Teamentwicklung, Changemanagement und Konfliktmanagement den TaschenGuide „Souveräne Unternehmensführung. Inspirationen für herausfordernde Zeiten“ im Haufe Verlag (Freiburg 2025, 128 Seiten, 14,99 Euro, ISBN 978-3-648-18736-4) veröffentlicht.
Methoden und Didaktik im Führungstraining: Interessante Ansätze und spannende Fakten
Entdecken Sie spannende Ansätze und Fakten zu Methoden und Didaktik im Führungstraining.

Moderne Führungstrainings setzen auf eine neue Didaktik: wissenschaftlich fundiert, praxisnah und individuell. Statt Frontalunterricht dominieren heute interaktive Formate und maßgeschneiderte Lernpfade. Ziel ist es, Führungskompetenzen nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern im konkreten Handeln zu verankern – für bessere Führungsergebnisse und eine stärkere Mitarbeiterbindung.
Gerade in dynamischen Märkten wie Deutschland, wo Unternehmen wie Siemens, Bosch oder die Deutsche Telekom auf agile Strukturen setzen, gewinnt adaptives Lernen an Bedeutung. Blended Learning – die Kombination aus Präsenz- und Onlineformaten – bietet dabei maximale Flexibilität und berücksichtigt unterschiedliche Lerntypen.
Die folgenden Abschnitte zeigen, dass und wie erfolgreiche Führungstrainings Lernräume für Reflexion, Austausch und Feedback schaffen.
Maßgeschneiderte Führungskräfteseminare von flow
Gute Führung entscheidet über Motivation, Leistung und Wandel in Organisationen. Die maßgeschneiderten Führungskräfteseminare von flow sind praxisnah, wissenschaftlich fundiert und individuell auf Unternehmensziele abgestimmt.
Ob klassisches Seminar oder ganzheitliches Entwicklungsprogramm – Management- und Leadershipkompetenzen werden gezielt aufgebaut. Der Fokus liegt auf nachhaltigem Praxistransfer, klarer Rollenklärung und konkreten Alltagssituationen.
- Das PowerPotentialProfile® unterstützt bei der fundierten Analyse von Stärken und Entwicklungsfeldern.
- Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Arbeit und moderne Didaktik schaffen die Grundlage für wirksame Führung und starke Teams.
Dank eines erfahrenen Trainer-Teams und skalierbarer Programme lassen sich auch größere Entwicklungsmaßnahmen effizient umsetzen – national wie international.
Eine kostenlose Erstberatung bietet den idealen Einstieg in passgenaue Führungskräfteentwicklung.
Die Rolle der Didaktik in der Führungskräfteentwicklung: Was hat sich verändert?
Didaktik bezeichnet die gezielte Planung und Gestaltung von Lernprozessen – also, wie Wissen vermittelt und Kompetenzen aufgebaut werden. In der Entwicklung von Führungskräften bedeutet das, Lernformate so zu gestalten, dass sie Verhalten langfristig verändern.
Zentrale Elemente sind strukturierte Lernphasen: vom Wissenserwerb über die Anwendung bis hin zur Reflexion. Modelle wie das 70-20-10-Prinzip oder Kolbs Lernzyklus machen deutlich, wie wirkungsvolles Lernen gelingt – durch eine ausgewogene Kombination aus Erfahrung, Austausch und formaler Weiterbildung.
Entscheidend ist dabei die didaktische Kohärenz: Lernziele, Methoden und Evaluation greifen sinnvoll ineinander. Das schafft Klarheit, fördert Motivation und verbessert den Transfer in die Praxis. Empirische Studien belegen: Durchdachte Didaktik erhöht die Wirksamkeit von Trainings deutlich. Sie bildet damit die Grundlage für nachhaltige Führungskräfteentwicklung – praxisnah, fundiert und zukunftsorientiert und auch in Zeiten von Krisen.
Klassische und moderne Methoden im Vergleich: Ein „Besser“ oder „Schlechter“ gibt es nicht – oder doch?
Lange prägten klassische Formate wie Seminare und Vorträge die Weiterbildung. Sie eignen sich gut zur Vermittlung von Grundlagen, stoßen jedoch an Grenzen, wenn es um komplexe Handlungskompetenz geht.
Moderne Lernansätze setzen stärker auf Eigenverantwortung, Erfahrung und Kontext. Methoden wie Action Learning, Design Thinking oder Coaching fördern praxisnahes Lernen und kreative Problemlösung. Hybride Formate, die Theorie mit Anwendung verbinden, unterstützen einen wirksamen Lerntransfer – und steigern die Motivation.
Statt reiner Wissensvermittlung rücken Reflexion, Austausch und konkrete Anwendung in den Fokus. Simulationen, Fallstudien oder Peer-Learning schaffen Raum für gemeinsames Lernen und stärken soziale sowie kommunikative Kompetenzen.
Klassische Methoden, zum Beispiel auch rund um kritisches Hinterfragen, behalten ihren Wert – vorausgesetzt, sie sind didaktisch sinnvoll eingebettet. Entscheidend ist die Balance: Struktur und Flexibilität, Praxisnähe und Individualisierung. So entsteht ein Lernumfeld, das Führungskräfte befähigt, ihr Verhalten nachhaltig und authentisch weiterzuentwickeln.
Interaktive Lernformen und ihre Wirkung
Interaktive Lernformate wie Workshops, Planspiele oder Rollenspiele fördern aktives Mitdenken, Beteiligung und unmittelbares Feedback. Sie schaffen erfahrungsbasierte Lernräume, in denen neues Verhalten nicht nur verstanden, sondern auch erlebt und reflektiert wird.
Durch gemeinsame Aufgaben und Rückmeldungen entsteht ein vertieftes Verständnis für Führungsaufgaben. Simulationen – etwa von Konfliktgesprächen oder Entscheidungsprozessen – ermöglichen realitätsnahe Übungsszenarien, die Problemlösungsfähigkeit, Selbstreflexion und Teamverhalten stärken.
Wenn Teilnehmende eigene Erfahrungen einbringen, steigt nicht nur die Relevanz der Inhalte, sondern auch die Nachhaltigkeit des Lernens. Studien zeigen: Interaktive Formate aktivieren emotionale und kognitive Prozesse stärker als klassische Vermittlungsformate – mit spürbar höherer Motivation und langfristigerem Lernerfolg.
So entstehen lebendige Trainings, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern echte Veränderung ermöglichen – wirkungsvoll, praxisnah und passgenau für moderne Führungsanforderungen.
Was hat die Digitalisierung in Bezug auf das Führungskräftetraining verändert?
Digitale Lernformate haben die Entwicklung von Führungskräften grundlegend verändert. Sie ermöglichen orts- und zeitunabhängiges Lernen – individuell, skalierbar und anschlussfähig an den Arbeitsalltag.
Hybride Konzepte verbinden Online-Lernen mit Präsenzformaten und schaffen so eine optimale Balance aus Flexibilität und persönlichem Austausch. Virtuelle Klassenzimmer, Video-Coachings und digitale Tools fördern Interaktion und Reflexion, auch im digitalen Raum.
Learning-Analytics unterstützen die gezielte Steuerung individueller Lernpfade und machen Fortschritte sichtbar. Digitale Lernökosysteme schaffen kontinuierlichen Zugang zu Inhalten und fördern eigenverantwortliches Lernen im Flow.
Wichtig bleibt: Technologie ersetzt nicht den zwischenmenschlichen Kontakt. Entscheidend ist die didaktische Qualität … also wie Inhalte strukturiert, angewendet und reflektiert werden. Nur so entsteht ein digitales Lernumfeld, das Führung stärkt, Innovation unterstützt und nachhaltige Entwicklung ermöglicht.
Nach wie vor: Feedback und Reflexion als wichtige Lerninstrumente
Reflexion und Feedback sind essenziell für eine wirksame Führungskräfteentwicklung. Sie fördern Selbsterkenntnis, schaffen Orientierung und unterstützen den Transfer in den Arbeitsalltag.
Professionelles Feedback – etwa durch Peer-Coaching, kollegiale Beratung oder strukturierte Rückmeldeschleifen – macht Stärken sichtbar und zeigt Entwicklungspotenziale auf. Reflexionsphasen ermöglichen es, Erfahrungen gezielt zu analysieren und in Handlungsstrategien zu überführen.
Die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird gestärkt, nachhaltiges Lernen gefördert. Modelle wie der Lernzyklus nach Kolb veranschaulichen, wie regelmäßige Reflexion Lernprozesse vertieft und den Kompetenzaufbau unterstützt. Besonders wirkungsvoll sind Lernformate, die Feedback nicht als Bewertung, sondern als Entwicklungschance begreifen. Entscheidend ist eine offene Lernkultur, in der Fragen erlaubt und Fehler Teil des Prozesses sind.
So entstehen Führungspersönlichkeiten, die sich selbst und andere wirksam weiterentwickeln können.
Auch wichtig: Die Teamdynamik und gruppenbezogene Lernprozesse
Lernprozesse in Gruppen fördern wichtige soziale Kompetenzen und die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. In Führungstrainings spielt die Dynamik innerhalb von Teams eine zentrale Rolle, da Führung stets im Zusammenspiel mit anderen erfolgt.
Gemeinsame Übungen, Projektarbeiten und kollektive Reflexionen schaffen ein Umfeld, in dem Vertrauen wächst und offener Austausch möglich ist. Durch das gemeinsame Lösen von Problemen entstehen neue Perspektiven und kreative Lösungsansätze.
Gruppenlernen macht Lernprozesse sichtbar und unterstützt gegenseitige Hilfe. Studien zeigen, dass das gemeinsame Lernen Motivation und Behaltensleistung deutlich verbessert. Modelle wie das Phasenmodell der Gruppenentwicklung – Forming, Storming, Norming, Performing – veranschaulichen, wie sich Gruppen im Lernprozess entwickeln und welchen Einfluss das auf den Lernerfolg hat.
Eine teamorientierte Didaktik verbindet den Wissensaufbau mit sozialem Lernen und stärkt so nachhaltig Führungsfähigkeiten und den Erfolg von Führungsteams.
Kulturelle und emotionale Faktoren: Welche Rolle spielen sie im Lernprozess?
Kulturelle und emotionale Aspekte beeinflussen maßgeblich, wie Führungskräfte lernen und handeln.
- Unterschiedliche Werte, Kommunikationsstile und Erwartungen formen Lernprozesse und erfordern eine bewusste Berücksichtigung kultureller Unterschiede, besonders in internationalen Trainings.
- Gleichzeitig spielt emotionale Intelligenz eine zentrale Rolle. Sie umfasst die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle zu erkennen und zu steuern, fördert Empathie, Selbstwahrnehmung und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen.
- Didaktische Konzepte, die emotionale Faktoren integrieren, ermöglichen intensivere Lernerfahrungen. Studien belegen, dass emotionale Aktivierung die Gedächtnisleistung und Motivation steigert, da sie wichtige neuronale Netzwerke aktiviert.
- Lernumgebungen, die Vertrauen, Offenheit und kulturelle Sensibilität fördern, also den bewussten Umgang mit verschiedenen Normen und Kommunikationsweisen, unterstützen die Entwicklung von Führungskompetenzen besonders effektiv.
So entsteht ein ganzheitliches Lernen, das kulturelle und emotionale Grenzen überwindet.
Wie wird sich das moderne Führungskräftetraining in Zukunft weiterentwickeln?
Die Führungskräftebildung der Zukunft wird geprägt von Personalisierung, technologischen Innovationen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit. Adaptive Lernsysteme, künstliche Intelligenz und datenbasierte Analysen ermöglichen individuell zugeschnittene Lernwege und fördern kontinuierliches Lernen.
Gleichzeitig gewinnt sinnorientierte Unternehmensführung zunehmend an Bedeutung. Trainings zielen nicht nur auf den Kompetenzaufbau, sondern auch auf die Vermittlung von Werten ab.
Spielerische Elemente wie Gamification und virtuelle Realität erweitern die didaktischen Möglichkeiten und schaffen neue Lernerfahrungen. Kooperationen zwischen Wissenschaft und Praxis fördern innovative Forschungsansätze und Pilotprojekte.
Zukunftsorientierte Führungstrainings verbinden digitale Innovationen mit der persönlichen Entwicklung der Lernenden. Dieser Wandel erfordert eine flexible Didaktik, die Lernen als lebenslangen Prozess begreift. So bleibt die Führungsausbildung ein wesentlicher Erfolgsfaktor moderner Organisationen und Ausdruck einer lebendigen, lernenden Unternehmenskultur.
Abschließendes: Darum ist es so wichtig, das Thema „Führungskräftetraining“ immer wieder anzugehen
Führungskräftetraining ist ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Organisationsentwicklung. Die Anforderungen an Führungskräfte verändern sich stetig – durch technologische Innovationen, globale Vernetzung und neue Werteorientierungen. Um den komplexen Herausforderungen gerecht zu werden, braucht es kontinuierliche Weiterbildung, die nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch praktische Kompetenzen fördert. Nur so können Führungskräfte flexibel und wirksam agieren.
Zudem sorgt regelmäßiges Training dafür, dass Führungskräfte ihre eigene Rolle reflektieren, ihre sozialen Fähigkeiten stärken und sich auf wechselnde Teams und Märkte einstellen. Führung ist immer auch Beziehungsarbeit, die eine kontinuierliche Entwicklung verlangt. Wer diesen Prozess vernachlässigt, riskiert nicht nur den Erfolg der Organisation, sondern auch die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden.
Deshalb ist es entscheidend, das Thema Führungskräftetraining immer wieder aufzugreifen und den Lernprozess als festen Bestandteil der Unternehmenskultur zu verankern.
Jetzt erst recht: Wie Krisen echte Gründer*innen hervorbringen
Deutschland erlebt ein Gründungs-Revival: 2024 wurden rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent nach Jahren des Rückgangs. Dabei entstehen in Krisenzeiten oft die stärksten Innovationen: BioNTech, Flix oder 1komma5° wurden in Umbruchsphasen gegründet und sind heute Marktführer. Doch warum zögerten viele gerade während Pandemie und Energiekrise? Es fehlt nicht nur an Risikokapital, sondern auch am Mut, neue Wege zu gehen. Jetzt ist ein radikales Umdenken gefordert: weniger Angst vor dem Scheitern, mehr Fokus auf nachhaltige Geschäftsmodelle und Zukunftsmärkte. Warum Krisen der beste Zeitpunkt sind, um groß zu denken, liest du im Folgenden.

Inflation, Unsicherheit, Strukturwandel: Viele Menschen schrecken aktuell vor dem Schritt in die Selbstständigkeit zurück. Steigende Preise, schwankende Märkte und unklare Zukunftsaussichten lassen viele potenzielle Gründer*innen zögern. Doch genau in solchen Umbruchsphasen entstehen traditionell die stärksten Innovationen. Während der Finanzkrise 2008–2010 entstanden weltweit Startups wie Airbnb und Uber, die heute Milliardenunternehmen sind. Auch in Deutschland gibt es Beispiele: BioNTech (2008) stellte mitten in unsicheren Märkten die Weichen für mRNA-Forschung und rettete während Corona Millionen Leben. Flix (2013) nutzte die Krise und die Fernbus-Liberalisierung, um ein global führendes Mobilitätsunternehmen aufzubauen. Auch jüngere Unicorns wie Personio (HR-Tech) oder 1komma5° (Solar) zeigen: Krisen eröffnen enorme Chancen für diejenigen, die mutig handeln.
Paradox ist jedoch, dass ausgerechnet in den Hochzeiten der jüngsten Krisen – Pandemie, Energiepreisschock, geopolitische Unsicherheit – die Gründungsquote in Deutschland zunächst eingebrochen ist. Viele hielten sich zurück, aus Angst vor Risiko. Doch genau das macht die aktuelle Entwicklung so spannend: Nach Jahren des Rückgangs deutet sich eine Trendwende an. 2024 wurden in Deutschland rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn alte Geschäftsmodelle ins Wanken geraten und bestehende Strukturen nicht mehr funktionieren, öffnet sich Raum für neue Ideen, kreative Geschäftsansätze und disruptive Technologien.
Wer heute gründet, baut nicht nur ein Unternehmen auf, sondern gestaltet aktiv die Zukunft mit. Die aktuelle Krise ist kein Hindernis, sondern ein Katalysator für Fortschritt. Doch warum ist die Gründungsquote in Deutschland in den Hochzeiten der letzten Krisen nicht gestiegen, sondern sogar gesunken? Die Gründe sind vor allem im Mindset zu sehen: zu viel Vorsicht, zu wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Viele lassen sich von gescheiterten Start-up-Stories entmutigen – anstatt von erfolgreichen Beispielen inspirieren. Hinzu kommt die Finanzierungslücke: Während in den USA oder UK auch Frühphasen-Investments leichter zugänglich sind, stoßen Gründer*innen hierzulande oft auf Hürden.
Ein neues Narrativ für Gründer*innen
Laut KfW-Gründungsmonitor 2025 bevorzugen 36 Prozent der 18- bis 29-Jährigen Selbständigkeit gegenüber einer Anstellung. Die Planungsquote für Gründungen ist nach einem Tief im Jahr 2023 wieder gestiegen – aktuell verfolgen 4,9 Prozent der Bevölkerung konkrete Gründungspläne. Gefordert ist ein Umdenken im Gründungsdiskurs: weg vom Businessplan-Dogma, hin zu Haltung, Resilienz und echten Netzwerken. „Zu viele bleiben in ihrer Idee stecken, anstatt ins Handeln zu kommen. Gerade in aktuellen Krisenzeiten zeigt sich, wer bereit ist, Systeme zu hinterfragen – und bessere aufzubauen. Wir brauchen Gründer*innen, die nicht nur an kurzfristigen Profit denken, sondern langfristig nachhaltige Unternehmen schaffen. Dabei zeigen die vergangenen Jahre, wie wertvoll Gründungen für eine ganze Volkswirtschaft sind. Weltweit wurden in Krisen neue Branchen geformt: Mobility (Flix), HealthTech (BioNTech), Renewable Energy (Enpal) oder HR-Tech (Personio). In unsicheren Zeiten wächst der Innovationsdruck dort am stärksten, wo alte Strukturen versagen – etwa im Gesundheitswesen, im Energiesektor oder in der digitalen Infrastruktur. Wer hier investiert, schafft nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern stärkt zentrale Zukunftsfelder.
Wirtschaftliche Bedeutung von Gründungen
Unternehmensgründungen sind weit mehr als individuelle Erfolgsgeschichten. Sie schaffen jedes Jahr Hunderttausende neuer Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und stärken den Wettbewerb – ganz nebenbei entlasten sie auch die öffentlichen Haushalte durch Steuererträge. Laut KfW Research tragen Start-ups entscheidend dazu bei, neue Technologien schneller in den Markt zu bringen und so die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern. Auf den Punkt gebracht: Wer gründet, schafft nicht nur für sich selbst neue Chancen, sondern immer auch für andere: Arbeitsplätze, Perspektiven und Impulse für ganze Branchen. Gründungen sind kein Nischenphänomen – sie sind ein zentraler Motor unserer Wirtschaft.
Auch im internationalen Vergleich zeigt sich Nachholbedarf: Nach OECD-Daten lag der Anteil von Venture Capital am deutschen Bruttoinlandsprodukt 2021 bei lediglich rund 0,11 Prozent – in den USA war er fast fünfmal so hoch. Wenn wir international mithalten wollen, müssen wir mutiger werden – und Krisen endlich als das sehen, was sie sind: der beste Zeitpunkt für neue Ideen und starke Unternehmen. Ich kenne diese Dynamik aus erster Hand: Mit meiner Beteiligung an GreenTech-Unternehmen wie Febesol und Thermondo will ich auch zeigen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle gerade in Krisenzeiten enorme Relevanz gewinnen können – für die Umwelt, für Investor*innen und für ganze Wirtschaftszweige.
Generation Z denkt Gründen neu
Gerade die Generation Z bringt frischen Wind in die Gründungsszene. Studien zeigen, dass viele junge Menschen heute bereits unternehmerisch denken – aber zu eigenen Bedingungen: digital, flexibel und sinnorientiert. Laut der Bertelsmann-Studie „Pioneering Gen Z Entrepreneurs“ streben Gen Z-Gründer*innen bewusst nach Nachhaltigkeit, Anpassungsfähigkeit und kollaborativen Arbeitsweisen. Dabei verbinden sie wirtschaftlichen Erfolg mit Selbstbestimmung, Work-Life-Balance und Purpose – und schaffen so ein neues Gründer-Mindset.
Diese neuen Gründer*innen fragen nicht nur nach Rendite, sondern auch nach Sinn und Selbstbestimmung. Doch um dieses Potenzial freizusetzen, braucht es Rückenwind: weniger Bürokratie, bessere Förderprogramme, Steuererleichterungen, Zugang zu Risikokapital. Denn ohne den finanziellen Spielraum laufen viele gute Ideen Gefahr, in der Konzeptphase stecken zu bleiben. Deutschland kann es sich nicht leisten, Gründungstalente mit Purpose-Mindset zu verlieren. Wir brauchen mutige Anreize für die Generation, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
Der Autor Daniel Fellhauer ist Seriengründer, Transformationsexperte und Buchautor. 2009 gründete er während der Finanzkrise die FEBESOL GmbH und baute in den Folgejahren mehrere Unternehmen im Bereich Solar, Wärmepumpen und erneuerbare Energien auf. Heute ist er Chief Transformation Officer bei Thermondo und eingesetzter CEO bei FEBESOL.
Neue Narrative gesucht
Warum es sich für Start-ups auszahlt, Unternehmensbotschaften in einen wertstiftenden Kontext zu setzen – insbesondere in medial übererregten Zeiten.

In Zeiten multipler Krisen, geopolitischer Turbulenzen und wirtschaftlicher Unsicherheiten verwundert es wenig, dass bisherige Gewissheiten infrage gestellt werden. Selbstverständliche Narrative und Regelwerke, die uns als Gesellschaft verbinden, drohen auseinanderzubrechen. Kohärente Zukunftsbilder, basierend auf einem dem Menschen dienenden Fortschritt, scheinen sich partiell in Sehnsüchte nach der Vergangenheit aufzulösen.
Im zunehmend komplexen, polarisierten, politisierten und moralisierten öffentlich-medialen Raum eröffnen sich für Start-ups bzw. deren Gründer*innen interessante Möglichkeiten, ein auf die Unternehmensziele einzahlendes Narrativ aufzubauen. Eines, das zugleich Zuversicht in gesellschaftliche Narrative einwebt. Voraussetzung hierfür ist die Bereitschaft, über den Tellerrand hinaus in größeren Zusammenhängen vernetzt zu denken und zu kommunizieren.
Den altlastenfreien Innovationsweitblick nutzen
Start-ups sind auf Medienarbeit und Öffentlichkeitswirkung angewiesen, sei es für die Erklärung einer neuen Technologie, die Bekanntmachung der eigenen Marke, Produkte oder Dienstleistungen, die Gewinnung neuer Mitarbeitenden oder auch Investor*innen, die eine Finanzierungsrunde ermöglichen.
Sie sind per definitionem Unternehmen, die sich durch eine neue, innovative Geschäftsidee und hohes Wachstumspotenzial auszeichnen. Nicht wenige von ihnen wirken disruptiv auf traditionelle Geschäftsmodelle ein. Und sie befinden sich in Gründung, sind im Neu-Erfinden, mit Blick nach vorne, mit einer Vision, frei von in der Vergangenheit eingegangenen und heute einschränkenden Verbindlichkeiten sowie frei von zukunftserschwerenden internen Strukturen. Ganz anders als zahlreiche Großkonzerne, die sich in Krisen- oder unsicheren Zeiten nicht selten mit hohem Zeit-, Geld- und Erklärungsaufwand um den Abbau (von Mitarbeitenden, Strukturen etc.) und nicht um zukunftsgestaltenden Aufbau kümmern dürfen.
Start-ups beschäftigen sich tagein, tagaus mit Zukunft. Es geht um Wachstum, das Erreichen der nächsten Unternehmensphase, der nächsten Finanzierungsrunde bzw. der nächsten zu finanzierenden Wachstumsphase – immer mit dem Ziel, die Unternehmensvision wirklicher werden zu lassen. Sie sind daher prädestiniert, in Zeiten des „krassen Wandels“ neue Narrative, neue Zukunftserzählungen, gesellschaftlich positiv wirkend mitzuschreiben.
Häufig sind Start-ups im Internet- oder Technologiebereich tätig, einem Sektor, der auf die derzeitige sogenannte Zeitenwende sehr beschleunigend einwirkt. Ihr altlastenfreier Innovationsweitblick ermöglicht es ihnen, mit ihrer Expertise sinn- und wertstiftend für ihr Unternehmen in den öffentlichen Diskurs einzusteigen und dadurch auch gesellschaftlich lösungsorientiert sowie sinn- und wertvoll zu kommunizieren – wenn sie denn strategisch vorgehen bzw. die Möglichkeiten, die Kommunikation insbesondere im jetzigen Zeitfenster bietet, intelligent nutzen.
Die Möglichkeiten intelligent umsetzen
Kommunikation sollte von Beginn an so angelegt sein, dass sie kontinuierlich und besonnen als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie, des Businessplans, die Unternehmenszielsetzung zu unterstützen vermag und nicht für ein kurzzeitig zwar helles, aber letztlich inszeniertes, geld- und zeitverbrennendes Strohfeuer missbraucht wird.
Kommunikationsarbeit kann heute in Teilen effizient mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) erledigt werden. Erkennbar ist inzwischen jedoch, dass mit der Automatisierung der Kommunikationswerkbank bzw. der Erledigung der handwerklichen Aufgaben durch KI vieles, das der strategischen Differenzierung, Positionierung, Abgrenzung zum Mitbewerb im öffentlich medialen Raum und somit dem Wettbewerbsvorteil dient, vernachlässigt wird. Denn KI ist zur Lösung dieser strategischen Aufgabe, diesem vernetzten Denken sowie der Kontextualisierung nicht in der Lage. Gründer*innen sollten aber auf diese strategische Möglichkeit des intelligent vernetzten Kommunizierens nicht verzichten und sich gerade im Hinblick auf das Narrativ sehr bewusst mit dem medialen „In-Kontext-Setzen“ der eigenen Unternehmensbotschaften beschäftigen.
Die Einordnung von Unternehmensbotschaften in einen größeren medialen und gesellschaftlichen Kontext ist nicht zu unterschätzen. Innovative Ideen und Botschaften genialer Gründer*innen können im individuell gewählten Kontext mit Impulsen der Märkte, aber auch gesellschaftlichen Entwicklungen und eventuell regulatorischen Anforderungen medial verbunden werden. In der jetzigen Zeitenwende, die neue gesellschaftliche Narrative erst noch finden muss, ist das eine spannende Perspektive für Start-ups im Hinblick auf ihr zu hebelndes Entwicklungspotenzial.
Es ist immens hilfreich, sich in einer sehr frühen Entwicklungsphase zu überlegen, in welchem inhaltlichen Kontext das eigene Start-up mit seinen Produkten, Dienstleistungen, Anliegen und seinem Know-how sichtbar werden möchte. Weitere wertvolle Fragestellungen sind beispielsweise: Welcher Kontext macht potenzielle Kund*innen neugierig und unterstützt bei der Wertschaffung? Welche Medienkanäle und -formate können dabei helfen? Wie lässt sich das Risiko minimieren, einem intransparenten Kontext ausgeliefert zu sein, der im schlimmsten Fall dem Unternehmen oder schlichtweg der Reputation schadet?
Was gilt es zu beachten, was zu vermeiden?
Es birgt Risiken, sich bei der Medienauswahl zum Beispiel nur auf einen einzigen trendigen Social-Media-Kanal zu fokussieren. Aufgrund der aktuellen Algorithmus-Politik der digitalen Plattformbetreibenden ist es für die Nutzer*innen von Social-Media-Kanälen weder vorhersehbar noch transparent, geschweige denn planbar, wem in welchem Kontext die eigenen Botschaften zugespielt werden. Es ist der Algorithmus, der Zielgruppe und Kontext bestimmt.
Wichtig ist daher, in größtmöglicher Unabhängigkeit von einzelnen Social-Media-Kanälen zu kommunizieren, auch aufgrund der in mancher Hinsicht verwirrenden Verschiebungen bei Regularien, beim Common Sense im Tech getriebenen medialen Raum sowie bei den Geschäftspraktiken der Tech-Konzerne. Fokussiert sich ein Start-up zu stark auf einen einzelnen dieser Kanäle, kann es zudem ohne eigenes Verschulden in eine missliche Lage geraten, wenn beispielsweise die Plattform einen Reputationsschaden erleidet oder nicht mehr en vogue ist – wofür es reale Beispiele gibt.
Social-Media-Kanäle unreflektiert ganz zu meiden, wäre (Stand heute) ein falsch gezogener Schluss; es gilt vielmehr, die für das eigene Anliegen geeigneten Plattformen – so weit sie sich wirklich eignen – zu durchschauen, um sie klug neben anderen, auch klassischen Medien im wohl durchdachten Medienmix zu nutzen.
Aktuelle Entwicklungen in der Social-Media-Welt zeigen, dass der Glaube naiv ist, auf den digitalen Plattformen der großen Tech-Giganten einen erkenntnisgewinnenden Diskurs mitgestalten zu können, der auf Inhalten sowie sich gegenseitig beziehenden Argumenten basiert und das eigene Narrativ losgelöst von den Interessen der Plattformanbietenden aufbaut. Dabei verkannt werden die mit dem Geschäftsmodell der Tech-Konzerne verbundene Architektur sowie die dahinterstehende Monetarisierung und Marktlogik. Die Art und Weise, in der sich deren Algorithmen auf die Verbreitung eingespielter Botschaften, Kommentare und Bewertungen auswirkt, bedient primär das Anliegen der Tech-Konzerne, verwertbare Daten für das eigene Geschäftsmodell zu generieren, und zahlt bestenfalls eingeschränkt auf die Kommunikationsstrategie der Nutzer*innen ein.
Fazit
Professionelle Unternehmenskommunikation in den heutigen einerseits Paradigmen verändernden und andererseits medial übererregten Zeiten heißt für Start-ups vor allem, klare Botschaften, die eine stringente Unternehmensentwicklung bzw. -vision vermitteln, in einen für das Unternehmen transparenten sowie inhaltlich relevanten medialen Kontext zu setzen. Selbstbestimmt und Stakeholder-orientiert, jedoch nicht Algorithmus geleitet, lassen sich so unternehmerische Handlungsspielräume kommunikativ kreieren und vergrößern – eine große Chance in der nach neuen Narrativen suchenden Zeitenwende.
Die Autorin Christiane L. Döhler ist Inhaberin von DOEHLER Communications in München und verfügt über langjährige Erfahrung sowohl in der Private-Equity-/Venture-Capital-Branche als auch in der Beratung zu Strategie, Positionierung und Kommunikation.
Eine verrückte Utopie aus der Zukunft?
Die Wirtschaft der Zukunft wird zwangsläufig eine andere sein: Angesichts der Klimakrise bzw. der massiven Überbeanspruchung fast aller Ressourcen genügt es längst nicht mehr, nur weniger umweltschädlich zu handeln. Jan Schmirmund, Experte für regenerative Transformation und Innovation, will mit seinem neuen Buch „Regenerative Wirtschaft – Wie Pioniere eine lebenswerte Ökonomie gestalten“ (Murrmann Verlag) Mut machen, neue Wege zu gehen. Mehr dazu im Interview mit Jan.

Als Startup Advisor begleitest du auch junge Unternehmen auf ihrem Weg zu einer regenerativen Wirtschaftsweise. Was genau meint regeneratives Wirtschaften?
Regeneratives Wirtschaften bedeutet zunächst einmal, die Erkenntnis zuzulassen, dass wir als Menschen mitsamt unseren Organisationen untrennbar mit dem ökologischen System dieses Planeten verbunden und damit von ihm abhängig sind. Daraus folgt zwangsläufig, dass wir uns selbst schaden, wenn wir das System weiter zerstören – und dabei reicht es eben nicht aus, die Zerstörung nur etwas langsamer zu betreiben. Sprich: etwas weniger CO₂ auszustoßen, weniger Müll zu produzieren oder – um es mal pointiert zu sagen – die Kinder, die in deiner Lieferkette Produkte herstellen, nur noch bis zu den Knöcheln in der giftigen Chemiesuppe stehen zu lassen, statt vorher bis zu den Knien.
Der zweite Schritt ist dann, das eigene Handeln nach dieser Erkenntnis auszurichten. Mit reinen Optimierungsmaßnahmen im Sinne von „Do less harm“ wird man das Ziel nicht erreichen. Insbesondere dann nicht, wenn wir für ein Produkt zwar weniger Ressourcen benötigen, dafür aber umso mehr dieser Produkte herstellen. Am Ende wird der Schaden größer statt kleiner sein. Regeneratives Wirtschaften basiert daher auf einem anderen Ansatz: nämlich die Dinge von Grund auf anders zu machen – so, dass sie für den Planeten nützlich sind.
Ein Ansatz, der dieses Prinzip perfekt illustriert, ist Cradle to Cradle – also „von der Wiege zur Wiege“. Es geht dabei darum, Produkte so zu designen, dass die dort verwendeten Rohstoffe in perfekten Kreisläufen – biologischen oder technischen – unendlich oft wiederverwertet werden können. Das heißt: Jedes Material, das verbaut wurde, wird zum Rohstoff für neue Produkte. So soll ein ewiger Kreislauf ohne Müll entstehen.
In meinem Buch nutzt Michael Braungart, der Erfinder des Cradle-to-Cradle-Ansatzes und Professor an der Leuphana Universität in Lüneburg, das Beispiel eines Kirschbaums: Ein Kirschbaum reduziert nichts. Er spart auch nichts ein. Im Gegenteil: Er wuchert sogar mit Blüten und Früchten. Der Unterschied ist, dass diese nützlich für das ökologische System sind. Nach diesem Prinzip würde man auch nicht versuchen, Autoreifen zu produzieren, die weniger Mikroplastik abgeben, sondern der Abrieb wäre eben Rohstoff für die Natur. Das ist der Grundgedanke des gesamten regenerativen Wirtschaftens: ein nützlicher Teil des Gesamtsystems sein, der mit, vom und für das System wirkt – wie ein Baum im Wald.
Was dabei noch wichtig ist: Wachstum ist nichts Schlechtes, aber eben nicht unbegrenzt, so wie es gerade noch das Paradigma der degenerativen Wirtschaft ist. Wir sprechen in unserer Community daher auch lieber von Gedeihen als von Wachsen. Eine gedeihende regenerative Wirtschaft blüht wie ein Kirschbaum und bleibt dabei innerhalb der planetaren Grenzen und oberhalb der sozialen Fundamente, wie es Kate Raworth eindrucksvoll in ihrem Werk „Doughnut Economics“ beschreibt.
Gibt es Branchen, die für eine regenerative Transformation besonders gut geeignet sind?
Nicht in allen Branchen oder allen Unternehmen ist es gleich leicht. In der Landwirtschaft gibt es schon viele Betriebe, die regenerativ wirtschaften und Böden sowie Humus aufbauen, statt sie auszulaugen, oder zu einer Verbesserung der Biodiversität beitragen, statt nur weniger Arten auszurotten. Für andere Unternehmen, die beispielsweise Pflastersteine herstellen, liegen die Lösungen nicht direkt auf der Hand. Dennoch kann man sich auf den Weg machen. So zeigt etwa Luisa Rinn mit ihrem Unternehmen Rinn Betonsteine aus Gießen, dass auch hier vieles möglich ist.
Ja, es dauert vielleicht länger und ist mit Anstrengung verbunden. Das gilt für alle Branchen. Am Ende kommt es auf die individuelle Situation des Unternehmens an, wie leicht oder schwer es ist.
Wie können Start-ups als Innovationsträger aktiv zur regenerativen Transformation beitragen?
Da gibt es wirklich viele Wege. Start-ups haben es leichter als etablierte Unternehmen, weil sie die Chance haben, die Dinge von Grund auf richtig zu machen. Man kann sich als Start-up zum Beispiel direkt einen gemeinwohlorientierten und regenerativ ausgerichteten Purpose geben und das Unternehmen danach ausrichten. Und/oder man kann Leistungen anbieten, die es anderen Unternehmen erleichtern, regenerativ zu wirtschaften. In meinem Buch gibt es das Beispiel von Torsten Becker und seinem Start-up carbonauten aus Eberswalde. Torsten und sein Team produzieren über einen Pflanzenkohle-Ansatz Rohstoffe für Branchen wie Landwirtschaft, Bau oder Chemie, die es ermöglichen, CO₂-negative Produkte zu entwickeln. Oder nehmen wir das von Alma Spribille, Andreas Schmucker und Nico Tucher gegründete WEtell, einem Anbieter von Mobilfunkleistungen aus Freiburg, der regenerativ agiert, da durch das Design des Geschäftsmodells unter anderem mehr grüne Energie erzeugt wird, als durch die Nutzung der Mobilfunk-Infrastruktur entsteht.
Welche Schritte können Start-ups konkret gehen, um eine regenerative Wirtschaftsweise zu implementieren?
In einem vom BMWK geförderten Inkubatorprogramm, in dem ich mitwirke, zu finden unter www.reconnect-inkubator.org, helfen wir gemeinwohlorientierten Start-ups und KMU dabei, die drei wesentlichen Hebel für regeneratives Wirtschaften zu stärken. Dazu gehören neben der Kultur und dem Organisationsdesign auch das Geschäftsmodell und drittens – und ganz besonders – der Aufbau eines regenerativ ausgerichteten Business-Ökosystems, das ein Netzwerk bildet, das insgesamt regenerativ auf unsere ökologischen und sozialen Systeme wirkt.
Außer der Teilnahme an einem Inkubatorprogramm (und davon gibt es aktuell mehrere) kann man sich auch einen erfahrenen Berater ins Boot holen, sich um einen Platz in einem der Impact Hubs weltweit bemühen oder man startet erstmal ganz niederschwellig mit einem Buch. Das kann meines sein, wenn man ganz am Anfang steht, oder auch ein so tolles Werk wie „The Stellar Approach“ von TheDive in Berlin. Insbesondere als größeres Unternehmen sollte man sich aus meiner Sicht an eine erfahrene Transformationsberatung wenden.
Hast du Beispiele von jungen Unternehmen, die erfolgreich regenerative Ansätze verfolgen?
Oben habe ich ja schon ein paar Beispiele genannt. Weitere wären der Interior-Designer Sven Urselmann, der Zukunftsort „Wir Bauen Zukunft“ in Mecklenburg-Vorpommern, der Landwirtschaftsbetrieb Jucker Farm aus der Schweiz oder auch das Franz!Werk in Tübingen, das nach dem Prinzip gemeinschaftsbasierten Wirtschaftens, ähnlich dem bekannten Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, arbeitet.
Weitere bekannte Beispiele sind die von Anna und Ran Yona gegründete Schuhmanufaktur Wildling aus Engelskirchen, die Suchmaschine Ecosia, die Firma hinter der Zeitschrift Neue Narrative (NN Publishing GmbH), der Verein Reinventing Society e.V. oder auch das 2021 von Dr. Joel Eichmann und Felix Wollenhaupt in Gießen gegründete Green Elephant Biotech. Es gäbe noch viel mehr Beispiele aufzuzählen; sie sind dabei alle unterschiedlich im Ansatz und auch im Fokus. Dennoch ist ihnen gemeinsam, dass sie als Vorbilder für eine neue Art des Wirtschaftens agieren und zeigen, dass es eben auch anders geht.
Umfragen zeigen, dass mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen die Umsetzung ethischer und nachhaltiger Ausgaben für zu kostspielig hält bzw. sich sorgt, dabei die finanzielle Stabilität aufs Spiel zu setzen. Was muss sich ändern, damit regenerative Transformation als wichtiger Schlüssel zu einer zukunftsfähigen und prosperierenden Wirtschaft erkannt und gelebt wird?
Puh. Komplexe Frage. Katrina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltiges Wirtschaften, vertritt die Auffassung, dass das Prinzip Freiwilligkeit bei Unternehmen gescheitert ist. Ich würde dem insofern zustimmen, als es ohne Leitplanken aus der Politik sehr schwer wird. Was wir aber vor allem auch brauchen, sind viele positive Beispiele, die anderen Unternehmer*innen zurufen: „Seht her, es geht. Auch für dich, denn die regenerative Wirtschaft ist keine verrückte Utopie aus ferner Zukunft, sondern sie ist schon da. Klein zwar, aber kraftvoll und deutlich anschlussfähiger an das Bestehende, als viele denken.“
Und, ganz wichtig: Regenerativ zu wirtschaften bedeutet nicht, auf irgendetwas zu verzichten. Im Gegenteil. Man tauscht vielmehr einen Haufen negativer Dinge gegen genauso viele positive ein. Und Geld darf man auch weiterhin verdienen. Viele der hier genannten Protagonisten zeigen das sehr deutlich und dokumentieren damit eindrucksvoll: Regeneratives Wirtschaften ist möglich.
Danke, Jan, für deine Insights
Die Kunst der Ideenfindung: Wie Gründer*innen Kreativität entfachen können
Wie Gründer*innen mit der richtigen Kombination aus Strategie, Umfeld und persönlichem Engagement den kreativen Prozess der Ideenfindung erfolgreich meistern können.
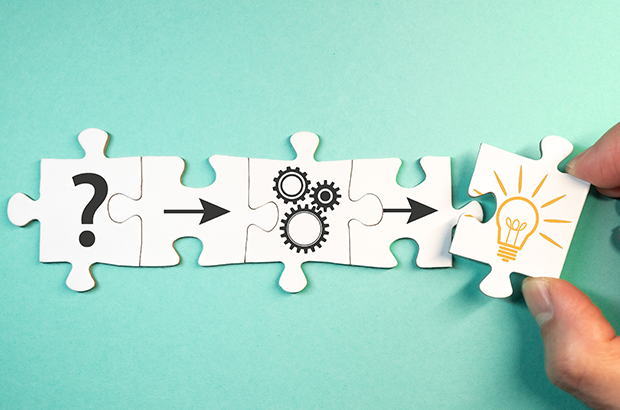
Für Gründer*innen und Start-ups ist die Fähigkeit, innovative Geschäftsideen zu entwickeln, entscheidend für den langfristigen Erfolg. Doch die Suche nach einer zündenden Idee erweist sich häufig als herausfordernd. Kreativität ist kein Zustand, den man einfach aktivieren kann. Stattdessen erfordert es eine Kombination aus Techniken, Inspirationen und einem geeigneten Umfeld, um die besten Ergebnisse zu erzielen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, wie Gründer ihre kreative Energie freisetzen und effektiv nutzen können. Es gibt zahlreiche Strategien, um die persönliche Kreativität anzuregen und dabei auch langfristig ein inspirierendes Arbeitsumfeld zu schaffen.
Die richtigen Rahmenbedingungen für Kreativität schaffen
Der erste Schritt, um Kreativität zu fördern, besteht darin, das richtige Umfeld zu schaffen. Eine entspannte Atmosphäre und ausreichend Zeit sind Schlüsselfaktoren, um gedankliche Blockaden zu lösen. Offene Räume, inspirierende Designs oder bewusst eingeplante Pausen können dabei hilfreich sein, den Fokus zu schärfen und neue Perspektiven zu eröffnen. So können auch vermeintlich festgefahrene Situationen überwunden werden. Besonders die Gestaltung des Arbeitsumfeldes, sei es durch Pflanzen, angenehme Beleuchtung oder kreative Rückzugsorte, trägt dazu bei, das Wohlbefinden zu steigern und die Gedanken zu beflügeln.
Ein hilfreicher Ansatz ist zudem die Anwendung von Kreativitätstechniken. Ob Brainstorming, Mind-Mapping oder Design Thinking – der strukturierte Einsatz solcher Methoden kann den Weg zu innovativen Ideen ebnen. Diese Techniken fördern nicht nur den Ideenfluss, sondern helfen auch, bereits entwickelte Konzepte miteinander zu kombinieren und weiterzuentwickeln. Zusätzlich sollten Gründer*innen sich bewusst machen, dass es nicht nur um Masse geht, sondern die Qualität der Ideen ebenfalls entscheidend ist – dies lässt sich durch die richtige Priorisierung der Techniken verbessern. Es lohnt sich dabei, verschiedene Ansätze auszuprobieren, um den jeweils passendsten für das eigene Team oder die jeweilige Situation zu finden.
Darüber hinaus profitieren Gründer*innen von Netzwerken und Communities, um ihre Ideen auf die Probe zu stellen. Plattformen speziell für Gründer*innen bieten Raum, um sich über Herausforderungen und Lösungen auszutauschen. Kreative Impulse können oft auch aus der Interaktion mit anderen Gleichgesinnten erwachsen. Die richtige Balance zwischen ruhigem Nachdenken und aktivem Austausch ist entscheidend, um strategisch wertvolle Innovationen zu entwickeln. Ein gut gepflegtes Netzwerk kann zudem als wertvolle Ressource bei der Suche nach Experten oder Kooperationspartnern dienen. Besonders Mentoring-Programme oder Events, wie Start-up-Wettbewerbe, können dabei helfen, wertvolle Kontakte zu knüpfen und gegenseitig voneinander zu lernen.
Strategien zur Inspiration: Der Blick über den Tellerrand
Inspiration ist ein wesentlicher Treiber für neue Geschäftsideen. Allerdings funktioniert sie nicht auf Knopfdruck. Eine interessante Möglichkeit, frischen Wind in den Denkprozess zu bringen, besteht beispielsweise im Einsatz einer speziellen Werbeagentur für Social Media, die kreative Werbelösungen liefert. Sie öffnen Türen zu innovativen Ansätzen, die für Gründer besonders wertvoll sein können – sei es bei der Markenbildung oder der Kundenansprache. Kreativität kann nämlich auch stark von Außenstehenden profitieren, die einen Blick auf die Ideen werfen und neue Aspekte einbringen.
Auch die Nutzung moderner Technologien wie einem effektiven Facebook Ads Tool kann neue Perspektiven eröffnen. Die Analyse von Nutzerverhalten und Trends liefert oft wertvolle Daten, die zur Entwicklung kreativer Ideen beitragen. Moderne Tools und Plattformen erleichtern es Gründern, relevante Zielgruppen zu identifizieren, die individuelle Bedürfnisse und Wünsche haben, auf die sich eine Geschäftsidee stützen kann. Besonders datenbasierte Ansätze können helfen, Ideen stärker an den realen Bedürfnissen der Zielgruppe auszurichten und so langfristigen Erfolg zu sichern. Dabei profitieren Gründer*innen nicht nur von Effizienz, sondern auch von frischen Daten, die regelmäßig aktualisiert werden können, um Anpassungen vorzunehmen.
Ein weiterer Schlüssel zur Inspiration liegt in der Analyse bestehender Branchen. Das Studium alternativer Geschäftsfelder, aktueller Innovationen und sogar historischer Erfolge anderer Startups kann frische Denkanstöße bieten. Auch hier hilft ein analytischer Blick, um etwa Nischen zu entdecken oder bestehende Lösungen mit neuer Raffinesse weiterzuentwickeln. Wer offen für neue Impulse ist, profitiert oft entscheidend bei der Ideenfindung und kann unter Umständen völlig neue Märkte erschließen. Dazu gehört auch das bewusste Hinterfragen von bestehenden Prozessen, um neue Ansätze zu testen. Ein wenig Mut zur Veränderung sowie kontinuierliches Experimentieren sind hierbei genauso wichtig wie analytische Fähigkeiten, die helfen, Risiken zu minimieren.
Last but not least: die Praxis der Innovation. Besonders in Bereichen wie dem Innovationsmanagement finden sich zahlreiche Anregungen, wie kreative Herangehensweisen systematisch entwickelt und optimiert werden können. Kreativität und Innovation sind entscheidende Pfeiler, um sich langfristig von Konkurrenz abzuheben. Besonders im Innovationsmanagement gibt es viele Fallstudien und Best Practices, die inspirierend wirken können.
Doch nicht nur über den eigenen Tellerrand zu blicken, sondern auch ungewöhnliche Verknüpfungen herzustellen, führt häufig zu bahnbrechenden Ergebnissen. Ein bekannter Ansatz hierbei ist das „Laterale Denken“, bei dem logische Lösungswege verlassen werden, um kreative Assoziationen zu fördern. Unternehmer*innen können durch diesen Perspektivwechsel neue Verbindungen entdecken und scheinbar unvereinbare Ideen miteinander verknüpfen. Besonders bei scheinbaren Sackgassen können solche Denkmethoden sehr wertvoll sein. Es lohnt sich, diese Methode auch in Teams zu integrieren, um unterschiedliche Perspektiven und Denkweisen zu kombinieren – oft entstehen auf diese Weise besonders innovative Ergebnisse.
Zuletzt sei erwähnt, wie wichtig es für Gründer*innen ist, sich beim Prozess der Ideenfindung Feedback von außen zu holen. Feedback von potenziellen Kund*innen oder die gezielte Diskussion der Ideen in Gründungsforen kann sowohl wertvolle Erkenntnisse liefern als auch ein Gefühl dafür geben, wo die größte Begeisterung liegt. Die Verwendung offener Plattformen, wie speziell für Geschäftsideen, ist hierbei ein guter Anfang. Weitere Anregungen und Beispiele finden sich bei verschiedenen Ideen, die bereits erfolgreich umgesetzt wurden. Auch der direkte Kontakt zu potenziellen Investor*innen, die möglicherweise andere Sichtweisen einbringen, kann ein entscheidender Faktor sein. Austausch mit solchen externen Partner*innen erweitert den Horizont und hilft oft, die eigenen Ideen weiter zu verfeinern.
Zusätzlich bieten sich gezielte Workshops oder Veranstaltungen an, insbesondere in den Gründungsphasen. Wer sich mit Gleichgesinnten austauscht, gemeinsam Probleme analysiert und erarbeitet, kann ebenfalls eine solide Basis finden. Die Wahl der passenden Ressourcen, ob Mentor*innen oder spezialisierte Plattformen für das Gründen, erweitert schließlich den Spielraum für Inspiration und wissensbasierte Entscheidungen. Mit der richtigen Kombination aus Strategie, Umfeld und persönlichem Engagement können Gründer*innen den Prozess der Ideenfindung erfolgreich meistern. Abschließend ist es wichtig, sich stets Raum für Reflexion und Weiterentwicklung zu geben, um langfristig erfolgreich zu sein.
Die größten Strategie-Fallen
Sie haben eine tolle Geschäftsidee und eine Strategie, wie Sie die Idee realisieren wollen. Doch nach kurzer Zeit stellen Sie fest: Die Idee ist gut – die Strategie aber nicht. Sie beschließen, das Strategiepferd zu wechseln. Dabei lauern viele Fallen, die sich vermeiden lassen.

Es gibt viele Gründe bzw. Notwendigkeiten für Strategiewechsel in der Gründungsphase: die wirtschaftliche Situation verändert sich oder das Kundenverhalten, oder Sie expandieren rasch. Für die meisten Gründer steht zu Beginn der Selbständigkeit das operative Geschäft im Fokus, sie müssen die gegenwärtigen Herausforderungen bewältigen.
Eine klare Unternehmensstrategie, geschweige denn strategische Überlegungen erfolgt bzw. erfolgen „zwischen Tür und Angel“, eher nebenbei und zufällig. Erst nachträglich geraten die langfristigen Zielsetzungen des jungen Unternehmens in den Blickpunkt. Erfolgt dann der Strategiewechsel, sollten Sie folgende Stolpersteine umschiffen.
1. Mangelnde Flexibilität
Sie sind nicht flexibel genug und „kleben“ an Ihren ersten strategischen Überlegungen fest. Die Leimrute Ihrer Ursprungsstrategie lässt Sie nicht mehr los. Eine Weisheit der Dakota-Indianer lautet: „Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steige ab.“ In aller Regel jedoch sagen Gründer: „Besorgen wir uns doch lieber eine stärkere Peitsche.“ Sie sollten den Mut aufbringen, Ihre bisherige Strategie unter die kritische Lupe zu legen und den Strategiewechsel ins Kalkül ziehen. Um sich von der Leimrute zu befreien, benötigen Sie strategischen Weitblick. Dieser lässt sich nicht erlernen oder herbeizitieren – gehen Sie mit einem strategieerfahrenen Partner Ihres Vertrauens in Klausur und legen Sie alles auf den Prüfstand. Verlassen Sie sich dabei nicht allein auf Ihr Bauchgefühl – nutzen Sie das Handwerkszeug der Strategieexperten.
2. Fehlendes belastbares Zahlenmaterial
Zu diesem Experten-Handwerkszeug gehören die Instrumente der Unternehmensanalyse. Überprüfen Sie die Chancen und Möglichkeiten sowie die Risiken und Gefahren Ihrer Geschäftsidee. Berücksichtigen Sie die Faktoren, auf die Sie keinen Einfluss haben, etwa wirtschaftspolitische Entwicklungen. Wichtig ist eine detaillierte Branchenanalyse: Welche Wettbewerber haben Sie, welche Schwächen der Konkurrenten können Sie nutzen, welche Abhängigkeiten etwa von Lieferanten sind zu beachten? Entscheidend ist die Kundenanalyse, hier hilft eine Kundenbefragung weiter: „Warum gehen Kunden zu einem Konkurrenzunternehmen und nicht zu mir?“ Der Zwang zum Strategiewechsel darf nicht zu Hektik und Aktionismus führen. Ein gelungener Strategiewechsel baut auf sauberem Zahlenmaterial zu Ihrem unternehmerischen Ist-Zustand auf. Diese Zahlen liefert auch die interne Unternehmensanalyse, bei der Sie Ihre Kernfähigkeiten, Kernschwächen und kritischen Erfolgsfaktoren überprüfen. Letztere gilt es in positive Erfolgsfaktoren zu verwandeln. Dies gelingt, indem Sie die Unternehmensprozesse in den Mittelpunkt rücken, die in der Wahrnehmung der Kunden eine dominante Rolle spielen.
3. Falscher Blickwinkel
Strategien scheitern deswegen so oft, weil die Entwickler der Strategie dabei primär die Brille des Unternehmens tragen. Beispiel Zielgruppenbestimmung: „Welche Kunden wollen wir?“, lautet die Frage, die zu einer egozentrischen Vertriebskultur führt. Notwendig ist ein Perspektivenwechsel, durch den die Frage: „Was kann unser Vertrieb für unsere Kunden tun?“ in den Mittelpunkt der strategischen Überlegungen rückt. Pointiert ausgedrückt: Setzen Sie beim Strategiewechsel und der Strategieentwicklung immer die Brille des Kunden auf!
4. Keine konkrete Vision
In der hektischen Gründungsphase fehlt es bei der Strategieorientierung oft an der Fundierung. Spätestens beim Strategiewechsel sollten Sie den Strategieprozess sauber aufsetzen. Dazu gehört die Visionsfindung: Strategische Planung ohne Vision ist weitgehend wertlos – und eine Vision ohne umsetzungsorientierte Strategie ebenso. Vision und Strategie gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Medaille. Nehmen Sie sich die Zeit, um den Strategiewechsel im Detail vorzubereiten, indem Sie zunächst einmal eine Vision formulieren. Mit der Szenario-Technik lassen sich realistische, weil aus der gegenwärtigen Situation und der Ist-Analyse abgeleitete, mögliche und alternative Zukunftsbilder entwickeln. Eine Vision hilft, die Black Box des Alltagsgeschäftes zu verlassen, sie befreit von den Fesseln des operativen Geschäfts, sie weitet den Blick und eröffnet das Panorama auf Ihr Unternehmen, wie es in fünf oder zehn Jahren ausschauen könnte. Also: Gründen Sie eine Visions- und Strategie-Task-Force mit Mitgliedern, die es wagen, über den operativen Tellerrand hinauszuschauen.
Skalieren im eCommerce
Jeder, der im Bereich eCommerce mit seinem Unternehmen dauerhaften Erfolg haben möchte, muss sich früher oder später die Frage stellen, wie das Ganze am besten skaliert werden soll. Hierfür bietet sich eine Vorgehensweise an, die planvoll und in mehreren Schritten geschieht. Wie das funktioniert.

Selbständige Abwicklung beenden und bestehende Kunden nutzen
Ein eCommerce-Unternehmen hochzuskalieren und dieses auch international nach vorne zu bringen, ist kein leichtes Unterfangen. Glücklich schätzen können sich da diejenigen Personen, die einen genauen Plan vor Augen haben. Andere Länder bedeuten nämlich nicht nur andere Vertriebswege, sondern auch anders gelagerte Bedürfnisse der Kunden.
Will man so richtig durchstarten, sollten die beiden folgenden Adaptierungen zuallererst angestrebt werden:
- Das selbständige Abwickeln der Bestellungen muss so weit wie möglich aufgegeben werden.
- Das Verhältnis zu bestehenden Kunden muss bestmöglich genutzt werden.
Wer also selbst zur Post fährt und sich um Verpackung und Versand als Geschäftsführer kümmert, der stößt zwangsläufig schnell an seine Grenzen. Besser ist es daher an dieser Stelle, zum Beispiel Dropshipping zu nutzen. Dabei arbeitet der Unternehmer eng mit einem Lieferunternehmen zusammen, welches sich darum kümmert, dass die Produkte so schnell wie möglich zum Kunden gelangen. Punkt zwei zielt hingegen auf geschicktes Marketing ab. Bestehende Kunden können für effektive Marketingketten benutzt werden. Das gilt vor allem dann, wenn sich unter Ihnen gegebenenfalls bekannte Social Media-Influencer befinden.
Prozesse automatisieren und Vorteile des Outsourcings verwenden
Im nächsten Schritt geht es darum, das eigene Business so weit wie möglich zu automatisieren. Dies kennt im Prinzip auch jeder von seinen eigenen Online-Bestellungen bei großen Versandhäusern. Hier läuft alles automatisiert ab, denn das spart wertvolle Zeit. Beispiele dafür, was man im Einzelnen automatisieren kann:
- Chat-Funktionen auf der eigenen Webseite
- Bestandteile des E-Mail-Marketings
- Die Bestellbestätigung
- Die Versandbestätigung
Noch einen Schritt weiter geht die automatisierte Anpassung der Preise. Das bietet sich vor allem dann an, wenn etwa während der Black Week entsprechende Aktionen geplant sind oder zum Jahresende hin noch ein wenig Platz in den eigenen Lagern geschaffen werden soll. Zusammen mit dem Outsourcing, das an kompetente Partner stattfinden sollte, ergibt sich eine massive Zeitersparnis ohne allzu viele Zusatzkosten.
Beispiel: expondo expandiert nach Polen

Wie man erfolgreich expandiert und das eigene Geschäft passend skaliert, wird mit Blick auf das Unternehmen expondo deutlich. Expondo, Anbieter von professionellem Equipment für Gasztronomie und Industrie, wurde von Piotr Stach und Waldemar Moss gegründet, welche sich vor allem mit der Bewältigung der Schwierigkeiten bei der Internationalisierung eingehend beschäftigt haben. Sie sind der Meinung, dass es massive Unterschiede bei den Käuferstrukturen in unterschiedlichen Ländern gibt. Vergliche man beispielsweise deutsche und polnische Kunden, so ergäben sich mitunter die folgenden Unterschiede: Zum einen seien polnische Käufer im Gastronomie-Bereich sehr preisempfindlich, und zum anderen änderten sie bei günstigeren Preisen schnell den Ort des Kaufs.
Dazu Piotr Stach: „Wir haben in Deutschland angefangen, einem Markt, der in der EU zusammen mit Großbritannien führend im Bereich eCommerce ist. Was wir dort gelernt haben, haben wir in Polen angewendet.“ Eine wichtige Sache in Polen sei zum Beispiel die Lieferung per Nachnahme. Außerdem benötigten polnische Kunden mehr Hilfe am Telefon und lägen viel Wert auf die Vertrauensbildung in einem Shop vor Ort. In Polen werde darüber hinaus seltener von Mitbewerbern abgemahnt, als das in Deutschland der Fall sei. Steuerprüfungen fänden in Deutschland ebenfalls häufiger statt. Jacek Powalka, der Head of Marketing bei expondo, führte zu dem Thema noch aus: „Die Ausbildungskosten und Löhne sind in Polen niedriger. Es gibt bei den Käufern in Polen und Deutschland auch kulturelle Unterschiede. Darüber hinaus finden wir in Polen leichter Spezialisten, die für uns arbeiten wollen."
Strategiearbeit in Start-ups
Damit dein Start-up kein „Go-down“ wird. Worauf du bei deiner Strategiearbeit achten musst.

Start-ups sind innovativ, jung, experimentierfreudig und risikobereit. Das braucht es, um erfolgreich zu sein – zum einen. Zum anderen braucht es strukturiertes Vorgehen und Organisation. Start-ups stehen jedoch unter dem Druck, mit begrenzten Ressourcen schnell wachsen zu müssen. Die strategische Arbeit fällt dabei schnell hinten runter. Viele Jungunternehmen, die weitgehend blind starten, landen dabei schnell im Sand oder gar im Desaster. Wo liegen die größten Hindernisse und wo führt der Weg zu nachhaltigem Erfolg?
Bürokratie, unausgereifte Geschäftsmodelle mit nebligen Vorstellungen über künftige Kunden, unausgereifte Produkte und überhöhte Umsatzerwartungen sind häufig die Ursachen, dass Unternehmensgründungen schon bei der Planung scheitern oder Start-ups bereits in der Frühphase lautlos untergehen. Der DIHK-Gründerreport 2019 titelte aufgrund dessen: "Trotz regen Gründungsinteresses – der Funke zündet nicht".
367.000 Existenzgründungen zählte das Institut für Mittelstandsforschung (IfM) letztes Jahr. Mehr als die Hälfte der Unternehmen geben jedoch laut Statistik innerhalb der ersten drei bis fünf Jahre nach ihrer Gründung erschöpft auf. Die Gründe für das Scheitern mögen ganz unterschiedlich sein – dennoch gibt es durchaus Gemeinsamkeiten. Das konnte nicht nur ich als langjähriger strategischer Berater beobachten, sondern davon ist auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer überzeugt.
„Ich habe eine tolle Idee“, reicht nicht
So macht fast die Hälfte der Gründer den Fehler, vor lauter Euphorie über die eigene Idee den Kunden zu vergessen. Braucht er das Produkt überhaupt und wenn ja, wer ist „der Kunde“? Wie groß ist die Zielgruppe und wo ist sie? Was unterscheidet das Produkt von der Konkurrenz? „Ich habe eine tolle Idee“, reicht nicht.
Wiederum knapp die Hälfte ist nach DHIK-Angaben nicht in der Lage, ihre Zielgruppe genau einzugrenzen, über ein Drittel der Gründer arbeiten mit einem zu kurzen Planungshorizont. Weitere Fehler in der Strategiearbeit sind Fehlinvestitionen, nicht kostendeckende Preise und ein riskantes Wachstum. Viele Start-ups verfolgen keine konsistente Strategie.
Schon mal Schach gespielt?
Der Erfolg deines Unternehmens hängt jedoch stark von deinen strategischen Entscheidungen ab. Schon mal Schach gespielt? Wie beim Schach ist es nicht genug, das Ziel zu benennen. „Ich will gewinnen“, braucht strategisches Denken.
Genauso wie beim Schachspiel nie das Ziel (den König zu schlagen) aus den Augen verloren wird, sollte der Unternehmer seine Vision stets im Blick behalten. Dabei ist ein vollständiger Überblick über die strategischen Optionen notwendig, um sich für den besten Schritt entscheiden zu können. Das gilt für den Schachspieler genauso wie für den Gründer bzw. Manager. Damit du nicht plötzlich überrascht im Schachmatt sitzt, solltest du deinen nächsten Zug also immer sorgfältig planen.
Merkmale erfolgreicher Strategiearbeit
Strategien gestalten die Zukunft deines Unternehmens. Die eine Strategie, die dich erfolgreich gründen lässt, gibt es nicht. Unternehmen sind so individuell wie die Menschen, die sie gründen. Aber es gibt typische Fehler, die für ein Scheitern verantwortlich sind und es gibt Merkmale erfolgreicher Strategiearbeit.
Deine Strategiearbeit sollte:
- die Vision deines Unternehmens in den Vordergrund stellen. Produkte und Strategie können sich häufig ändern. Die Vision deines Unternehmens jedoch nicht. Sie bildet das Entwicklungsfundament. Daher sollte die Frage nach der angestrebten einzigartigen strategischen Position deines Start-ups gründlich durchdacht und klar beantwortet sein;
- ambidextriefähig sein. Ambidextrie klingt zwar eher nach einer Krankheit, steht aber für eine Fähigkeit, die nur etwa ein Prozent der Weltbevölkerung besitzt. Jemand mit Ambidextrie, ist weder links- noch rechts-, sondern beidhändig. In der Wirtschaft soll der Begriff Ambidextrie darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass Unternehmen sowohl Exploration (Innovation / Erkundung von Neuem) als auch Exploitation (Effizienz / Ausnutzung von Bestehendem) integrieren. Diese unterschiedlichen Modi solltest du in deiner Strategiearbeit zulassen;
- in kurzen Zeitabschnitten (kurzfristige Strategieschleifen) stattfinden. Nur so kannst du agil reagieren und die Strategie ggf. an sich verändernde Umstände anpassen;
- sich auf Business Model Innovation konzentrieren. Du solltest dein Geschäftsmodell beständig infrage stellen und verbessern. Negativbeispiele zahlreicher global agierender Unternehmen wie AirBerlin, Kodak oder Nokia zeigen, wie Marktanteile an Konkurrenten mit innovativeren Geschäftsmodellen abgegeben werden mussten. Die Fähigkeit, ein innovatives Geschäftsmodell zu entwickeln und das bestehende Modell an die Umstände anzupassen, ist der Schlüssel für die erfolgreiche nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit;
- kontinuierlich Aufmerksamkeit erhalten. Ein jährliches Strategiemeeting reicht in der sich schnell wandelnden Geschäftswelt nicht aus – Start-ups sollten daher routinemäßig in Meetings und Gesprächen immer wieder ihre Strategie überprüfen;
- in Geschichten erzählt werden können. Eine Strategie erarbeitet zu haben, ist das eine, das andere ist, sie „rüberzubringen“, um sie umzusetzen. „Rüber“ z. B. zu den Investoren (wenn Geld benötigt wird) und vor allem zu den Mitarbeitern. Das funktioniert nicht mit Power Point, sondern über Storytelling. Mit Geschichten, die mitreißen, überzeugen und involvieren;
- die für die Strategiearbeit nötigen Tools kontinuierlich nutzen. Als Gründer brauchst du das richtige strategische Gespür, das notwendige Wissen und die passenden methodischen Werkzeuge für deine Strategiearbeit.
Zu allen Punkten, die dich verunsichern, solltest du dir Wissen einholen oder dich beraten lassen. Mehr als neunzig Prozent der Existenzgründer starten ohne jegliche Beratung in die Selbständigkeit – „und tappt in typische Fallen“, heißt es im „Liquidationsreport Existenzgründung 2019“ des Instituts für Unternehmenserfolg. Unternehmen, die eine Beratungsleistung in Anspruch genommen haben, sind zu 80 Prozent erfolgreich. Je strategischer du vorgehst, desto sicherer wird dein Handeln – und desto mehr Spaß macht dir die Entwicklung deines Unternehmens!
Der Autor Claudio Catrini ist strategischer Berater und einer der führenden Verhandlungs- und Verkaufsexperten innerhalb der D-A-CH-Region.
5 Tipps, wie Nachhaltigkeit im E-Commerce gelingt
So baust du dir mit ressourcenschonenden und sozial verantwortungsbewussten Alternativen ein wirklich nachhaltiges E-Commerce-Business auf.

Schaut man auf die marktbeherrschenden E-Commerce-Unternehmen, scheint eine Verbindung von wirtschaftlich tragfähigem Online-Shopping und ernstgemeinter Nachhaltigkeit kaum möglich. Mit der Regenbogenkreis GmbH und unserem sorgfältig zusammengestellten Produktsortiment beweisen wir tagtäglich das Gegenteil. Fünf Aspekte solltest du unserer Erfahrung nach genau im Blick behalten, um ebenfalls ein wirklich nachhaltiges E-Commerce-Business betreiben zu können.
Erfolgreiches E-Commerce wird nicht selten mit rein gewinnorientiertem, ökologisch ignorantem und sozial unverträglichem Anbieten und Versenden von kurzlebigen, möglichst billigen Artikeln verbunden. Diese werden dann oft unter unerträglichen Bedingungen produziert und mit umweltschädlichen Containerriesen um die halbe Welt geschifft, um dann bereits innerhalb kürzester Zeit wieder in den Mülleimer zu wandern. Nichtsdestotrotz lässt sich eine nachhaltige Lebens- und Geschäftsphilosophie auch in der Online-Shopping-Branche verwirklichen. Mittlerweile findet man in den allermeisten Fällen nachhaltige, ressourcenschonende und sozial verantwortungsbewusste Alternativen zu den branchenüblichen Standards. Worauf sollten Sie also achten, wenn Sie ein nachhaltiges und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähiges E-Commerce-Unternehmen gründen und betreiben wollen?
1. Ökostrom – Server und Rechner für Firma, Shop und Büros mit Ökostrom versorgen
Wer einen Web-Shop, einen Unternehmensstandort mit Büro-, Lager- und Versandräumen unterhält, verbraucht natürlich auch elektrische Energie. Diese sollte daher komplett von Ökostrom-Anbietern, wie Greenpeace Energy oder Lichtblick stammen, die ihre Kontingente nachweislich aus regenerativen Quellen beziehen – und eben nicht nur über eine grüne Fassade verfügen und sich gleichzeitig an Atom- und Kohlestrom-Pools bedienen. Der Regenbogenkreis legt hier sehr strenge Kriterien an, kann dann aber auch sicherstellen, dass "Green-Washer" bei der Energieversorgung des Unternehmens außen vor bleiben.
2. Geschäftskonto bei einer Ökobank
Typischerweise läuft der gesamte Zahlungsverkehr eines E-Commerce-Unternehmens vollständig digital ab, entsprechend eng und vertrauensvoll arbeitet man als Betreiber eines Online-Shops mit seiner Hausbank zusammen. Verfolgt man eine klar nachhaltig orientierte und sozial verantwortungsbewusste Lebens- und Firmenphilosophie, verbietet sich die Kooperation mit einem Institut, das direkt oder indirekt über Partner bzw. Beteiligungen Chemie- oder Rüstungsunternehmen finanziert. Weiterhin gelten auch Spekulationsgeschäfte als klares KO-Kriterium. Arbeitet man mit entsprechend aufgestellten Öko- oder Gemeinwohl-Banken, wie der GLS Gemeinschaftsbank oder der Ethikbank, zusammen, entstehen Synergieeffekte die man sich zu nutze machen kann. E-Commerce-Unternehmen die es mit der Nachhaltigkeit ernst meinen, können die Kooperation als weiteres Siegel ihrer Arbeit und Mission nutzen.
3. Ausschließliche Verwendung von Recyclingpapier
Leider ist es auch in einem modernen und technisch gut aufgestellten E-Commerce-Unternehmen noch immer nicht möglich, komplett auf Papier zu verzichten. Das fängt bei Lieferscheinen, Adressaufklebern und in analoger Form vorzuhaltenden Formularen und Dokumenten an und hört bei Toilettenpapier noch lange nicht auf. Wir bemühen uns zwar nach Kräften, kaum noch Papier zu verwenden, achten dann aber auch darauf, dass es sich ausschließlich um hundertprozentige Recyclingqualität handelt. Es werden leider immer noch viel zu viele Wälder für die Papierproduktion abgeholzt – diesem Raubbau an der grünen Lunge unseres Planeten muss dringend Einhalt geboten werden. Regenbogenkreis wurde übrigens ursprünglich gegründet, um mit dem Verkauf von Regenwaldprodukten aus Wildsammlung zum Schutz dieser so wichtigen Waldflächen beizutragen – im Laufe der Zeit haben wir dann unser Sortiment Schritt für Schritt erweitert, aber den Fokus nicht aus den Augen verloren.
4. Verwendung nachhaltiger Verpackungslösungen
Damit unsere Kunden unsere hochwertigen Produkte auch im einwandfreien Zustand erhalten können, müssen diese natürlich sicher und umfassend geschützt verpackt werden. Wer sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, dann aber rohölbasierte Plastikbehältnisse verwendet und die Leerräume der Kartonagen mit Styroporflocken flutet, verspielt komplett seine Glaubwürdigkeit. Wir setzen bei der Regenbogenkreis GmbH daher auf Recyclingkartons und polstern die Leerräume mit biologisch abbaubaren Verpackungs-Chips aus. Auf diese Weise sorgen wir nicht nur für eine widerstandsfähige und sichere Verpackung, die auch eine ruppigere Behandlung überlebt, sondern schonen gleichzeitig auch die begrenzten Ressourcen unseres Planeten. Die Produkte selbst befinden sich in wiederverwendbaren Violettgläsern (die wir übrigens auch unbestückt und "pur" anbieten) oder in Dosen aus Green PE, das aus Zuckerrohr gewonnen wurde.
5. Umsatzanteil als Spende der Erde zurückgeben
Seien wir ehrlich – selbst das ressourcenschonendste Unternehmen muss Umsatz erzielen, um Mitarbeiter entlohnen, Miete zahlen und Rücklagen bilden zu können. Ansonsten tendiert der Grad der Nachhaltigkeit gegen null, da eben keine ökologisch relevante Wirkung erzielt werden kann. Nichtsdestotrotz sollte aber auch ein gewisser Anteil des erzielten Umsatzes wieder direkt zurückfließen, um der Erde und der Natur unmittelbar zugute zu kommen. Die Auswahl passender und wirklich sinnvoller Projekte und Initiativen mag einen auf den ersten Blick erschlagen, dementsprechend sollte man sich von Beginn an bei der Recherche auf Aspekte konzentrieren, die einem besonders wichtig sind. Wir engagieren uns zum Beispiel bei der Tropenwaldstiftung Oroverde und kaufen kontinuierlich Regenwald auf, der dann nicht mehr rein gewinnorientierten Interessen zum Opfer fällt. Auf diese Weise konnten wir bereits mehr als 94 Millionen Quadratmeter Regenwald nachhaltig schützen.
Bei aller Fokussierung auf einem möglichst hohen Grad an Nachhaltigkeit sollte man aber auch keinen perfektionistischen Tunnelblick entwickeln. Oftmals bedarf es etlicher Schritte, die gewünschte Nachhaltigkeit zu erreichen – was aber nicht davon abhalten sollte, überhaupt den ersten Schritt zu gehen.
Der Autor Matthias Langwasser ist Gründer und Geschäftsführer des ganzheitlichen Unternehmens Regenbogenkreis, dessen Kerngeschäft ein veganer Online-Shop ist. Regenbogenkreis wurde 2011 gegründet.
Nichts zu verzollen?
Zollberatung für Start-ups? Warum das? Oder: Was dir ein Steuerberater dazu meist nicht sagen kann.

Wer Handel über die Grenzen der EU hinaus betreibt oder Waren importiert, die zwar innerhalb der EU gefertigt wurden, aber dennoch den außenwirtschaftlich relevanten deutschen Bestimmungen unterliegen, sollte den Rat eines Zoll- und Außenwirtschaftsrechtsexperten einholen. Tust du dies nicht und handelst stattdessen nach bestem Wissen und Gewissen, schützt dich das nicht vor Nachzahlungen, Ordnungswidrigkeiten und Strafen.
Als Unternehmer wirst du es früher oder später auf jeden Fall mit Zollämtern und anderen Kontrollbehörden zu tun bekommen. Im ersten Moment scheint die Beratung durch einen Zollexperten teuer zu sein und passt eine solche nicht in das meist knappe Start-up-Budget. „Mir passiert schon nichts.“ Mit dieser Floskel versuchen viele, sich zu beruhigen. Wir zeigen dir stattdessen lieber einige teure Stolperfallen auf.
Was, woher, wohin und zu welchem Preis?
Führst du Waren nach Deutschland ein, die außerhalb der EU gefertigt oder abgebaut wurden, müssen diese mit einer Anmeldung beim Zoll bekannt gegeben werden. Waren, die in der EU gefertigt oder abgebaut wurden, müssen ebenfalls dem Zoll gemeldet werden, wenn du diese in Drittländer exportierst. Mit den Angaben in deiner Zollanmeldung meldest du den zuständigen Behörden, was du woher beziehst und was es gekostet hat, bzw. was du wohin versendest und was es kostet. Auch wenn du die Anmeldung beim Zoll einem Dienstleister überlässt, z.B. einer Spedition oder einem Paketdienstleister, bist du allein für den Inhalt verantwortlich und haftest für fehlerhafte Zollanmeldungen. Die Punkte „Wohin/Woher?“ und „Zu welchem Preis?“ kannst du in der Regel benennen. Für den Punkt „Was?“ stellt dir der deutsche Zoll den elektronischer Zolltarif (EZT) zur Verfügung. Mithilfe des EZT können deine Waren in den europäischen Zolltarif eingereiht werden.
Fehlerhafte Einreihung in den Zolltarif
Selbst mithilfe des EZT ist es für Laien schwierig, die richtige Zolltarifnummer zu benennen. Importierst du z.B. Drohnen, können diese als Spielzeug oder als zivile Luftfahrzeuge deklariert werden. Der Einfuhrzoll für Spielzeugdrohnen liegt derzeit bei 4,7 Prozent. Für Drohnen der Kategorie zivile Luftfahrzeuge liegt er hingegen bei null Prozent Einfuhrzoll. Sind deine Drohnen also für eine bestimmte Aufgabe gedacht, z.B. zur Beförderung von Lasten, oder überschreiten sie eine gewisse Leistung, handelt es sich nicht mehr um Spielzeug, dessen Hauptmerkmale die kindliche Unterhaltung ist, sondern um ein ziviles Luftfahrzeug. Importierst du also jeden Monat zehn Drohnen für je 1000 Euro, kannst du dabei 470 Euro sparen. Viele Dienstleister kennen diese Unterscheidung gar nicht. Deklarierst du deine Drohne jedoch als ziviles Luftfahrzeug und nicht als Spielzeug, obwohl es sich rechtlich betrachtet um Spielzeug handelt, musst du den so gesparten Einfuhrzoll nachzahlen. Weitere Konsequenzen können ein Ordnungswidrigkeiten- oder sogar Strafverfahren sein.
Besondere Bestimmungen
Nur die richtige Einreihung in den Zolltarif reicht für einen reibungslosen Im- und Export leider nicht aus. Einige Waren unterliegen besonderen Bestimmungen. Beispielhaft dafür sind Waren aus Papier: Um einen rechtlich einwandfreien Import zu gewährleisten, benötigst du im Vorfeld ein Zertifikat, welches bestätigt, dass für die Herstellung deiner Waren keine tropischen Hölzer genutzt wurden. Auch beim Export begegnen dir besondere Bestimmungen, die du einhalten musst. Verkaufst du beispielsweise technische Bauteile für Fahrzeuge oder Maschinen, unterliegt deine Ware der sogenannten Dual-Use-Verordnung. Für diese Warengruppe benötigst du zwingend eine Ausfuhrgenehmigung. Das ist immer dann der Fall, wenn deine Komponenten sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke genutzt werden könnten. Um deine Ausfuhr also rechtssicher versenden zu können, musst du vorher prüfen, ob das Bestimmungsland ein sogenanntes Embargoland und dein Kunde Mitglied in einer terroristischen Vereinigung ist. Um diese Prüfung vornehmen zu können, gibt es spezielle Softwareprogramme, die von den deutschen Behörden als Prüfsoftware anerkannt sind.
Nationale Besonderheiten
In keinem anderen EU-Land, außer in Deutschland und Polen, wird eine Steuer auf Kaffee oder kaffeehaltige Produkte erhoben. Importierst du Waren, die Kaffee enthalten, musst du dies stets vor dem Import anmelden. Dies gilt auch, wenn du dieses Produkt innerhalb der EU beziehst. Verkaufst du deine Ware mit deutschem Ursprung, musst du dabei ebenfalls ein paar Dinge beachten. Denn auch mit Bestandteilen aus Drittländern kann deine Ware noch deutschen Ursprungs sein, sofern der Bearbeitungs- bzw. Veredelungsbestandteil 51 Prozent des Warenwerts ausmacht.
Elektronische Daten
Auch elektronische Daten unterliegen den Außenwirtschaftsbestimmungen des Im- und Exports. Beziehst du also deine Website aus Indien oder verkaufst deine Software nach Amerika, ist eine Anmeldung beim Zoll Pflicht.
Kosten sparen leicht gemacht
Durch sogenannte Präferenzabkommen sparst du bares Geld. Bei der Einfuhr von Kleidung zahlst du in der Regel 12 Prozent Einfuhrzoll. Beziehst du deine Ware jedoch in Pakistan, sinkt der Zollsatz auf null Prozent, da mit Pakistan ein Präferenzabkommen geschlossen wurde. Auch wenn der Preis pro Stück in einem Präferenzland etwas höher ist, lohnt sich das Geschäft aufgrund niedrigerer Zollabgaben trotzdem. Der größte Posten in den Unternehmen ist zumeist das Personal. Durch verschiedene Bewilligungen und die Zertifizierung, wie bspw. zum zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO), können die internen Abläufe in deinem Unternehmen optimiert und Arbeitszeit eingespart werden. Die Anträge dafür können kostenlos bei dem für dich zuständigen Hauptzollamt eingereicht werden.
Exportkontrolle
Exportierst du deine Waren in das Nicht-EU-Ausland, z.B. nach China, Kanada oder in die USA, bist du dazu verpflichtet, für jede Sendung eine Exportkontrolle durchzuführen. Darunter fällt die Prüfung von Sanktions- und Embargolisten sowie das Checken, ob deine Waren der Dual-Use-Verordnung unterliegt. Handelst du hier widerrechtlich, sprich, führst du keine Exportkontrolle durch, wird nach einer Zollprüfung ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen dich eröffnet. Wurde dir mehrfach nachgewiesen, keine Exportkontrolle durchgeführt zu haben, musst du sogar mit einem Strafverfahren rechnen.
Paketdienstleister
Viele Paketdienstleister übernehmen für dich die Zollanmeldung. Hast du ihnen keine Zolltarifnummern für deine Waren aufgegeben, werden diese oft willkürlich aus dem Pool der Warentarifnummern ausgewählt. Einige Paketdienstleister neigen dazu, die Zolltarifnummern mit den geringsten Zollabgaben auszuwählen. Erhältst du nach einigen Jahren eine Prüfungsanordnung des Hauptzollamts, werden diese Fehler garantiert aufgedeckt. Neben einem Ordnungswidrigkeitsverfahren wirst du dann dazu verpflichtet, alle Vorgänge innerhalb des Prüfzeitraums zu berichtigen und die korrekten Zollabgaben nachzuzahlen. Die Kosten dafür können rasch auf vier- bis sechsstellige Beträge wachsen.
Fazit
Der Welthandel unterliegt gewissen Regularien und Vorschriften. Ein junges Unternehmen kann diese natürlich nicht umfassend kennen. Um rechtssicher zu agieren, benötigst du für einige Bereiche Experten, die dich und dein Unternehmen unterstützen. Klar ist: Für den Bereich Zoll- und Außenwirtschaft kann dir ein spezialisierter Zollberater mehr und vor allem rechtssichere Hilfestellung bieten als ein Steuer- oder Unternehmensberater.
Der Autor Michael Rosinski ist Speditionskaufmann, Zollberater und Gründer des Außenwirtschaftsbüro Rosinski KG in Hamburg.