Aktuelle Events
Vertragsrecht: Das gehört in einen Arbeitsvertrag für festangestellte Mitarbeiter
So sichern Sie sich als Arbeitgeber rechtlich bestmöglich ab
Autor: J.-Elishewa Patterson-BaysalDarauf sollten Sie achten, wenn Sie als Selbständiger Ihren ersten festen Mitarbeiter unter Vertrag nehmen.
Die meisten Gründer starten ihr Business als Solist oder als kleines Team. Oft werden zunächst freie Mitarbeiter projektbezogen und zeitlich begrenzt engagiert. Dies hilft, die Strukturen zu Beginn der Selbständigkeit schlank und kalkulierbar zu halten.
Wenn es dann aber um die Frage des ersten festangestellten Mitarbeiters geht, sollten Sie bei der Frage der Gestaltung des Arbeitsvertrages vorab gut informiert sein. Denn mit Muster-Vertragsvorlagen stoßen Sie hier, ohne es zu wissen, schnell an die Grenzen dessen, was vom ersten Tag an arbeitsrechtlich wichtig und relevant ist.
Musterverträge mit Vorsicht genießen
Vor dem Abschluss eines Arbeitsvertrages sollte geprüft werden, ob der verwendete Arbeitsvertrag ausschließlich zulässige Klauseln enthält und vor allem ob der erhebliche Gestaltungsspielraum ausgeschöpft wurde. Der Abschluss eines Arbeitsvertrages ist zwar formfrei und somit auch in mündlicher Form wirksam, der Arbeitgeber ist jedoch verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Essentialen des Arbeitsvertrages in schriftlicher Form mitzuteilen. So zumindest verlangt es das sogenannte Nachweisgesetz. Ein Verstoß gegen diese Vorgabe führt nicht zur Unwirksamkeit des Vertrages, sondern gegebenenfalls zur Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers. Interessant wird die Gestaltung des Arbeitsvertrages jedoch erst, wenn die Sache innovativ angegangen wird und Klauseln kreativ gestaltet werden. Wenig empfehlenswert ist daher die Verwendung eines Mustervertrages.
Als Arbeitgeber sollten Sie sich grundsätzlich Gedanken über folgende Punkte machen:
Überstundenvergütung
Hier ist zu beachten, dass eine pauschale Abgeltung der Überstunden durch das monatliche Entgelt in der Regel als unzulässig angesehen wird. Möglich ist eine Mitabgeltung der Überstunden aber trotzdem. Denkbar und häufig praktiziert ist z.B. eine Deckelung auf 20 Überstunden im Monat.
Gratifikationen
Hier ist zu beachten, dass die Anforderungen an die sog. Freiwilligkeits- bzw. Widerrufsvorbehalte relativ hoch sind und das Bundesarbeitsgericht jüngst entschieden hat, dass die Formulierung „freiwillig und jederzeit widerruflich“ widersprüchlich und damit unwirksam ist. Alternativ und in der Praxis bewährt haben sich hier klare Regelungen zu Boni, die weder freiwillig noch widerruflich sind, dafür aber betriebswirtschaftlich gut kalkuliert. So kann z.B. eine Bonusregelung, die sich am Betriebsergebnis orientiert, die Mitarbeiter motivieren, ohne dabei für den Arbeitgeber wirtschaftlich gefährlich zu werden. Wenn das Ziel nicht erreicht wird, gibt es einfach keinen Bonus.
Das gehört in den Arbeitsvertrag
Folgende Punkte müssen auf jeden Fall schriftlich im Arbeitsvertrag festgelegt sein:
- Name und Anschrift der Vertragsparteien.
- Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses.
- Bei befristeten Arbeitsverhältnissen die vorhersehbare Dauer.
- Der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis, dass er an verschiedenen Orten beschäftigt werden kann.
- Eine kurze Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit.
- Die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit.
- Die vereinbarte Arbeitszeit, die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs sowie die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses.
- Ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind.
Seite 1 von 2
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung
Recht für Gründer*innen: Wie das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung Unternehmen neue Perspektiven in schwierigen Zeiten aufzeigen kann.

Start-ups stehen in einer immer komplexeren und dynamischeren Wirtschaftswelt vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Globalisierte Märkte, technologische Umwälzungen, volatile Lieferketten und unerwartete Krisen erhöhen den Druck, flexibel zu agieren und Strategien kontinuierlich anzupassen. Gerät ein Jungunternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten, erscheint der Weg in die Insolvenz oft unausweichlich. Dabei wird dieser Begriff häufig mit dem Ende assoziiert – Betriebsschließungen, Entlassungen und der Verlust von Jahren harter Arbeit.
Die Insolvenz in Eigenverwaltung eröffnet eine Alternative, die statt Stillstand neue Möglichkeiten offeriert. Dieses Verfahren schafft nicht nur den Raum für eine aktive Neuausrichtung, sondern bietet die Chance, Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten. Im Unterschied zur klassischen Regelinsolvenz, bei der ein(e) externe(r) Insolvenzverwalter*in die vollständige Kontrolle übernimmt, bleibt die operative Leitung bei Schutzschirm und Eigenverwaltung in den Händen der Geschäftsführung. In diesem Zuge gewährleistet ein(e) Sachverwalter*in die gerichtliche Kontrolle zum Schutz der Interessen der Gläubiger*innen und zur Sicherstellung der Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben. Dieses Modell vereint unternehmerische Handlungsfreiheit mit gerichtlicher Aufsicht und ermöglicht eine individuell angepasste Sanierung, bei der nicht die Zerschlagung, sondern die langfristige Stabilisierung und Wettbewerbsfähigkeit des Start-ups im Fokus stehen.
Präzise Vorbereitung als Schlüssel
Die Insolvenz in Eigenverwaltung setzt eine sorgfältige Planung und Vorbereitung voraus. Bereits bei der Antragstellung braucht es ein schlüssiges Konzept, das die Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten klar analysiert und realistische Lösungsansätze präsentiert. Eines der zentralen Elemente ist dabei der Sanierungsplan. Er legt dar, wie der Betrieb finanzielle Stabilität erreichen, die Liquidität sichern und die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen kann. Neben Kostensenkungen und der Optimierung von Prozessen umfasst der Plan häufig auch Maßnahmen wie die Neuausrichtung des Geschäftsmodells oder die Fokussierung auf profitablere Kernbereiche. Ergibt eine gerichtliche Prüfung, dass das Management in der Lage ist, den Betrieb erfolgreich zu führen, und erscheint der Sanierungsplan glaubwürdig und realistisch, erfolgt eine Genehmigung des Verfahrens. Unternehmen, die hier frühzeitig eine Restrukturierungsberatung hinzuziehen, erhöhen ihre Erfolgsaussichten deutlich. Denn das Expert*innenwissen trägt stark dazu bei, mögliche Schwächen des Konzepts zu identifizieren und die Anforderungen des Insolvenzgerichts genau zu erfüllen.
In der Krise aktiv gestalten, statt aufzugeben
Nach der Anmeldung des Insolvenzverfahrens tritt der sogenannte Schutzschirm beziehungsweise die vorläufige Eigenverwaltung in Kraft, die das Start-up vor Zwangsvollstreckung durch Gläubiger*innen schützt. Mit diesem rechtlichen Rahmen verschafft sich die Geschäftsführung den notwendigen Spielraum, um geplante Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen. In dieser Phase steht nicht nur die kurzfristige Sicherung der Liquidität im Vordergrund, sondern auch die strategische Neuausrichtung des Unternehmens. Zudem schafft der Schutzschirm eine konstruktive Verhandlungsbasis mit den Gläubiger*innen.
Langjährige Partner*innen schätzen es eher, wenn die Gründer*innen aktiv an einer Lösung arbeiten, statt passiv auf eine Regelinsolvenz zuzusteuern. Damit stärken sie das Vertrauen und erleichtern Verhandlungen über Stundungen, Forderungsschnitte oder andere Maßnahmen, die für den Sanierungsprozess notwendig sind.
Individuell statt standardisiert
Die Insolvenz in Eigenverwaltung erlaubt es Gründer*innen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und diese auf ihre spezifischen Unternehmensbedürfnisse zuzuschneiden. Im Gegensatz zur klassischen Insolvenz, bei der standardisierte Prozesse oft wenig Raum für individuelle Anpassungen lassen, eröffnen Schutzschirmverfahren und Eigenverwaltung die Möglichkeit, flexibel auf die Anforderungen des Markts und die internen Gegebenheiten zu reagieren. Zu den typischen Maßnahmen zählen beispielsweise die Reduktion von Fixkosten, die Umstrukturierung von Verbindlichkeiten und die Optimierung betrieblicher Abläufe. Häufig entscheiden sich Unternehmen auch dafür, unrentable Geschäftsbereiche aufzugeben und stattdessen ihre Ressourcen auf profitable Kernsegmente zu konzentrieren. Gleichzeitig bietet das Verfahren Raum für Innovationen und Investitionen, die langfristige Wachstumschancen eröffnen. Digitalisierung, neue Technologien und die Entwicklung zukunftsorientierter Produkte und Dienstleistungen spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Positive Effekte auf Unternehmenskultur und Motivation
Die aktive Rolle der Geschäftsführung wirkt sich nicht nur auf den Restrukturierungsprozess aus, sondern auch auf die Unternehmenskultur. Mitarbeitende erleben, dass das Management Verantwortung übernimmt und entschlossen handelt, um die Krise zu bewältigen. Dies stärkt nicht nur das Vertrauen in die Gründer*innen, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft. Unsicherheiten, die in Krisensituationen häufig zu einem Rückgang der Motivation führen, lassen sich durch eine transparente Kommunikation und sichtbare Fortschritte deutlich reduzieren. Kund*innen und Lieferant*innen schätzen die Kontinuität, die durch diese Verfahren gewährleistet bleibt. Im Gegensatz zur Regelinsolvenz, bei der externe Verwalter*innen oft wenig Kenntnis über bestehende Geschäftsbeziehungen haben, bleiben in Schutzschirm und Eigenverwaltung die direkten Ansprechpartner*innen erhalten. Dies sichert den Erhalt wichtiger Kooperationen für die Zukunft.
Langfristig stabil und wettbewerbsfähig
Neben der Stabilisierung der finanziellen Lage eröffnen Schutzschirm und Eigenverwaltung strategische Chancen, die weit über die Bewältigung der akuten Krise hinausreichen. Viele nutzen diese Phase beispielsweise, um ihre Marktposition neu zu bewerten, ungenutzte Potenziale zu erschließen und sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Dazu gehören beispielsweise gezielte Weiterentwicklungen des Geschäftsmodells, die Integration neuer Technologien und die Erschließung neuer Märkte. Auch Gläubiger*innen profitieren von dieser Vorgehensweise. Statt sich mit einer möglicherweise geringen Quote zufriedenzugeben, erhalten sie durch die Eigenverwaltung die Aussicht auf eine deutlich höhere Rückzahlung ihrer Forderungen. Dieses Win-win-Prinzip zeigt, dass die Eigenverwaltung nicht nur für das Start-up, sondern auch für dessen Partner*innen eine attraktive Lösung darstellt.
Neuanfang mit Perspektive
Jungunternehmen, die frühzeitig auf die Eigenverwaltung setzen, schaffen sich den notwendigen Handlungsspielraum, um die Krise effektiv zu bewältigen. Je länger gewartet wird, desto schwieriger wird es, das Vertrauen von Gläubiger*innen, Mitarbeitenden und Geschäftspartner*innen zu erhalten. Frühzeitiges Handeln ermöglicht es, Schwachstellen gezielt zu adressieren und die Erfolgsaussichten des Verfahrens erheblich zu steigern. Erfolgreich abgeschlossene Verfahren zeigen, dass die Insolvenz in Eigenverwaltung nicht das Ende, sondern einen Neuanfang bedeuten kann. Unternehmen, die diesen Weg wählen, nutzen die Krise, um sich neu zu positionieren, ihre Strukturen zu modernisieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Mit einem klaren Plan, einer engagierten Führung und externer Unterstützung lassen sich so nicht nur kurzfristige Probleme bewältigen, sondern auch langfristige Erfolge erzielen.
Der Autor Ulrich Kammerer ist geprüfter ESUG- und StaRUG-Berater sowie Vorstand von UKMC eG – Die Unternehmer-Retter by Ulrich Kammerer.
Stellenausschreibung – so entgehen Sie der Diskriminierungsfalle
Wer bei der Formulierung einer Stellenausschreibung nicht wirklich gut aufpasst, verstößt schnell gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und muss mit einer Klage wegen Diskriminierung rechnen. Das kann letztlich teuer werden. Hier lesen Sie, worauf es bei einer rechtssicheren Stellenausschreibung ankommt.
Was ist eigentlich das AGG?
Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) ist als Verhinderungsgesetz vor allem von geschlechts- und sexualbezogenen arbeitsrechtlichen Benachteiligungs- und Belästigungsverboten anzusehen. Ziel des AGG ist es Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern bzw. zu beseitigen (vgl. § 1 AGG).
Für wen gilt das AGG?
Kurz: Es gilt für alle Beschäftigten. Konkret verbietet das AGG Benachteiligungen aller Beschäftigten. Dazu gehören gem. § 6 Abs. 1 S. 1 AGG folgende Personengruppen:
- Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,
- die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten sowie
- arbeitnehmerähnliche Personen.
- Als Beschäftigte gem. § 6 Abs. 1 S. 2 AGG gelten aber auch Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis.
Was hat das AGG mit einer Stellenausschreibung zu tun?
Leider eine ganze Menge! Im Gerichtsalltag machen die Klagen mit Fällen des Diskriminierungsvorwurfes in Stellenausschreibungen den größten Teil der AGG-Gerichtsverfahren aus.
Wie sensibilisiert sind Sie?
Würden Sie über die nachstehenden Formulierungen stolpern?
„suchen wir einen Verkäufer …“, „suchen wir eine Steuerberaterin …“, „dann sind Sie unser Mann …“, „dann sind Sie der ideale Kandidat“, „Vollzeitstelle“
O.k. Das war einfach. Die Formulierungen sind allesamt nicht geschlechtsneutral! Und ja, das gilt auch für die Vollzeitstelle. Diese Formulierung impliziert nämlich nach Ansicht der Gerichte eine mittelbare Benachteiligung insbesondere von Frauen.
Daher beachten Sie immer: Eignet sich der Arbeitsplatz für Teilzeit, sind Sie verpflichtet, ihn auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben (§ 7 I TzBfG).
Wie sieht es mit den nachstehenden Formulierungen aus? Würde man die in Ihren Stellenanzeigen lesen?
„langjährige Berufserfahrung“, „jung und dynamisch“, „für unser junges Team“, „Sie sind körperlich belastbar …“, „mobil“, „geistig flexibel“, „Muttersprache Deutsch“
Richtig! Diese Formulierungen sind allesamt problematisch.
Worauf sollten Sie also achten?
Achten Sie auf Neutralität! Jede Art von Floskeln kann schnell zum Problem werden.
Die Rechtsprechung befasst sich in Fällen mit fehlerhaften Stellenausschreibungen am häufigsten mit Indizien, die eine Diskriminierung wegen des Alters nahelegen. Hier ist also besondere Vorsicht geboten. Selten liest man heutzutage noch Stellenausschreibungen, die nicht geschlechtsneutral formuliert sind und auch Indizien für Diskriminierungen wegen der Religion und der ethnischen Herkunft sind eher die Ausnahme. Auf Nummer sicher gehen Sie, wenn Sie einfach alles weglassen, was nicht direkt mit der Qualifikation und den gewünschten Eigenschaften des Bewerbers zu tun hat. Sogar bei den gewünschten Eigenschaften sollten Sie sich eher bedeckt halten, weil die Formulierung „jung und dynamisch“ bereits Rückschlüsse auf eine Alterdiskriminierung zulässt.
Welche Fehler sollten Sie unbedingt vermeiden?
- Formulieren Sie immer geschlechtsneutral, also keinen Geschäftsführer sondern mindestens einen Geschäftsführer w/m suchen.
- Bitten Sie um aussagekräftige Bewerbungsunterlagen und nicht um ein Lichtbild.
- Setzen Sie eine für die Position angemessene Berufserfahrung voraus und suchen Sie weder einen Berufsanfänger noch jemanden mit langjähriger Berufserfahrung.
- Erwarten Sie sehr gute Deutschkenntnisse, aber nicht Deutsch als Muttersprache.
- Beschreiben Sie die Tätigkeit spezifisch und nicht die körperlichen bzw. geistigen Anforderungen an den Bewerber.
Wie teuer kann eine Diskriminierung werden?
Dem vermeintlich Diskriminierten kann bis zu drei Bruttomonatsgehälter Schadensersatz zugesprochen werden. Geld, das Sie sicher besser verwenden können. Hinzu kommen hier ja dann auch noch Anwalts- und Gerichtskosten.
Was können Sie tun, wenn Sie verklagt werden?
Ist eine Benachteiligung wegen einer problematischen Formulierung in einer Stellenanzeige zu vermuten, müssen Sie als das ausschreibende Unternehmen nachweisen, dass die betroffene Person nicht tatsächlich benachteiligt worden ist, ihr Geschlecht, ihr Alter oder ihre Religion also bei der Auswahl überhaupt keine Rolle gespielt hat. Hierbei müssen Sie sich gegebenenfalls vom Gericht in die Karten sehen lassen. Sie müssen auf jeden Fall nachweisen können, dass Sie eine sachlich begründete Entscheidung getroffen haben. Ihre Behauptung allein wird dabei allerdings nicht genügen. Haben Sie eine „junge und dynamische“ Person gesucht und einen 45-Jährigen mit entsprechenden Qualifikationen nicht einmal zum Vorstellungsgespräch eingeladen, dürfte es eng werden.
Insidertipp
Lassen Sie sich nicht erwischen! Sie dürfen ja einstellen, wen Sie wollen. Kein Mensch kann und darf Sie zwingen, jemanden einzustellen, den Sie nicht haben möchten. Formulieren Sie Ihre Stellenanzeige demzufolge absolut neutral und sieben Sie im weiteren Verfahren alles aus, was Sie nicht haben wollen. Beabsichtigen Sie eher die Einstellung einer Frau als die eines Mannes, dann laden Sie einfach nur die weiblichen Bewerber ein. Solange Sie in der Stellenanzeige kein Diskriminierungsindiz geliefert haben, ist das völlig unschädlich.
Die Autorin: Elishewa Patterson-Baysal ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht bei der MEIDES Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Sie ist zudem Geschäftsführerin der Online-ArbeitsrechtsAkademie.
Barrierefreiheit im E-Commerce
Die EU hat den European Accessibility Act, kurz EAA, in die Welt gerufen, der Shopbetreiber*innen dazu verpflichtet, ab 2025 barrierefreie Inhalte zu betreiben. 2025? Es gilt: Nicht warten, sondern jetzt planen und handeln.
Während bei dem Begriff Barrierefreiheit in erster Linie über zugängliche öffentliche Verkehrsmittel, angepasste Wohnmöglichkeiten und rollstuhlgerechte Gebäude gesprochen wird, geraten Hindernisse der digitalen Welt schnell in Vergessenheit. Landläufig besteht sogar der Irrglaube, dass mit einer Zoom-Funktion bereits alle Barrieren überwunden sind. Unübersichtliche Layouts, komplizierte Produktbeschreibungen, schlecht positionierte Bilder und zu kleine Zeilenabstände – für den Großteil der Menschen stellen diese Aspekte keine entscheidenden Kriterien für die Nutzung eines Onlineshops dar. Anders sieht es für Menschen mit Einschränkungen aus. Aus diesem Grund hat die Europäische Union den sogenannten European Accessibility Act, kurz EAA, in die Welt gerufen, der Shopbetreiber*innen dazu verpflichtet, ab 2025 barrierefreie Inhalte zu betreiben.
Kleine Ursache, große Wirkung
Nach Angaben des statistischen Bundesamtes galten zum Jahresende 2019 rund 7,9 Millionen Menschen als schwerbehindert. Für ebenjene Personen bietet die digitale Welt eine Möglichkeit, ihr Leben selbstbestimmt zu führen. Aufgrund dessen heißt es im E-Commerce eine Grundlage zu schaffen, die dies ermöglicht. So müssen in einem Onlineshop auch dann alle Funktionen und Services uneingeschränkt nutzbar sein, wenn eine visuelle oder körperliche Beeinträchtigung besteht. Dazu gehören auch eine Farbsehschwäche, Fehlsichtigkeit, Epilepsie sowie motorische Einschränkungen.
Mit der neusten Barrierefreien-Informationstechnik-Verordnung, kurz BITV 2.0, wurde unter anderem die Barrierefreiheit im Netz vorgegeben. Diese wurde anschließend novelliert und an den internationalen Standard „Web Content Accesibility Guidelines“ angepasst. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass es unterschiedliche Prioritäten der Richtlinien gibt. Laut WCAG gehören die Punkte Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit sowie Robustheit zu den vier Kernaspekten. Dabei unterscheiden die international geltenden Standards drei unterschiedliche Stufen, die den Grad der Barrierefreiheit beschreiben. Während grundlegende Maßnahmen wie Textalternativen oder Untertitel ein A-Ranking bedeuten, gilt eine AAA-Einstufung als vollkommen hindernisfrei. Für Unternehmen empfiehlt es sich, mindestens die AA-Standards zu erfüllen. Wer einen langfristigen Erfolg verzeichnen möchte, kommt nicht darum herum, die Aspekte der WCAG zu berücksichtigen.
Trügerische Fehleinschätzung
Auch wenn Shopbetreiber*innen oft davon ausgehen, dass der eigene Webauftritt barrierefrei gestaltet ist, sieht die Realität häufig anders aus. Wer sich genauer mit der Materie beschäftigt, findet in den meisten Fällen gravierende Defizite. So benötigt gute Wahrnehmbarkeit eine einfache und strukturierte Navigation auf der Website, die beispielsweise per Tab-Taste sinnvoll bedienbar sein muss. Dabei darf der Besucher/die Besucherin nicht von irreführenden Werbebotschaften, Bannern oder anderweitigen Inhalten abgelenkt werden. Hierzu gehören Themen wie Farbe, Bewegung und Animationsgeschwindigkeit.
Etwa 9 Prozent aller Männer leiden unter ein Rotgrünschwäche, die im Netz schnell zum Hindernis werden kann. Außerdem gelten sich zu schnell bewegende Anzeigen als Auslöser für Epilepsie. Darüber hinaus zählen Funktionen wie Textalternativen für grafische Inhalte sowie eine Anpassbarkeit der Typografie zu wichtigen Aspekten. Ohne diese Strukturen können Screenreader nicht zum Einsatz kommen, sodass Menschen mit eingeschränkter oder nicht vorhandener Sehkraft den Shop nicht nutzen können. Auch die Verwendung einer einfachen Sprache erleichtert den Zugang zu den eigenen Inhalten. Eine klare sowie verständliche Wortwahl senkt das Frustrationsrisiko. Komplizierte und verschachtelte Satzkonstruktionen können dagegen schnell abschreckend wirken. Externe, auf E-Commerce spezialisierte Agenturen helfen dabei, effizient die vorherrschenden Schwachstellen zu erkennen und diese zu beheben.
Win-win-Situation
Nicht nur, dass mit einem barrierefreien E-Commerce-Kanal das volle Vertriebspotenzial ausgeschöpft werden kann, er trägt ebenso zur Einhaltung der eigenen Qualitätsstandards bei. Im Rahmen eines übersichtlichen Gesamtbildes, dass durch den angepassten Content entsteht, verbessern sich die Struktur, Übersichtlichkeit sowie die Wiederverwendbarkeit des Codes. Auch wer Barrierefreiheit als „Auflage“ empfindet, wird sich früher oder später darum kümmern müssen. Ein grenzenlos nutzbarer Onlineshop stellt hohe Anforderungen an die Umsetzungsqualität. Die Informationsarchitektur, Bedienbarkeit, Gestaltung sowie die Programmierung und Umsetzung müssen in hoher Qualität bearbeitet werden. Dies führt automatisch zu besseren Google-Rankings, da der Konzern relevante Inhalte in einer technisch sauberen und strukturierten Form belohnt.
Netter Nebeneffekt: Ein im Kern stabiler Quelltext erhöht die Erreichbarkeit von verschiedenen Plattformen – sowohl im Hinblick auf das Betriebssystem als auch auf den aktiven Browser. Darüber hinaus schafft es aufgrund der strukturierten Prozesse eine deutlich bessere Wartbarkeit.
Der Autor Andreas Köninger ist App-Entwickler und Vorstand der SinkaCom AG, die mittelständische Kund*innen dabei unterstützt, ihre Strategie, Business- und Kommunikationsziele erfolgreich in Systemen, Prozessen und Organisationen umzusetzen und zu erreichen.
Plattformen rechtssicher gestalten: Neue rechtliche Vorgaben aus Brüssel
Was Unternehmer bei Aufbau und Gestaltung von Plattformen rechtlich beachten sollten, damit sie EU-rechtskonform bleiben.
Die EU hat den Digital-Markt für sich „entdeckt“: Schlag auf Schlag kommen neue Richtlinien und Verordnungen – also „EU-Gesetzestexte“ – mit spezifischen Anforderungen, die von Plattformen und anderen digitalen Produkten und Dienstleistungen erfüllt werden müssen. Das Ziel ist ein Europa, das „fit“ ist für das digitale Zeitalter. Gerade bei Aufbau und Gestaltung von Plattformen hat es jüngst einige Neuerungen gegeben, die Du beachten solltest.
Wer ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung entwickelt, muss auch etliche rechtliche Vorgaben beachten. Digitale Plattformen bergen dabei rechtlich einige besondere Hindernisse. Denn eine Plattform bringt nicht nur dein Unternehmen mit Endkunden zusammen, sondern eröffnet eine Interaktionsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Playern auf deiner Plattform. Die großen Plattformen stehen deshalb gerade auch unter besonderer Beobachtung der Wettbewerbshüter. Dafür ist aber schon eine ganz starke Marktdurchdringung erforderlich.
Bei der Entwicklung einer Plattform ist es ratsam, die rechtskonforme Gestaltung möglichst früh in die Planungen einzubeziehen. Dies verhindert böse Überraschungen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Entwicklung bereits weit vorangeschritten ist. Oft wäre es zu Beginn sogar ein Leichtes gewesen, die rechtlich benötigten Buttons, Checkboxen und „Klicks“ einzubauen. Dies nachträglich zu tun, bindet (eigentlich nicht vorhandene) Ressourcen und verzögert im Worst Case den Launch der Plattform.
Besonders wichtig ist dabei:
1. Datenflüsse bestimmen und rechtskonform gestalten: Für jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss eine Erlaubnisgrundlage gefunden werden. Das kann die Nutzungsvereinbarung sein, eine Einwilligung oder auch dein überwiegendes unternehmerisches Interesse. Das Ganze muss transparent in der Datenschutzerklärung beschrieben werden.
2. Nutzungsvereinbarung aufsetzen: Was kann und will ich verbindlich zusagen? Und welche Klauseln muss ich von Rechtswegen aufnehmen? Hier gibt es ganz aktuell neue Vorgaben aus der EU, wenn auf deiner Plattform Verträge geschlossen werden können zwischen Unternehmen und Verbrauchern.
3. Registrierungsprozess rechtskonform gestalten: Was muss ich tun, um die Nutzungsvereinbarung wirksam einzubeziehen? Und wie weise ich auf die Datenschutzerklärung hin? Benötige ich noch zusätzliche Einwilligungen? Muss ein Double Opt-In implementiert werden? Mit welchem Text?
4. Pflichtangaben beachten: Was muss ich auf meiner Plattform wie angeben, z.B. das Impressum oder Hinweise auf Streitschlichtung?
Datenflüsse gestalten und beschreiben
Plattformen leben von der Verarbeitung (auch) personenbezogener Daten. Sie stehen damit im Kreuzfeuer von EU-Datenschutzgrundverordnung und ePrivacy-Recht. Da hier bei Verstößen hohe Bußgelder drohen, ist es besonders wichtig, die Anforderungen von Anfang an eng im Blick zu halten. Das verschärfte EU-Recht im Datenschutz gilt inzwischen schon seit über zwei Jahren. Viele Einzelfragen sind trotzdem noch nicht geklärt und im Fluss, die datenschutzkonforme Gestaltung ist damit in jedem Einzelfall eine große Herausforderung. Mit transparent aufbereiteten Datenflüssen und einem frühzeitigen Abgleich, was zulässig ist, ist diese Herausforderung in der Praxis aber zumeist gut zu managen. Ressourcen sollten dafür aber unbedingt eingeplant werden.
Dies gilt gerade auch deshalb, weil das Datenschutzrecht umfassende Dokumentationen fordert: Die Prozesse müssen in sog. Verarbeitungsverzeichnissen beschrieben werden, die Risiken sind zu analysieren und womöglich in einer Datenschutzfolgenabschätzung umfassend aufzubereiten, den Plattformnutzern muss die Datenverarbeitung transparent in einer Datenschutzerklärung erläutert werden u.v.m.
Und auch für nicht personenbezogene Daten sind einige Spezialvorgaben der EU zu berücksichtigen, allen voran die Geoblocking-Verordnung (EU) 2018/302. Ihr Ziel ist es, dass alle EU-Bürger von überall her „like-a-local“ shoppen können. Der Online-Zugang zu einem Angebot darf deshalb nicht durch technische Mittel gesperrt werden, weil der Besucher von einem anderen Ort aus zugreifen möchte. In eine ähnliche Richtung zielt die Verordnung (EU) 2018/1807 über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-personenbezogener Daten in der EU, die Datenlokalisierungsauflagen grundsätzlich ebenso verbietet.
Nutzungsvereinbarungen im Einklang mit den EU-Vorgaben: die neue Platform-to-Business-Verordnung
Bevor die Plattform den Nutzern geöffnet wird, sollten zudem passende Nutzungsbedingungen geschrieben werden. Hierbei sind zwei Elemente ganz zentral:
- Du musst sehr klar festlegen, was du versprechen kannst und möchtest. Daran bist du nämlich gebunden und die wesentlichen Versprechen können nachträglich nicht mehr einseitig geändert werden. Was muss ich außerdem wegen der von mir genutzten Vorprodukte aufnehmen? Wenn ich Plattformen etwa auf Azure aufbaue, verpflichtet mich Microsoft, für eine ordnungsgemäße Nutzung zu sorgen und meinen Kunden bestimmte Pflichten aufzuerlegen, z.B. mit Passwörtern sorgfältig umzugehen. Und welche Open Source Elemente habe ich in meiner App integriert, für die ich die Lizenzbedingungen einhalten muss?
- Außerdem ist auf eine Reihe rechtlicher Vorgaben zu achten. Das deutsche AGB-Recht ist dabei sicherlich vielen geläufig. Anlass dieses Artikels ist dagegen ein anderer Rechtskreis: Die EU ist gerade sehr aktiv mit neuen Vorschriften für digitale Angebote. Das bringt neue Herausforderungen mit sich, da zunächst einmal identifiziert werden muss, welche Texte aus Brüssel nun für das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung überhaupt relevant sind. Zahlenmäßig werden es immer mehr. Allerdings ist dies auch mit einer großen Chance verbunden, denn die Vorgaben der EU gelten regelmäßig auch gleichermaßen in der ganzen EU: Der Rollout über verschiedene Länder hinweg wird so (rechtlich) deutlich einfacher.
Für Plattformen gilt nun seit dem 12. Juli 2020 die sog. „P2B-Verordnung“. Mit vollem Namen heißt sie Verordnung (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten. Als EU-Verordnung müssen sich Unternehmen direkt an ihre Vorgaben halten. Anders, als bei EU-Richtlinien, können wir also nicht erst auf ein nationales Umsetzungsgesetz warten.
Die P2B-Verordnung richtet sich an alle Betreiber von Plattformen, auf denen Verträge zwischen gewerblichen und privaten Nutzern vermittelt werden oder die bei der Suche helfen. Paradebeispiele sind eBay, Amazon oder auch etsy. Die Größe ist der P2B-Verordnung egal: Auch Startups sind vom ersten Tag an erfasst, wenn sie auf ihrer Plattform Unternehmer und Verbraucher zusammenbringen.
Inhaltlich schreibt die P2B-Verordnung vor, wie der Plattformbetreiber seine Nutzungsbedingungen zu gestalten hat. Gerade bei jungen Projekten sticht hier etwa heraus, dass eine 30tägige Kündigungsfrist vorgesehen werden muss, um gewerbliche Nutzer von der Plattformnutzung ausschließen zu dürfen (mit Begründung). Das kann bei kurzen Entwicklungszyklen erheblich ausbremsen und sollte frühzeitig bedacht werden. Auch ist ein Beschwerdemanagement einzurichten. Bei Suchen oder Rankings muss erklärt werden, nach welchen Parametern gelistet wird.
Geschützt werden sollen durch diese Verordnung vor allem die gewerblichen Anbieter: Plattformbetreibern soll es nicht (mehr) möglich sein, durch undurchsichtige Listings oder intransparente Regelungen manche Anbieter zu befördern, andere dagegen auszubremsen. Das ist für große Plattformanbieter nachvollziehbar, für kleinere dagegen weniger.
Im Wesentlichen ist die Umsetzung der P2B-Verordnung mehr Fleißarbeit denn Hexenwerk. Gerade bei Neuentwicklungen kann sie hemmend wirken, jedenfalls in der trial and error-Phase. Wird sie nicht eingehalten, droht die Nichtigkeit der einzelnen Nutzungsbestimmung.
Wenn der Wald vor lauter Bäumen verschwindet
Bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass eine rechtskonforme Plattformgestaltung durchaus kein leichtes Unterfangen ist. Gerade von der EU sind in den letzten Monaten etliche Vorgaben gekommen, die sich in vielen verschiedenen Texten finden. Bei einer systematischen Herangehensweise ist aber auch dieser Herausforderung mit etwas Fleißarbeit und Liebe zum Detail gut zu meistern. Die vorstehende Übersicht möge hier dem ersten Zugang dienen.
Für das 4. Quartal 2020 hat die EU-Kommission übrigens noch einen neuen Digital Services Act angekündigt, der sich insbesondere mit Haftungsthemen und Verantwortlichkeiten bei illegalen Inhalten beschäftigen soll, erneut ein Plattformthema. Die Reise ist mithin noch nicht zu Ende und wird es wohl auch noch lange nicht sein. Dies kennen Sie vermutlich schon bestens vom Datenschutzrecht, das seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 auch fortlaufend mit neuen Erkenntnissen „Prozessoptimierungen“ erfordert. Es gilt daher: Wachsam bleiben. Die wirklich relevanten Anforderungen werden kommuniziert. Wer diese mit offenen Augen und Ohren aufnimmt, wird selten ins offene Messer laufen.
Die Autorin Dr. Kristina Schreiber ist auf die rechtliche Begleitung von Digitalisierungsprojekten spezialisiert und Partnerin bei Loschelder Rechtsanwälte
Werbe-E-Mails rechtssicher versenden
Wer potenzielle Kunden per E-Mail anspricht, sollte die Rechtslage kennen. In bestimmten Fällen ist der Versand von Werbe-E-Mails nämlich nur bedingt erlaubt oder sogar verboten.
Wenn Unternehmen Kunden akquirieren und Kontakt zu diesen aufnehmen, nutzen sie dafür oft das Internet, um an die entsprechenden Daten - vorzugsweise E-Mail-Adressen - zu gelangen. Doch statt einen Marketing- oder Vertriebsmitarbeiter einzusetzen, der sich um professionelle Kundenakquise kümmert und dafür ein bestimmtes Budget benötigt, werden in vielen Fällen selbst Adressdaten recherchiert und potenzielle Kunden mittels Werbe-E-Mails angeschrieben.
Diese kurzsichtige Vorgehensweise ist aus rechtlicher Sicht gefährlich, denn wann solche E-Mails überhaupt versendet werden dürfen, wann nur bedingt und in welchen Fällen überhaupt nicht, wissen in der Regel nur die wenigsten Unternehmen beziehungsweise deren Marketing-Abteilungen. Die Problematik dabei: Werbe-E-Mails können in bestimmten Fällen unzulässige Werbung sein.
Wann Werbe-E-Mails erlaubt sind
Folgende Voraussetzungen müssen für den rechtmäßigen Versand von Werbe-E-Mails vorliegen:
Der Empfänger hat dem Empfang von Werbe-E-Mails zugestimmt und der Inhalt der Werbe-E-Mail passt zur Produktkategorie, für die er Werbung erhalten möchte. Handelt es sich um einen Newsletter, muss dafür eine Anmeldung vorliegen. Der Empfänger hat seine E-Mail-Adresse per Double-Opt-In-Verfahren über ein Anmeldeformular auf der Webseite des Unternehmens bestätigt. Um die Einwilligung zu beweisen, müssen dem Unternehmen sowohl die Einwilligung (Text und Klick auf "Bestätigen") als auch die positive Bestätigung der E-Mail-Adresse im Double-Opt-In-Verfahren vorliegen (jeweils Datum und Uhrzeit in der Datenbank).
Neuregelungen beim Einsatz von Fremdpersonal
Seit dem 1. April 2017 gelten bei der Vermittlung von Leiharbeitern und Selbständigen verschärfte Vorgaben. Unternehmen sollten die gesetzlichen Neuerungen genau kennen, um nicht in arbeitsrechtliche Stolperfallen zu geraten. Das reformierte Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) macht das Thema zur Chefsache.
In vielen Firmen ist der Einsatz von Fremdpersonal nicht mehr wegzudenken. So gewinnen Unternehmen Flexibilität und reduzieren Fixkosten. Das reformierte Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) macht das Thema zur Chefsache. Zum einen erschwert das neue AÜG den Einsatz von Leiharbeitern erheblich. Zum anderen erhöht es die Gefahr von Scheinselbständigkeit. Firmen sollten bestehende Verträge rund um Fremdpersonal kritisch prüfen und neue mit Weitblick ausgestalten. So können Unternehmen externe Kräfte trotz der verschärften Vorgaben bedenkenlos einsetzen.
Neues im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
Das neue Gesetz soll missbräuchlichen Praktiken beim Einsatz von Fremdpersonal einen Riegel vorschieben. Es regelt sowohl die Arbeitnehmerüberlassung als auch die Vermittlung und den Einsatz von Selbständigen. Ein zentraler Aspekt ist die Neuregelung der Einsatzzeiten von Leiharbeitern. Im alten AÜG war nicht klar geregelt, wie lange eine Überlassung höchstens erfolgen darf. Künftig ist die Höchstdauer auf 18 Monate limitiert. Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen lassen abweichend davon eine Einsatzdauer von maximal 24 Monaten zu.
Zeiträume vor dem 1. April 2017 bleiben außen vor. Personalverantwortliche sollten sich vorsichtshalber den 22. September 2018 im Kalender rot anstreichen. Dann endet bei laufenden Kontrakten erstmalig die Höchstüberlassungsdauer. Soll ein Zeitarbeiter im Anschluss im selben Unternehmen erneut zum Einsatz kommen, ist eine Unterbrechung von mehr als drei Monaten vorgeschrieben.
Vom Leiharbeiter ungewollt zum Arbeitnehmer
Werden die Zeitvorgaben nicht eingehalten, wird aus einem Leiharbeiter automatisch ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer mit Urlaubsanspruch und Kündigungsschutz. Übersehen Unternehmen den Arbeitnehmerstatus, drohen neben hohen Lohnsteuer- und Sozialversicherungsnachzahlungen zusätzlich strafrechtliche Konsequenzen. Auch bei der Entlohnung von Zeitarbeitern müssen Entleiher aufpassen. Leiharbeitern steht spätestens nach neun Monaten das gleiche Gehalt („Equal Pay“) wie dem Stammpersonal zu. Tarifliche Sonderregelungen ermöglichen eine Einsatzzeit von bis zu 15 Monaten ohne Equal Pay.
Dazu muss der Entleiher dem Verleiher mitteilen, in welcher Höhe das vergleichbare Arbeitsentgelt zu veranschlagen ist. Bei Verstößen gegen das Equal-Pay-Gebot droht dem Verleiher ein Bußgeld, das in der Spitze 500.000 Euro betragen kann. Die Berechnung und Mitteilung des vergleichbaren Arbeitsentgeltes erfordert erhöhte Sorgfalt. Bei Fehlern kann das Zeitarbeitsunternehmen Bußgelder beim Entleiher einklagen.
Arbeitnehmer-Überlassungsvertrag
Für die Gestaltung eines Arbeitnehmer-Überlassungsvertrags (AÜV) gelten verschärfte Regeln. Der vereinbarte AÜV muss eindeutig als solcher bezeichnet und noch vor Arbeitsbeginn des Zeitarbeiters unter Dach und Fach sein. Im Vertrag darf der Name des Leiharbeiters sowie die Unterschrift des Ver- und Entleihers nicht fehlen. Bei Verstößen gegen die „Kennzeichnungs- und Konkretisierungspflicht“ kann die Arbeitsagentur gegen beiden Parteien ein Bußgeld in Höhe von bis zu 30.000 Euro verhängen. Darüber hinaus verliert der Überlassungsvertrag gegebenenfalls seine Gültigkeit und der Zeitarbeiter wird zum sozialversicherungspflichtigen Angestellten des Entleihers.
Festhaltenserklärung
Grundsätzlich bleibt ein Ausweg. Falls zwischen Entleiher und Zeitarbeiter unbeabsichtigt ein Arbeitsverhältnis entsteht, eröffnet das neue AÜG eine arbeitgeberfreundliche Lösung. Der frisch gebackene Arbeitnehmer kann innerhalb eines Monats erklären, dass er am Arbeitsvertrag mit dem Verleiher festhält (sog. Festhaltenserklärung). So vermeiden Mitarbeiter, dass sie sich wider Willen in der Rolle eines ungewollten Arbeitnehmers wiederfinden. Der Leiharbeitnehmer muss sich die Erklärung persönlich bei der Arbeitsagentur bestätigen lassen und spätestens drei Tage später beim Ver- oder Entleiher vorlegen. Firmen sollten nach einer erfolgten Festhaltenserklärung von einer Weiterführung der Überlassung absehen. Eine erneute Festhaltenserklärung wäre in jedem Fall unwirksam.
Einsatz von Freelancern
Auch beim Einsatz von Freelancern über Vermittlungsagenturen ist erhöhte Vorsicht geboten. Die Beschäftigung erfolgt auf der Grundlage eines Werk- oder Dienstvertrages zwischen dem Selbständigen und dem Einsatzunternehmen. Die Crux: Wenn Freelancer etwa über Zeit, Ort und Art ihrer Tätigkeit nicht frei entscheiden können, besteht eine Scheinselbständigkeit. Bisher konnten Vermittler im Rahmen der sog. Fallschirmlösung sich und ihre Auftraggeber vor negativen Konsequenzen schützen. Dafür sorgte eine vorsorglich beantragte Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis. Der Dienstleister konnte so eine Scheinselbständigkeit nachträglich zur rechtmäßigen Leiharbeit umdeklarieren. Damit ist jetzt Schluss. Das neue Gesetz schließt die Fallschirmlösung grundsätzlich aus.
Der Rechtmäßigkeit bestehender und künftiger Verträge kommt damit eine enorme Bedeutung zu. Die tatsächliche Beurteilung der Beschäftigungsform hängt oft von Kleinigkeiten ab. Firmen sollten bestehende Verträge und die gelebte Einsatzpraxis kritisch unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls nachjustieren.
Die Autorin Rebekka De Conno ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht der Kanzlei WWS in Mönchengladbach, www.wws-gruppe.de
Gewerberaum mieten
Der Mietvertrag über Gewerberaum weicht von den Regelungen des Wohnraummietvertrages ab. Hauptunterschied: Dem Gewerberaummietvertrag sind grundsätzlich keine gesetzlichen Schranken gesetzt. Daher sind vielfältige Ausgestaltungen im Gewerbemietrecht möglich, sofern die Vertragsparteien darüber Einigkeit erzielen. Es gilt umso mehr der stets aktuelle Grundsatz nach Friedrich Schiller: "Drum prüfe wer sich (ewig) bindet."
Denn der Gründer verliert als Gewerbetreibender oder auch als Freiberufler den Schutz des Verbraucherrechts, wenn er im Sinne seines Unternehmens handelt. Andererseits eröffnen sich jedoch für beide Vertragsparteien im Gewerbemietrecht flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten. Über Inhalt und Abschluss des Mietvertrages entscheidet im Fall der Gewerberaummiete damit in gleichem Maße die Sympathie, die Marktsituation wie auch das Verhandlungsgeschick der Vertragspartner bzw. deren jeweiliger Interessenvertreter.
Definition: Wohnraum und/oder Gewerberaum?
Die Abgrenzung, ob es sich um einen Mietvertrag über Wohnraum oder Gewerberaum handelt, kann schwierig werden, wenn die vermieteten Räume zugleich zu Wohn- und Betriebszwecken genutzt werden sollen. Gerade bei Gründern und insbesondere bei Freiberuflern fällt die klare Abgrenzung des Gewerbemietrechts zum privaten Mietrecht oft nicht leicht.
Typische Beispiele im freiberuflichen Bereich sind der Arzt oder Steuerberater, der vorn in den Räumlichkeiten seine Praxis bzw. sein Büro einrichtet und den hinteren Teil der Räume als privaten Wohnraum nutzt. In erster Linie kommt es darauf an, was nach dem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien – wie er im Vertrag festgelegt wird – den Schwerpunkt des Vertrages bilden soll. Soll also ein Wohnraum- oder Gewerberaummietverhältnis begründet werden?
Zweckentfremdung von Wohnraum kann teuer werden.
Die Fälle sind jedoch nicht immer so klar: wie im Beispiel eines Online-Händlers, der aus seiner Wohnung kurzerhand ein Warenlager macht. Besonders im letztgenannten Beispiel droht allerdings die außerordentliche fristlose Kündigung, da die Aufnahme eines Gewerbebetriebes in einem Wohnraum ohne die Zustimmung des Vermieters die Rechte des Vermieters erheblich verletzt. Man spricht in diesem Fall von einer Zweckentfremdung durch den Mieter.
Zudem drohen ordnungsrechtliche Sanktionen: In Zeiten immer knapper werdenden Wohnraums haben die Städte und Kommunen ihre Bußgelder teilweise drastisch erhöht. Bis zu 100.000 Euro sind beispielsweise nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz des Landes Berlin für diese Ordnungswidrigkeit durch den Verursacher zu entrichten. Wird dem Vermieter eine Zweckentfremdung seiner Mietsache bekannt, wird er diese schnellstens unterbinden wollen, um seine Haftung zu vermeiden, und da ist die außerordentliche fristlose Kündigung meist das Mittel der Wahl.
Doch so weit muss es nicht kommen: Wer die eventuell negative Reaktion seines Vermieters nicht scheut, kann auf Verständnis hoffen und diesen fragen. Lässt sich der Vermieter ein, sollte das gemeinsam gefundene Verständnis schriftlich fixiert werden. Zur rechtssicheren Formulierung sollte ein Anwalt hinzugezogen werden.
Vertragslaufzeit im Gewerbemietrecht: endlos?
Mietverträge über Gewerberaum werden häufig auf Zeit geschlossen (3, 5 oder mehr Jahre). Nach der Konzeption des Gesetzgebers ist eine Beendigung vor Ablauf der vorbestimmten Zeit nur schwer möglich. Bei einem auf unbestimmte Zeit geschlossenen Gewerberaummietvertrag kann jedoch zum Ende eines jeden Quartals ohne Angabe eines Grundes unter Einhaltung der Kündigungsfrist (regelmäßig 6 Monate) gekündigt werden.
Die Vor- und Nachteile beider Regelungsmöglichkeiten sollten frühzeitig abgewogen werden. Gemeinsam mit einem Berater können die verschiedenen Konzepte zu bedarfsgerechten, flexiblen Regelungen besprochen werden. Soll der Mietvertrag ein vorbestimmtes Ende haben, so ist die Formvorschrift des § 550 BGB zu berücksichtigen. Diese Vorschrift ordnet für Zeitmietverträge zwingend die Schriftform an. Wird bei Vertragsabschluss hiergegen verstoßen, so gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Wer trägt Rechte und Pflichten beim Gewerbemietvertrag?
Im Hinblick auf die gesetzlichen Mängelrechte können diese durch beide Vertragspartner einvernehmlich ausgeschlossen werden. Mit den sogenannten "Dach-und-Fach-Klauseln" kann es sogar noch einen Schritt weiter gehen: Dem Mieter kann vertraglich die Pflicht auferlegt werden, für die Instandsetzung und Instandhaltung des Gewerberaumes verantwortlich zu sein. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, macht sich der Mieter gegenüber dem Vermieter schadensersatzpflichtig. Dies hat die Rechtsprechung dann als zulässig angesehen, wenn dem Mieter im Gegenzug weitreichende Rechte ähnlich eines Eigentümers eingeräumt werden.
Wenn der Mieter durch den Vermieter also z.B. das Recht eingeräumt bekommt, erhebliche bauliche Veränderungen nach seinen eigenen, für den Gewerbebetrieb vorteilhaften Wünschen vorzunehmen, dann kann er grundsätzlich auch dazu verpflichtet werden, diese wirtschaftlich zu unterhalten. Gleichzeitig ist es möglich, von der gesetzlichen Verpflichtung des Mieters, die von ihm vorgenommenen baulichen Maßnahmen bei Beendigung des Mietverhältnisses wieder auszubauen, durch Vertrag abzuweichen.
Achtung: Mietrückstand!
Anders als im Wohnraummietrecht genießt der Mieter von Gewerberaum keinen besonderen Schutz, da dieser unter sozialen Gesichtspunkten nicht geboten ist. Dies hat letztendlich auch zur Folge, dass dem Mieter grundsätzlich auch schon bei Rückstand von weniger als einer Monatsmiete gekündigt werden kann.
Dies geht jedenfalls nach der Rechtsprechung dann, wenn besondere Umstände des Einzelfalles hinzukommen, die die Interessen des Vermieters gegenüber jenen des Mieters überwiegen lassen. Denkbar sind nach dem Bundesgerichtshof eine geringe Kreditwürdigkeit des Mieters oder eine kritische finanzielle Situation des Vermieters, die durch den Mietrückstand herbeigeführt wurde oder sie verschlimmert hat.
Abschließend lässt sich festhalten, dass Unternehmenserfolg neben wirtschaftlichem Sachverstand oft auch solide Kenntnisse der aktuellen Rechtslage erfordert. Und das fängt spätestens bei der Gestaltung des Gewerbemietvertrages an.
Der Autor, Mag. iur. Dennis Kallabis, ist als Jurist in einer Wirtschaftskanzlei in Düsseldorf tätig. Im Schwerpunkt hat er deutsches und europäisches Unternehmensrecht studiert.
Schutz vor Piraten und Raubrittern
Wer sich gegen Nachahmer schützen will, sollte überlegen, sein Produkt als Marke zu registrieren. Lesen Sie, was man bei der Markenanmeldung zu beachten hat.
Das hätte er wohl nicht geglaubt. Im Jahr 1886 erfand John Pemberton ein zuckerhaltiges Wohlfühl-Getränk gegen Depression. Pemberton verfeinerte es mit Wein, Sodawasser und Stoffen der Koka-Pflanze. Ein unvergleichlicher Aufstieg begann. Unter dem Namen Coca-Cola kennt heute fast jeder die braune Brause. Es ist die bekannteste Marke weltweit. Mit einem geschätzten Wert von 67 Milliarden US-Dollar verweist Coca-Cola Unternehmen wie Microsoft, Daimler-Chrysler oder Google auf die Plätze. Großunternehmen wie Coca-Cola, aber ebenso auch viele Existenzgründer und Mittelständler leben von der Vermarktung ihrer Ideen und Erfindungen. Damit erobern sie Märkte und erzielen Gewinne.
Der Staat hilft dabei, indem er kreative und einmalige Kennzeichen, Produkte und Verfahren schützt. Zum Beispiel mit Hilfe eines Patents oder einer Marke. Der Inhaber einer Marke erhält das exklusive Recht, ein bestimmtes Zeichen im Geschäftsverkehr zu nutzen. Wie zum Beispiel Coca-Cola. Bereits im Jahr 1887 beantragte dessen Erfinder John Pemberton in Amerika den Schutz des Schriftzuges. In Deutschland wurde Coca-Cola im Jahr 1926 als Marke angemeldet. Heute verdient der gleichnamige Getränkekonzern Milliarden. Nachahmer und Raubritter haben keine Chance. Im Folgenden zeigen wir anhand von Beispielen, was eine Marke ist, wie ein Kennzeichen geschützt werden kann und was dabei zu beachten ist.
Beispiel Möbel-Marke
Als Werbekauffrau weiß Laura Faltz, was ankommt. Die 30-Jährige ist Geschäftsführerin der ecomoebel GmbH. Das Unternehmen vertreibt individuell gestaltete Möbel, die ganz pder teilweise aus Altmöbeln produziert werden. Die alten Stücke werden sogar auf Schadstoffe getestet, bevor sie nach Wunsch „aufgemöbelt“ werden.
Jeder Kunde erhält sein ganz persönliches Möbel, das gesundheitlich unbedenklich ist. Bestätigt wird das mit dem ecomoebel-Zertifikat. Aus Betten werden Bänke, aus Fenstern Vitrinen, oder es wird Schränken einfach ein neuer Anstrich verpasst. Seit August 2003 ist ecomoebel als Marke registriert und geschützt. Nur die Dortmunder Firma und die mit Lizenzen ausgestatteten Partner dürfen das Möbel-Zeichen benutzen. Der Wert der Firma ist damit bis heute weiter gestiegen.
Für eine Handvoll Euro
Wenn Streitigkeiten mit Geschäftspartnern oder Kunden drohen, bietet die Mediation eine sinnvolle und günstige Alternative zum teuren Rechtsstreit.
Wenn man Gründer fragt, worauf sie besonders stolz sind, dann sprechen sie vielleicht über den ersten großen Auftrag, über die reibungslose Finanzierung durch die Bank oder sie erzählen von der super Stimmung im Gründer-Team. A. Meier und H. Habermehl (Namen von der Redaktion geändert), seit Juli 2010 Inhaber einer eigenen Firma, verweisen hingegen auf einen Passus in ihrem Gesellschaftervertrag. Auf diesen Passus sind sie stolz, denn er beugt vor, falls die beiden Geschäftsführer und Gesellschafter sich einmal nicht mehr so gut verstehen.
Wenn sie sich einmal nicht einigen können oder gar Streit entsteht. Dann, so steht in dem Papier, werde man keinesfalls direkt vor den Kadi ziehen, sondern erst einmal einen unparteiischen Dritten, einen sogenannten Mediator, zu Rate ziehen.„Wir halten beide 50 Prozent der Gesellschafteranteile, da kann es nun einmal zu Patt-Situationen kommen“, erklärt Meier. Und weil solche Situationen der Firma bzw. der Unternehmung nicht schaden sollen, musste das Gründerduo eine Lösung finden – die Mediation.
Killerfaktor Dauerstreit
Bei der Mediation handelt es sich um ein alternatives Konfliktlösungsverfahren, das auf vermittelnden Gesprächen basiert. So soll etwa der Gang vor den Kadi und die damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen abgewendet werden. Zumal Rechtsstreitigkeiten in der Regel lange, oft zu lange dauern. Denn während die Streithähne ihre Energie vor Gericht verpulvern, kocht das Unternehmen auf Sparflamme, wichtige Entscheidungen unterbleiben. Außerdem zerrt ein Prozess derart an den Nerven der Beteiligten, dass das angeknackste Verhältnis zwischen den Streithähnen am Ende meist ganz zerrüttet ist. Auch das zieht negative Konsequenzen für die Firma nach sich, etwa wenn sich ein einst funktionierendes Geschäftsführerduo trennt oder ein wichtiger Geschäftspartner abspringt. Zu dem wirtschaftlichen Schaden kommt hinzu, dass der Ruf ruiniert wird. Am Ende wenden sich Kunden und Mitarbeiter ab. Wenn es richtig schlecht läuft, kann die Firma nach dem Prozess einpacken.
Dieses Risiko können Unternehmen mit Hilfe der Mediation vermeiden. Schließlich geht es hierbei – anders als beim Gerichtsverfahren – nicht darum, um jeden Preis Recht zu bekommen, sondern ganz im Gegenteil darum, zu kooperieren. „Es ist wie mit den Kindern und der Orange“, erklärt Volker Schlehe, Leiter des IHK-MediationsZentrums München die Arbeitsweise: Wenn sich zwei Kinder um eine Orange streiten, würde ein Richter jedem Kind die Hälfte der Frucht zuteilen. Der Mediator aber fragt, was die Kinder mit der Orange machen wollen. „Und dann kommt vielleicht heraus, dass ein Kind den Saft will und das andere die Schale.“
Mobilitätsbudget – das musst du wissen
Eine Wochenkarte für Bus und Bahn, eine kurze Fahrt mit dem E-Roller oder doch lieber das Car-Sharing-Angebot bei schlechtem Wetter? Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden dafür ein Mobilitätsbudget zur Verfügung stellen, sollen bald eine neue Möglichkeit der Pauschalbesteuerung nutzen können. Welche Voraussetzungen dazu erfüllt sein müssen, liest du hier.

Was ist das Mobilitätsbudget?
Das Mobilitätsbudget ist ein Angebot von Unternehmen für ihre Mitarbeitenden, alternative Verkehrsmitteln für privat veranlasste Reisen zu nutzen. Das Unternehmen stellt dafür einen bestimmten Betrag zur Verfügung, die Mitarbeitenden können die Verkehrsangebote je nach aktuellen Bedürfnissen, Verfügbarkeit und persönlichen Präferenzen flexibel miteinander kombinieren. Das Mobilitätsbudget ist damit eine gute Alternative zum privaten Auto oder Dienstwagen.
Was ist jetzt neu?
Im Regierungsentwurf für ein Jahressteuergesetz 2024 wurden die Rahmenbedingungen für ein Mobilitätsbudget definiert und steuerliche Anreize für dessen Nutzung geschaffen. So sollen Unternehmen die Möglichkeit erhalten, den damit verbundenen geldwerten Vorteil für Arbeitnehmende pauschal mit 25 Prozent zu versteuern. Die Regelungen zur Dienstwagenbesteuerung sollen damit nicht verändert werden.
Welche Verkehrsmittel können genutzt werden?
Unternehmen können die Angebotswahl in ihrem Mobilitätsangebot selbst bestimmen. Grundsätzlich können neben ebenfalls steuerlich geförderten Jobtickets auch Budgets für die gelegentliche Inanspruchnahme von Sharing-Angeboten wie E-Roller, Leihräder oder Carsharing-Autos, enthalten sein. Auch Einzelfahrkarten, Zeitkarten und Ermäßigungskarten für den Bus- und Bahnverkehr, also etwa der monatliche Anteil einer BahnCard, können Teil des Mobilitätsbudgets sein.
Was fällt nicht unter das Mobilitätsbudget?
Die dauerhafte und nicht nur gelegentlichen Nutzung von Pkw ist ausgeschlossen. Auf Dauer ausgelegte Mietwagen-, Leasing- oder Abo-Modelle fallen also nicht unter das Mobilitätsbudget. Gleiches gilt für Luftfahrzeuge, Privatwagen der Mitarbeitenden und dauerhaft auch zur privaten Nutzung überlassene Dienstwagen. Wird für die Arbeitnehmenden bereits eine Pauschalbesteuerung für die Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte vorgenommen, kann die Pauschalbesteuerung für ein Mobilitätsbudget nicht dafür in Anspruch genommen werden.
Wer muss das Mobilitätsbudget versteuern?
Grundsätzlich müssen die Mitarbeitenden einen solchen geldwerten Vorteil versteuern. Die Betriebe hingegen müssen entsprechende Sozialversicherungsbeiträge abführen. Werden die Pläne der Regierung umgesetzt und entschließen sich Unternehmen dann das Mobilitätsbudget künftig selbst pauschal mit 25 Prozent zu versteuern, ist dieses beitragsfrei.
Was sind die Voraussetzungen für eine Pauschalbesteuerung?
Die pauschale Versteuerung ist nur zulässig, wenn Betriebe das Mobilitätsbudget zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewähren. Zudem ist die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung auf einen Höchstbetrag von 2.400 Euro im Kalenderjahr begrenzt und kann nicht für bereits pauschal versteuerte Sachbezüge oder Zuschüsse genutzt werden. Die Regelungen sind also nur alternativ anwendbar.
Tipp: Was solltest du jetzt tun?
- Behalte die geplanten Steuerbegünstigungen im Blick!
- Prüfe, ob deine Belegschaft Interesse an einem Mobilitätsbudget als Benefit hat.
- Sprich mit deinem/deiner Steuerberater*in, um zu klären, welche Vor- und Nachteile eine Pauschbesteuerung für dein Unternehmen hat.
Der Autor Andreas Islinger – LL.M. Sozialrecht, Master of Arts in Taxation – ist Partner, Steuerberater und Leiter Rentenberatung und Lohnzentrum bei ECOVIS in München.
Genussrechte – eine bessere Alternative der Mitarbeitendenbeteiligung?
Seit der Verabschiedung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes wird eine bisher wenig beachtete Methode der Mitarbeitendenbeteiligung für Jungunternehmen interessant: Genussrechte. Warum es sich lohnt, diese Alternative genauer zu betrachten.
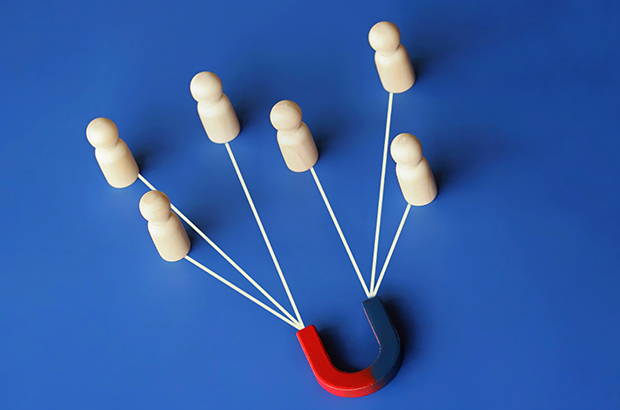
Beteiligungen für Mitarbeitende sind für junge Unternehmen essentiell, um auf dem Arbeitsmarkt um die besten Talente konkurrieren zu können. Arbeitnehmende müssen sich dank gut ausgestalteter Beteiligungsprogramme nicht mehr zwischen lukrativem Gehalt und innovativem Arbeitgebenden entscheiden – wovon insbesondere Start-ups profitieren.
Die technische Umsetzung eines Beteiligungsprogramms für Mitarbeitende kann auf unterschiedliche Arten und Weisen erfolgen. Aktuell sind in Deutschland Virtual Stock Option Plans (VSOPs) die gängige Form in der Praxis. Doch seit der Verabschiedung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes wird eine weitere – bisher wenig beachtete – Methode für Jungunternehmen interessant: Genussrechte. Doch welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben Genussrechte und VSOPs und warum lohnt es sich, diese Alternative genauer zu betrachten?
Virtuelle Beteiligung
Im deutschen Venture Capital-Markt werden Mitarbeitendenbeteiligungen typischerweise durch virtuelle Anteile abgebildet (VSOPs). Mitarbeiter*innen werden dabei wirtschaftlich so gestellt, als hätten sie eine echte (gesellschaftsrechtliche) Beteiligung am Unternehmen erhalten. Allerdings erhalten Beschäftigte bei VSOPs nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen das Unternehmen. Das bedeutet, dass sie im Falle eines Exits eine Sonderzahlung erhalten. Dabei ist der Strukturierungs- und Verwaltungsaufwand gering, da Unternehmen zur vertraglichen Beteiligung in der Regel auf standardisierte Verträge zurückgreifen können. Da keine Gesellschaftsanteile übertragen werden, gelangen keine Mitarbeiter*innen in das Cap Table und der Gang zum Notariat bleibt erspart. Nachteilig sind hingegen die steuerlichen Konsequenzen für die Mitarbeitenden: Bei entsprechender Ausgestaltung kommt es zwar zum Zeitpunkt der Ausgabe der virtuellen Beteiligung nicht zu einer Besteuerung der Mitarbeiter*innen. Allerdings unterliegt der Erlös dann bei Zahlung der normalen Lohnversteuerung mit einem Spitzensteuersatz von 45 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.
Genussrechte als Alternative?
Aufgrund aktueller steuerlicher Gesetzesänderungen rückt eine andere Gestaltungsmöglichkeit (wieder) in den Fokus: eigenkapitalähnliche Genussrechte. Im Folgenden werfen wir einen detaillierten Blick auf das Beteiligungsmodell.
Ausgestaltung
Genussrechte können inhaltlich annähernd genauso flexibel ausgestaltet werden wie VSOPs und stellen aus juristischer Sicht ebenfalls keine reale Beteiligung dar, sondern nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen das Unternehmen auf die Beteiligung am Gewinn. Aber auch eine Teilhabe am klassischen Exit-Erlös kann vereinbart werden. Bei der Ausgabe der Genussrechte leistet der Arbeitnehmende entweder eine Kapitaleinlage oder er erhält das Genussrecht schlicht unentgeltlich/verbilligt. Genussrechte können vom Arbeitgeber zu einem beliebigen Nennwert ausgegeben werden und eine Teilhabe am Gewinn und/ oder einem Liquidations-/Exiterlös mit oder ohne Verzinsung sowie mit oder ohne Verlustbeteiligung vermitteln.
Aufwand und praktische Umsetzung
Verträge für Genussrechte können für nahezu jede Gesellschaft maßgeschneidert gestaltet werden. Die Ausgabe obliegt – wie auch bei VSOPs – grundsätzlich der Geschäftsführung. In der Praxis sollte bei der Ausgabe ein entsprechender Gesellschafterbeschluss die Geschäftsführungsmaßnahme flankieren, um mögliche Streitigkeiten in Bezug auf die Wirksamkeit der Maßnahme vorzubeugen. Oftmals ist dies aufgrund von satzungsrechtlichen Zustimmungsvorbehalten ohnehin notwendig.
Der Beteiligungs- und Verwaltungsaufwand ist gering, da Unternehmen – wie bei den VSOPs – auf standardisierte Verträge zurückgreifen können. Formerfordernisse sind nicht gegeben und ein Gang zum Notar ist ebenfalls nicht notwendig.
Die für Mitarbeitendenbeteiligungen üblichen Vesting- bzw. Leaver-Regelungen unterscheiden sich bei den Genussrechten von den VSOPs kaum. Ein Augenmerk sollte bei einem Verfall aufgrund eines Leaver-Events auf die Rückübertragung von Genussrechten an den Arbeitgebenden gelegt werden. Dies sollte im Beteiligungsprogramm geregelt werden.
Steuerliche Vorteile der Genussrechte
Die Gewährung von Genussrechten (wie auch von echten Anteilen) führte bislang zum Zeitpunkt der Zuteilung zu einer lohnsteuerpflichtigen Sachzuwendung in Höhe des Marktwerts der gewährten Beteiligung, auch wenn noch kein Exit-Erlös erzielt wurde (Dry-Income-Problematik). Dafür profitieren echte Anteile sowie Genussrechte von einem linearen Steuertarif für Kapitaleinkünfte mit einem maximalen Steuersatz von 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer (§ 32d EStG).
Zukunftsfinanzierungsgesetz – Steuerliche Begünstigung von Genussrechten
Mit Inkrafttreten des Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) am 1. Januar 2024 hat der Gesetzgeber die Regelungen des § 19a EStG überarbeitet, um die genannte Dry-Income-Problematik zu mildern und um Beteiligungen für Mitarbeitende im Venture Capital-Bereich attraktiver zu machen. Die Vorschrift findet sowohl auf echte Anteile wie auch auf Genussrechte Anwendung.
Eine Dry-Income-Problematik besteht zwar bei VSOPs nicht, denn die Lohnsteuerpflicht fällt bei entsprechender Strukturierung bei VSOPs erst zum Zeitpunkt eines Exits in Höhe des individuellen (progressiven) Steuersatzes mit maximal 45 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer an. Der lineare Steuertarif für Kapitaleinkünfte (max. 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) auf etwaige Wertzuwächse findet im Rahmen der VSOPs jedoch gerade keine Anwendung – im Gegensatz zu eigenkapitalähnlich ausgestalteten Genussrechten. Damit können Genussrechte bei entsprechender Ausgestaltung das „Beste aus beiden Welten“ vereinen: Einen Besteuerungsaufschub im Rahmen der Lohnsteuer für die unentgeltliche/verbilligte Einräumung des Genussrechts und einen niedrigen Steuertarif für Kapitaleinkünfte bei der Realisierung des Wertzuwachses beim Exit. Sollte der Wert des Genussrechts dann niedriger sein als zum Zeitpunkt der Gewährung, ist für die aufgeschobene Lohnsteuer dann auch nur der niedrigere Wert maßgebend.
Bedingungen für den Besteuerungsaufschub
Der Besteuerungsaufschub für etwaig anfallende Lohnsteuer im Zusammenhang mit der unentgeltlichen/verbilligten Einräumung wird unter bestimmten Voraussetzungen gewährt: Zu diesen zählt, dass eine qualifizierte Unternehmensbeteiligung vom Arbeitgebenden zusätzlich zum regulären Arbeitslohn unentgeltlich oder vergünstigt am Unternehmen eingeräumt wird (keine bloße Entgeltumwandlung), die Gründung des Unternehmens nicht länger als 20 Jahre zurückliegt und das Unternehmen zum Zeitpunkt der Einräumung des Genussrechts einen Jahresumsatz von EUR 100 Mio. oder eine Jahresbilanzsumme von EUR 86 Mio. nicht überschreitet sowie nicht mehr als 1.000 Mitarbeitende hat.
Dies stellt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der eigenkapitalähnlichen Genussrechte gegenüber den VSOPs dar. Denn eine Beteiligung über virtuelle Anteile an einem Unternehmen gilt gerade nicht als Vermögensbeteiligung im Sinne des § 19a EstG i.V.m. dem 5. VermBG und profitiert somit – anders als die Genussrechte – nicht von der Begünstigung des § 19a EStG.
Der Besteuerungsaufschub endet nach § 19a EStG erst, wenn entweder das Genussrecht ganz oder teilweise entgeltlich oder unentgeltlich übertragen wird (Exit) oder das Dienstverhältnis beendet wird, spätestens aber nach 15 Jahre. Sofern das Unternehmen gegenüber dem Finanzamt unwiderruflich erklärt, im Exit-Fall für die Lohnsteuer zu haften, endet der Besteuerungsaufschub auch nicht beim Wechsel des Arbeitgebenden oder spätestens nach 15 Jahren, sondern tatsächlich erst beim Exit.
Fazit
Für die Einführung eines Beteiligungsprogramms für Mitarbeitende in Form von eigenkapitalähnlichen Genussrechten bzw. die Umstellung eines bestehenden virtuellen Mitarbeitendenbeteiligungsprogramms (VSOP) auf eigenkapitalähnliche Genussrechte sprechen steuerrechtliche Vorteile. Dazu zählt insbesondere der Besteuerungsaufschub für etwaig anfallende Lohnsteuer im Zusammenhang mit der unentgeltlichen/ verbilligten Einräumung und die Anwendung des linearen Steuersatzes für Kapitaleinkünfte auf etwaige Wertzuwächse. Hierdurch bekommen Start-ups im umkämpften Arbeitsmarkt um die besten Talente starke Argumente im Vergleich zur Konkurrenz.
Allerdings sollten sich Unternehmer*innen durch eine fachkundige Beratung absichern, um Risiken von eigenkapitalähnlichen Genussrechten vorzubeugen. Dazu zählen insbesondere die saubere Strukturierung zur Einhaltung der steuerlichen Erfordernisse sowie die Abwägung mit alternativen Modellen, insbesondere virtuelle und reale Beteiligungsmodelle für Mitarbeitende.
Die Autoren:
Dr. Andreas Demleitner ist Rechtsanwalt & Steuerberater im Bereich Corporate Tax bei PwC und berät als Partner sowohl Start-ups als auch Investor*innen im Venture Capital-Umfeld mit den Schwerpunkten Durchführung von Finanzrunden und Implementierung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen, Andreas.demleitner@pwc.com
Dr. Minkus Fischer, EMBA, ist Local Partner bei PwC Legal im Bereich Legal Deals im Stuttgarter Büro. Er berät seit über zehn Jahren in den Bereichen Corporate/M&A, mit einem Schwerpunkt in Venture Capital-Transaktionen, Minkus.fischer@pwc.com
Stolperstein Verpackungsgesetz
Wer Verpackungen in den Umlauf bringt, muss sich laut Gesetzgeber im Anschluss finanziell an deren Verwertung beteiligen. Wir zeigen, was E-Commerce-Gründer*innen beachten sollten, um rechtssicher zu agieren.

Wer Verpackungen in den Umlauf bringt, muss sich laut Gesetzgeber im Anschluss finanziell an deren Verwertung beteiligen. Das betrifft insbesondere Gründer*innen im E-Commerce, deren Waren in den meisten Fällen per Paketdienst oder Spedition zugestellt werden. Denn das Verpackungsgesetz, das am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, gilt für die meisten Unternehmer*innen, die mit Ware befüllte und beim Endverbrauchenden anfallende Verpackungen inklusive Füllmaterial in Verkehr bringen. Vielen Gründer*innen ist nicht bewusst, dass sie als Onlinehändler*in vom Prinzip der erweiterten Produktverantwortung betroffen sind. Und das bedeutet konkret, dass sie für die Rücknahme und Verwertung zu sorgen haben.
Konkret statt abstrakt
Besteht Unsicherheit, ob ein Unternehmen ein sogenannter Erstinverkehrbringer ist, sind ein paar einfache Fragen zu beantworten. Zunächst einmal muss geklärt sein, ob die Ware von einem anderen Händler erhalten oder zuerst in den Umlauf gebracht wurde. Dann gilt es herauszufinden, ob die Verpackung systembeteiligungspflichtig ist und ob sie als Müll beim Endverbraucher anfällt. Zu den systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gehören sowohl Um- und Verkaufsverpackungen als auch Packstoffe und Packmittel. Das umfasst Kartonagen genauso wie beispielsweise Stretchfolie. Aber auch Glas, Kunststoffe und Naturmaterialien zählen dazu. In der Praxis ist oftmals zu sehen, dass sich Gründer*innen mit der Definition des Begriffs Endverbraucher*in schwertun. In diesem konkreten Fall sind damit nicht ausschließlich Privathaushalte gemeint, der Gesetzgeber schließt auch sogenannte vergleichbare Anfallstellen mit ein. Dazu können beispielsweise Gastronomiebetriebe zählen, wenn sie ein bestimmtes Volumen an Müll nicht überschreiten. Fallen Händler*innen unter das Verpackungsgesetz, steht vor dem ersten Versand die Pflicht zur Registrierung bei der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister LUCID. Im Anschluss muss die Lizensierung durch ein duales System erfolgen. Beim Überschreiten von bestimmten Mengen schreibt der Gesetzgeber zudem eine Vollständigkeitserklärung gemäß Verpackungsgesetz vor.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht
Erfahrungsgemäß verstehen einige Unternehmen die Nichteinhaltung des Gesetzes als eine Art Kavaliersdelikt. Dabei gilt es zu bedenken, dass es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die nach § 34 Abs. 1 und Abs. 2 VerpackG mit einer Geldbuße von bis zu 200.000 Euro geahndet werden kann. Da der Gesetzgeber keine Unterschiede bei der Unternehmensgröße macht, betrifft das Großhändler*innen genauso wie Kleinunternehmen. Um Gründer*innen Support bei der Erfüllung des Verpackungsgesetzes zu geben, hilft ein(e) verlässliche(r) Partner*in, der/die weiß, wie das optimale Vorgehen ist und Tipps bei der Umsetzung geben kann.
Der Autor Jens Mühlenbruch ist Verantwortlicher für Projekt- und Vertriebsentwicklung bei der BB-Verpackungen GmbH in Stuhr.
Der Beteiligungsvertrag
Recht für Gründer*innen: Wir zeigen die wesentlichen Themen und Standards eines Beteiligungsvertrags.

Soweit Investor*innen im Rahmen einer Finanzierungsrunde Eigenkapital zur Verfügung stellen, werden die Terms üblicherweise im Rahmen eines Beteiligungsvertrages vereinbart. Strukturell umfasst ein Beteiligungsvertrag eine Beteiligungs- und Gesellschaftervereinbarung (Investment and Shareholders Agreement). Die Beteiligungsvereinbarung beinhaltet die Struktur und die Konditionen des Investments, wohingegen die Gesellschaftervereinbarung die gegenseitigen Rechte und Pflichten der künftigen Gesellschafter*innen sowie das Verhältnis zur Gesellschaft definiert.
Beteiligungsvereinbarung
Regelmäßig werden die durch die Investor*innen zu übernehmenden Geschäftsanteile im Rahmen einer Bar-Kapitalerhöhung neu ausgegeben. Die Beteiligungsvereinbarung beinhaltet die wesentlichen Konditionen der Beteiligung und der hierfür zu erbringenden Gegenleistung ausgehend von der (im Rahmen eines Cap Table) festgelegten Pre-Money-Bewertung.
Die Gegenleistung der Investor*innen besteht zunächst aus dem unmittelbar zu leistenden Nominalwert. Als weitere Leistungen werden Zuzahlungen in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB, die Einbringung von Darlehensforderungen (soweit Wandeldarlehen gewandelt werden sollen), Sachleistungen (häufig bei strategischen Investor*innen) oder sonstige Leistungen vereinbart. Die Leistungspflichten können hierbei von sog. Milestones abhängig sein, mithin von bestimmten durch das Start-up zu erreichenden Zielen. Zur Vermeidung von Konflikten sind eine klare Beschreibung der Ziele und ein Konfliktlösungsmechanismus sinnvoll. Aus Sicht der Gründenden, aber auch der weiteren Gesellschafter*innen, ist ferner ein Mechanismus wichtig für den Fall, dass ein Investor seine Leistungsverpflichtung nicht (vollständig) erfüllt. Eine solche Investor-Default-Klausel sieht regelmäßig die Rückübertragung der übernommenen Anteile durch den betroffenen Investor für den Fall seiner Nichtleistung vor.
Beteiligungsvereinbarungen enthalten zudem regelmäßig eine Verwässerungsschutzklausel. Diese räumt den Investor*innen das Recht ein, weitere neu auszugebende Geschäftsanteile zum Nominalwert zu übernehmen, falls in einer späteren Finanzierungsrunde Anteile an der Gesellschaft zu einem geringeren Anteilspreis als dem der gegenwärtigen Finanzierungsrunde ausgegeben werden (sog. Downround). Die Anzahl der zusätzlich auszugebenden Geschäftsanteile berechnet sich auf Grundlage der Ausgabepreise der betreffenden Finanzierungsrunden.
Häufig wird eine Weighted-Average-Betrachtung vereinbart, bei der der gewichtete Durchschnittspreis aus dem Anteilspreis der Downround und der ursprünglichen Finanzierungsrunde gebildet wird. Die Investor*innen werden nachträglich so gestellt, als hätten sie zwar nicht zum
Anteilspreis der Downround gezeichnet (dies wäre ein recht investorenfreundlicher Full-Ratchet-Verwässerungsschutz), aber zu dem entsprechend definierten Durchschnittspreis.
Wichtig in der Beteiligungsvereinbarung sind ferner die dort beinhalteten Garantieregelungen und deren Rechtsfolgen. Hierbei zu unterscheiden sind sog. Title-Garantien, die insbesondere das Bestehen des gesellschaftsrechtlichen Status der Gesellschaft und der Geschäftsanteile betreffen, von den Business- und/oder Company-Garantien, die den (auch operativen) Status der Gesellschaft umfassen. Abhängig vom Zuschnitt des Geschäftsbetriebs und dem Sicherungsinteresse des/der Investor*in werden die operativen Themen häufig umfassend in einem Garantiekatalog abgebildet. Im Gegensatz zu Exit-Transaktionen sind Freistellungen für Themen aus einer Due Diligence grundsätzlich nicht gebräuchlich, hier können aber sog. Post-Closing-Conditions verlangt sein, durch die den Gründenden Pflichten nach Signing auferlegt werden, um bestehende rechtliche Themen zu lösen.
Gebräuchlich sind Haftungs-Cap, etwa in Höhe des Gesamtinvestments des/der betreffenden Investor*in und/oder der betreffenden Finanzierungsrunde. Für die persönliche Haftung der Gründenden (soweit etwa bei einem Early-Stage-Investment vereinbart) wird häufig auf einen Cap in der Größenordnung eines Jahresgehalts der Gründenden zurückgegriffen. Die beste Absicherung der Gründenden ist jedoch eine gewissenhafte Offenlegung der Themen gegenüber dem/der Investor*in, da die Kenntnis der Investor*innen von einem Sachverhalt einen Garantieverstoß auf dieser Grundlage ausschließt. Im Sinne der Vermeidung von Konflikten empfiehlt es sich, die Art der Offenlegung in der Beteiligungsvereinbarung zu referenzieren, etwa unter Bezugnahme auf den dokumentierten Status eines Datenraums.
Gesellschaftervereinbarung
Die Gesellschaftervereinbarung regelt im Wesentlichen die Rechte und Pflichten der Gesellschafter*innen untereinander und gegenüber der Gesellschaft. Regelmäßig unterliegen die Geschäftsanteile bestimmten Verfügungsbeschränkungen, die festlegen, ob und in welchem Umfang diese übertragen und/oder belastet werden dürfen. Die Gründenden werden häufig für einen definierten Zeitraum generell daran gehindert sein, über ihre Anteile ohne Zustimmung der Investor*innen zu verfügen (sog. Lock Up). Üblich ist zudem die Vereinbarung eines Vorerwerbsrechtes (Right of First Refusal) und eines Mitverkaufsrechts (Tag-Along). Umgekehrt sind (Minderheits-)Gesellschafter*innen beim Vorliegen bestimmter weiterer Bedingungen auf Verlangen regelmäßig verpflichtet, ihre Beteiligung an einen Dritten mitzuveräußern (Mitverkaufspflicht bzw. Drag-Along).
Mittels der sog. Liquidationspräferenz (Liquidation Preference) erhalten die Investor*innen im Rahmen eines Erlösereignisses, insbesondere eines Exits, vorrangig ihre Investitionssumme. Marktüblich ist hier derzeit ein Vorzug in Höhe des 1,0-Fachen des getätigten Investments. Verbleibende Erlöse werden anteilig auf alle Gesellschafter*innen verteilt, wobei sich die Investoren den Erlösvorzug anrechnen lassen müssen (Non-Participating-Liquidation-Preference).
Für Gründende wesentlich ist die Regelung zum Vesting. Diese legt fest, welche Konsequenzen das Ausscheiden eines Gründenden aus seiner Tätigkeit bei der Gesellschaft auf seine Beteiligung hat. Anknüpfend an ein bestehendes Beschäftigungsverhältnis (i.d.R. Geschäftsführeranstellungsvertrag) werden bestimmte Ausscheidensszenarien in sogenannte Good-Leaver- und Bad-Leaver-Fälle aufgeteilt. Da das selbstverschuldete Ausscheiden eines Gründenden sanktioniert werden soll, muss dieser in Bad-Leaver-Fällen (i.d.R. Kündigung durch die Gesellschaft aus wichtigem Grund gemäß § 626 BGB; Straftaten gegenüber der Gesellschaft) sämtliche Anteile zum Nominalwert abgeben. In Good-Leaver-Fällen wird er, abhängig von der Dauer der Zugehörigkeit zur Gesellschaft, einen Teil seiner Anteile behalten dürften (die „gevesteten“ Anteile). Mitunter sind diese treuhänderisch auf einen anderen Gesellschafter zu übertragen.
Ferner werden in der Gesellschaftervereinbarung Regelungen zur Corporate Governance und zum Wettbewerbsverbot enthalten sein. Mitsprache- und Informationsrechte stellen sicher, dass die Investor*innen bzw. die Investor*innenmehrheit bei bestimmten Grundsatzentscheidungen, ein Mitspracherecht erhält. Üblich sind Zustimmungsvorbehalte, im Einzelfall die Einrichtung eines Beirats und regelmäßig die Verabschiedung einer Geschäftsordnung für die Geschäftsführung.
Fazit
Ein Beteiligungsvertrag beinhaltet überwiegend Standardregelungen, wobei sich im Detail gründer*innen-/oder investor*innenfreundliche Ausgestaltungen zeigen. Bei den Verhandlungen über die Ausgestaltung dieser Regelungen ist im Einzelfall ein Ausgleich zu finden zwischen dem (Sicherungs-)Interesse der Investor*innen und den Interessen der Gründenden.
Die Autoren:
Alexander Weber, LL.M. ist Rechtsanwalt und Partner bei Heuking Kühn Lüer Wojtek in München.
Roman Ettl-Steger, LL.M. (King’s College London) ist Senior Associate im Bereich Venture Capital am Münchner Standort derselben Kanzlei, www.heuking.de



