Aktuelle Events
Plattformökonomie – Trend oder Zukunft?
Die Plattformökonomie hat die Art und Weise, wie Märkte funktionieren, grundlegend verändert und bietet damit insbesondere Start-ups enorme Chancen, aber auch Herausforderungen.

Die Plattformökonomie hat sich in den letzten Jahren zu einem der zentralen Geschäftsmodelle der digitalen Welt entwickelt. Sie beeinflusst, wie wir arbeiten, konsumieren und miteinander interagieren. Von globalen Marktführern wie Amazon, Airbnb und Uber bis hin zu spezialisierten Plattformen, die Nischenmärkte bedienen – die Vielfalt an Plattformtypen ist beeindruckend. Neben den bekannten Handels- und Dienstleistungsplattformen gibt es viele lokale Suchseiten wie Yelp, Lieferando oder TripAdvisor, die regionale Angebote zugänglicher machen und sich oft auch auf bestimmte Regionen wie z.B. Ostdeutschland fokussieren. Soziale Plattformen wie Instagram oder LinkedIn schaffen Räume für Kommunikation, Selbstdarstellung und berufliche Netzwerke, während spezialisierte Plattformen wie Kickstarter Crowdfunding erleichtern. Die zentrale Frage lautet jedoch: Ist die Plattformökonomie ein vorübergehender Trend oder die Zukunft der Wirtschaft? Ein genauer Blick auf die Funktionsweise, Chancen und Risiken gibt Aufschluss.
Was macht Plattformen so mächtig?
Im Kern sind Plattformen digitale Vermittler, die Anbieter und Nachfrager zusammenbringen. Anders als klassische Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen selbst herstellen, konzentrieren sich Plattformen darauf, ein Ökosystem zu schaffen, in dem andere Akteure aktiv werden können. Das Besondere an diesem Modell ist seine Skalierbarkeit. Plattformen profitieren von Netzwerkeffekten: Je mehr Nutzer eine Plattform hat, desto attraktiver wird sie für neue Teilnehmer. Dies führt zu einem starken Wachstum, das vielen Plattformen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Effizienz. Plattformen reduzieren Transaktionskosten und machen Märkte transparenter. Ein Beispiel ist Airbnb: Anstatt bei einem Hotelanbieter zu buchen, können Nutzer mit nur wenigen Klicks Angebote von Privatanbietern weltweit vergleichen. Gleichzeitig ermöglicht die Plattform Einzelpersonen, Einnahmen durch ungenutzte Ressourcen wie freie Zimmer zu generieren.
Die Vielfalt der Plattformökonomie
Die Plattformökonomie zeigt sich in unterschiedlichsten Formen und Branchen. Handelsplattformen wie Amazon, eBay oder Etsy ermöglichen den Kauf und Verkauf von Produkten. Dienstleistungsplattformen wie Uber oder TaskRabbit verbinden Kunden mit Anbietern spezifischer Dienstleistungen. Lokale Suchseiten wie Lieferando oder Yelp fokussieren sich auf regionale Angebote, von Restaurantbewertungen bis zur Essenslieferung. Darüber hinaus gibt es soziale Plattformen wie Facebook und LinkedIn, die auf den Austausch von Informationen und Netzwerken abzielen, sowie Content-Plattformen wie YouTube oder TikTok, die Nutzern ermöglichen, Inhalte zu erstellen und zu teilen.
Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter und GoFundMe haben wiederum völlig neue Möglichkeiten geschaffen, Projekte zu finanzieren, während spezialisierte Plattformen wie Upwork oder Fiverr Freiberuflern Zugang zu einem globalen Arbeitsmarkt bieten. Diese Vielfalt zeigt, dass die Plattformökonomie nicht auf bestimmte Branchen beschränkt ist, sondern nahezu jeden Bereich der Wirtschaft beeinflusst.
Vorteile der Plattformökonomie
Die Plattformökonomie bietet zahlreiche Vorteile. Für Konsumenten bedeutet sie Bequemlichkeit, größere Auswahl und niedrigere Preise. Statt sich auf lokale Anbieter zu beschränken, haben Nutzer Zugang zu einem globalen Markt. Plattformen bieten zudem Transparenz durch Bewertungen, Rankings und Empfehlungen, die das Vertrauen stärken und die Entscheidungsfindung erleichtern.
Für Anbieter eröffnen Plattformen neue Märkte. Selbst kleine Unternehmen oder Einzelpersonen können über Plattformen wie Etsy oder eBay Kunden weltweit erreichen. Zudem sind die Einstiegshürden oft gering: Viele Plattformen erfordern keine hohen Investitionen, um mitzumachen, was sie auch für kleine Akteure attraktiv macht.
Auch in Bezug auf Innovation ist die Plattformökonomie wegweisend. Sie schafft nicht nur neue stabile und nachhaltige Geschäftsmöglichkeiten, sondern verändert auch etablierte Branchen. Die Sharing Economy, die durch Plattformen wie Airbnb und Uber populär wurde, ist ein gutes Beispiel dafür. Indem sie ungenutzte Ressourcen wie Wohnraum oder Fahrzeuge nutzbar macht, hat sie traditionelle Geschäftsmodelle disruptiert und neue Einkommensquellen erschlossen.
Die Kehrseite der Medaille
Trotz ihrer Vorteile hat die Plattformökonomie auch erhebliche Nachteile. Einer der größten Kritikpunkte ist die Tendenz zur Monopolbildung. Plattformen profitieren von Netzwerkeffekten, die es neuen Wettbewerbern erschweren, in den Markt einzutreten. Amazon, Google oder Facebook sind Beispiele für Unternehmen, die ihre Marktposition so stark ausgebaut haben, dass sie oft als „Gatekeeper“ agieren. Dies führt zu einer Konzentration von Macht und birgt Risiken für Innovation und Wettbewerb.
Auch die Arbeitsbedingungen in der Plattformökonomie stehen häufig in der Kritik. Gig-Economy-Plattformen wie Uber oder Deliveroo bieten flexible Arbeitsmodelle, doch diese gehen oft mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen einher. Plattformarbeiter haben in der Regel keinen Zugang zu sozialen Sicherungssystemen, wie Krankenversicherung oder Altersvorsorge, und sind stark von den Bedingungen der Plattform abhängig.
Datenschutz ist ein weiteres Problem. Plattformen sammeln riesige Mengen an Daten, um ihre Dienste zu verbessern und Nutzer besser zu verstehen. Doch dies führt zu berechtigten Sorgen hinsichtlich der Privatsphäre und der möglichen Missbrauchsmöglichkeiten dieser Daten.
Regulierung als Schlüsselfrage
Die Herausforderungen der Plattformökonomie haben politische Debatten über die Notwendigkeit von Regulierung angestoßen. Viele Länder arbeiten an Gesetzen, die faire Arbeitsbedingungen für Plattformarbeiter gewährleisten und Wettbewerb schützen sollen. Ein Beispiel dafür ist die Diskussion über die Einstufung von Gig-Economy-Arbeitern als Angestellte oder Selbstständige, die weitreichende Auswirkungen auf Arbeitsrecht und Steuerpflichten hat.
Ein weiteres Thema ist die Kontrolle über den Zugang zu digitalen Märkten. Plattformen, die als Gatekeeper agieren, können den Marktzugang für Konkurrenten erschweren. Regulierungsbehörden stehen vor der Herausforderung, Innovation zu fördern, ohne bestehende Unternehmen übermäßig zu beschränken.
Plattformökonomie und Nachhaltigkeit
Ein weiterer Aspekt, der in den Fokus rückt, ist die Nachhaltigkeit der Plattformökonomie. Plattformen haben das Potenzial, nachhaltige Praktiken zu fördern, etwa durch die Sharing Economy, die Ressourcen effizienter nutzt. Doch sie können auch negative Auswirkungen haben. Die Förderung von Massenkonsum, etwa durch schnelle Lieferdienste, kann ökologische Folgen haben. Start-ups, die in der Plattformökonomie aktiv sind, sollten daher nicht nur auf Skalierbarkeit, sondern auch auf ökologische und soziale Verantwortung achten.
Wo geht es hin?
Die Plattformökonomie ist weit mehr als nur ein Trend. Sie hat die Art und Weise, wie Märkte funktionieren, grundlegend verändert und wird auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Ihre Bedeutung wird weiter zunehmen, da digitale Technologien immer mehr Lebensbereiche durchdringen. Doch damit die Plattformökonomie nachhaltig und fair bleibt, müssen sowohl Unternehmen als auch Regierungen Verantwortung übernehmen.
Für Start-ups bietet die Plattformökonomie enorme Chancen, aber auch Herausforderungen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Fähigkeit, innovative, skalierbare Geschäftsmodelle zu entwickeln, die nicht nur wirtschaftlich erfolgreich, sondern auch sozial und ökologisch verantwortungsvoll sind. Die Plattformökonomie ist nicht nur die Gegenwart, sondern die Zukunft – allerdings eine, die klug gestaltet werden muss.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Kein CEO mehr, und nun?
Sie haben ihre Start-ups nach Jahren intensiver Aufbauarbeit verlassen, sind als CEO aus der ersten Reihe getreten, um Platz für Neues zu machen: Vier Gründer*innen berichten, was das mit ihnen gemacht hat und wie sie damit umgegangen sind.

Als Start-up-Gründer*in wird es früher oder später passieren: Nachdem man jahrelang ein Unternehmen aufgebaut hat, wird der Zeitpunkt kommen, an dem man loslassen und Platz für Neues schaffen muss. So erging es auch den beiden Gründerinnen Mahdis Gharaei und Tanja Sternbauer von the female factor. „Als wir gegründet haben, haben wir eigentlich schon besprochen, wie lange wir das operativ machen wollen und wann wir in die strategische Richtung gehen“, erzählt Gharaei.
Über fünf Jahre widmeten sie sich mit ihrer Female-Leadership-Plattform der Mission, die weltweite Community von weiblichen Führungskräften zu stärken. „Wir haben uns am Anfang drei Jahre gegeben. Life happens: Pandemie, Krieg – es kamen immer wieder Dinge, wo wir gesagt haben, es braucht uns noch“, erinnert sich die ehemalige CEO. Doch 2023 kam schließlich der Moment, in dem es beiden klar war: „Wir saßen zusammen und wussten irgendwie: Es wird Zeit“, so Sternbauer weiter.
Auch beim Kinderfahrrad-Scale-up woom war von Anfang an abgesprochen, dass sich die Gründer früher oder später aus dem operativen Geschäft zurückziehen. „Es war uns beiden immer klar, dass wir das nicht für immer und ewig machen können“, sagt Co-Founder Christian Bezdeka. „Wir sind nur für eine gewisse Phase des Unternehmens gut, weil wir ganz klar die Start-up-Typen sind.“ Nach fast neun Jahren übergaben sie das Unternehmen 2022 an einen neuen CEO. „Diese Entscheidung passiert nicht über Nacht. Es ist so ein Gefühl, das man hat“, schildert Co-Founder Marcus Ihlenfeld.
Emotionen und Leere
„Emotional“: So beschreibt Gharaei das Gefühl, als the female factor öffentlich machte, dass sie und Sternbauer ihre Rolle als CEO abgeben. „Ich kann mich an den Moment erinnern, als wir die Pressemitteilung ausgeschickt haben. Ich war gerade auf Bali, weil ich mir eine Auszeit gönnen wollte. Ich saß in diesem Moment in einem Taxi und habe einfach angefangen zu weinen. Ich wusste, dass es passiert, und es war dennoch emotional. Ich dachte: Wer bin ich jetzt und was mache ich jetzt?“, erinnert sie sich. Diese Leere können auch die woom-Gründer gut nachvollziehen: „Wir haben es keine Sekunde bereut, den Schritt gemacht zu haben. Trotzdem ging es uns nicht gut. Das hatte damit zu tun, dass dann eine große Leere gekommen ist“, erzählt Bezdeka.

Nachfolge intern oder extern?
Emotional kann man sich auf den Moment, in dem man sein eigenes Unternehmen in andere Hände legt, kaum vorbereiten. Umso wichtiger war es den the-female-factor-Gründerinnen, das Unternehmen strukturiert auf diesen Übergang vorzubereiten. „Wir haben das über ein Jahr lang geplant. In diesem Jahr haben wir nach und nach immer mehr Aufgaben abgegeben“, so Sternbauer. Schon früh zeichnete sich ab, dass zwei interne Mitarbeiterinnen die Nachfolge antreten würden. „Sie sind bei uns von intern zu VP zu C-Level aufgestiegen. Sie sind die komplette Career Journey mit the female factor gegangen“, sagt die Co-Founderin. Weil Lisa Ambros und Olena Kondratenko zuvor noch keine Führungsrolle übernommen hatten, war es den Gründerinnen besonders wichtig, sie gemeinsam mit einer Leadership-Coachin auf ihre neue Verantwortung vorzubereiten.
Eine externe Lösung stand dabei nie ernsthaft zur Debatte. „Für mich wäre es schwierig gewesen, einer externen Person zu 1000 Prozent zu vertrauen. Lisa und Olena kennen wir schon seit fünf Jahren und wissen, wie sie in gewissen Situationen reagieren. Wir kennen ihr Wertesystem, und für mich ist ein hundertprozentiges Vertrauen da“, erklärt Gharae. „Die zwei sind perfekt für die Aufgabe. Die machen es in vielen Bereichen noch viel besser als wir.“
Auch bei woom fiel die Wahl zunächst auf eine interne Nachfolge: Paul Fattinger, bereits zwei Jahre im Unternehmen, übernahm im Oktober 2022 die CEO-Rolle und übergab sie zwei Jahre später an eine externe Führungskraft, den heutigen CEO Bernd Hake. Fattinger habe woom „nach vier intensiven Jahren im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen“, erklären die Gründer. „Unter seiner Führung hat sich woom vom Start-up zum Scale-up entwickelt und entscheidende Meilensteine erreicht. Paul hat woom durch eine herausfordernde Phase geführt und ein starkes Fundament gelegt, auf das Bernd nun aufbauen kann.“
Mit dem Wechsel wollten die Gründer neue Impulse setzen und gezielt Führungserfahrung für die nächste Phase der globalen Skalierung ins Unternehmen holen. Ganz nach ihrem Motto: „Jeder CEO zu seiner Zeit.“ „Unser Ziel war es immer, uns mit Menschen zu umgeben, von denen wir lernen können – auch wenn das bedeutet, nicht der Klügste im Raum zu sein“, sagt Bezdeka. „Wir können sehr gut mit Chaos, aber diese Strukturen dann auszubauen ist dann nicht mehr so spannend für uns.“ Das Gründerduo suchte gezielt nach einem CEO, der nicht nur führt, sondern langfristig Strukturen schafft. „Für uns war es wichtig, jemanden an Bord zu holen, der Dinge bis zum Schluss durchdenkt. Wir sind eher die, die mal schnell eine Entscheidung treffen“, so Ihlenfeld. „Die passende Nachfolge zu finden war kein geradliniger Weg – es gab einige Lernschritte auf dem Weg dorthin.“
Neue Chancen
Warum also geht man diesen Schritt als Gründer*in und lässt das eigene Unternehmen, in das man jahrelang Zeit, Kraft und Leidenschaft gesteckt hat, weiterziehen? „Wir haben gemerkt, dass es nicht mehr unsere Berufung und unser Traum war. Es hat uns echt sehr viel Energie gekostet“, erklärt Bezdeka. „Der logische Schluss ist, zu gehen. Dann kommen andere, die genau für diese Unternehmensphase geeignet sind – und viel besser sind als man selbst.“
Dass es oft genau dieser Schritt ist, der einem Unternehmen neue Chancen eröffnet, bestätigt auch Nikolaus Franke. „Ein Start-up ist grundsätzlich etwas extrem Dynamisches. Im Prozess ändern sich die Herausforderungen: In der frühen Phase lebt ein Start-up oft von der Vision, Energie und Risikobereitschaft der Gründer*innen; doch wenn das Unternehmen wächst, braucht es klare Strukturen, Prozesse und den klaren Willen zur Skalierung“, so der Gründer und Direktor des Instituts für Entrepreneurship und Innovation an der Wirtschaftsuniversität Wien. „Manchmal wachsen die Fähigkeiten des Gründers mit, manchmal passen sie nicht mehr. Dann ist ein gut geplanter Wechsel sinnvoll“, erklärt Franke.
Bei the female factor war – ähnlich wie bei woom – irgendwann einfach die Luft raus. Es war Zeit, Platz zu machen für frischen Wind. „Wir beide sind eher Builder als System-Maintainer“, so Gharaei. Nach intensiven Aufbaujahren fehlte den Gründerinnen die Energie, das Unternehmen weiterhin mit der gewohnten Kraft voranzutreiben. „Das Problem in einem Start-up-Umfeld ist, dass es nie genug ist“, sagt Sternbauer. „Du gibst immer dein Bestes – und trotzdem waren wir nie an dem Punkt, wo wir dachten, wir könnten mal chillen.“ Der Rückzug aus der Führungsrolle bedeutete deshalb auch ein Gefühl von Erleichterung.
Wie die ABA Österreich als Forschungsstandort und HQ-Drehscheibe positioniert
Interview: René Tritscher, Geschäftsführer der Austrian Business Agency (ABA) erklärt, was Österreich als Standort für internationale Unternehmen, Forschung und Fachkräfte attraktiv macht.

Die Austrian Business Agency (ABA) ist die zentrale Standortagentur von Österreich und berät mit ihren Geschäftsbereichen INVEST in AUSTRIA, WORK in AUSTRIA und FILM in AUSTRIA kostenlos internationale Unternehmen, Fachkräfte und Filmproduktionen. Sie macht das Land weltweit als Wirtschafts-, Forschungs- und Arbeitsstandort sichtbar und begleitet Betriebe von der ersten Standortfrage bis zur Ansiedlung und Erweiterung. Im StartingUp-Interview spricht Geschäftsführer René Tritscher darüber, warum Österreich für forschungsintensive Unternehmen und Headquarters attraktiv ist und welche Rolle Talente und Forschungsökosysteme dabei spielen.
StartingUp: Österreich wird international als forschungsstarker Innovationsstandort wahrgenommen. Was macht aus deiner Sicht die besondere Attraktivität Österreichs (speziell für forschungsintensive internationale Unternehmen) aus?
René Tritscher: Österreich als innovativer Industrie- und Forschungsstandort bietet ein stimmiges Gesamtpaket und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis. Wir haben eine Forschungsquote von über 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und eine steuerliche Forschungsprämie von 14 Prozent. Dazu kommen exzellente Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitäre Institute sowie Cluster, in denen Unternehmen und Forschungseinrichtungen eng zusammenarbeiten.
Besonders stark ist Österreich in Bereichen wie Green Tech, Digitalisierung mit Schwerpunkten wie Künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie sowie Life Sciences – bei MINT-Absolvent:innen liegen wir mit rund 32 Prozent im europäischen Spitzenfeld und deutlich über OECD- und EU-Durchschnitt. Außerdem bietet Österreich hohe Planungs- und Rechtssicherheit, eine zentrale Lage in Europa und eine Lebensqualität, die internationale Talente anzieht.
Die ABA positioniert Österreich weltweit als Forschungs- und Investitionsstandort. Wie genau unterstützt die ABA Unternehmen beim Markteintritt, bei der Expansion und beim Aufbau regionaler oder divisionaler Headquarters?
Mit „INVEST in AUSTRIA“ und „WORK in AUSTRIA“ machen wir den Wirtschafts-, Forschungs- und Arbeitsstandort Österreich international sichtbar und sprechen Unternehmen sowie Fachkräfte gezielt an. Wir beraten Unternehmen kostenlos bei der Evaluierung des Standortes, bereiten Kennzahlen und Standortvergleiche auf und identifizieren passende Regionen, Immobilien und Förderprogramme. Ein wichtiger Teil ist die Vernetzung mit Clustern, Forschungszentren, Ausbildungspartner*innen und Behörden, damit Unternehmen rasch in die relevanten Ökosysteme hineinfinden.
Bei Erweiterungen unterstützen wir das lokale Management dabei, den Business Case für Österreich im Konzern zu argumentieren und mit Fakten zur Lage im Herzen Europas, zur Wertschöpfung sowie zum Talentangebot. 2024 haben wir 309 Ansiedlungen und Erweiterungen mit einem Investitionsvolumen von rund 1,1 Milliarden Euro und mehr als 2.200 geplanten Arbeitsplätzen begleitet und bleiben auch nach der Ansiedlung als Partnerin in allen Belangen an der Seite der Unternehmen.

Ein wichtiges Argument für einen Standort ist der Zugang zu Fachkräften, gerade in MINT-Bereichen. Wie unterstützt WORK in AUSTRIA Unternehmen beim Recruiting internationaler Talente?
Der Geschäftsbereich „WORK in AUSTRIA“ der ABA unterstützt Unternehmen in Österreich beim Recruiting internationaler Fachkräfte und vernetzt sie kostenlos mit Kandidat*innen weltweit. Im Mittelpunkt steht unsere digitale Plattform (Talent Hub), auf der Unternehmen ihre Stellen inserieren, Suchprofile anlegen und passende Kandidat*innen vorgeschlagen bekommen.
Daneben setzen wir auf zielgruppenspezifische Kommunikationsmaßnahmen in ausgewählten Fokusländern wie Rumänien, Kroatien, Brasilien oder Indonesien, kooperieren mit Hochschulen und organisieren Karriere-Events sowie Formate wie virtuelle Talent- oder Research-Talks. In unseren Beratungen geht es auch um praktische Fragen zu Arbeitsrecht, Anerkennung von Qualifikationen oder zu Standortfaktoren. Unser Ziel ist, dass der Zugang zum globalen Talentpool für österreichische Unternehmen im HR-Alltag gut handhabbar wird.
Neben Unternehmen unterstützt die ABA auch internationale Fachkräfte und ihre Familien beim Weg nach Österreich. Welche Rolle spielt diese Serviceleistung im Wettbewerb um globale Talente?
Internationale Fachkräfte entscheiden sich nicht nur für einen Job, sondern für ein Land zum Leben. Unsere Servicestelle Einwanderung und Aufenthalt berät Fachkräfte, Forscher*innen, ihre Angehörigen und Unternehmen persönlich zu Aufenthaltstiteln wie der Rot-Weiß-Rot-Karte, zu Verfahren, Fristen und Unterlagen und begleitet den gesamten Prozess von der ersten Anfrage bis zur Ankunft.
Ergänzt wird das durch digitale Tools wie dem „Immigration Guide“ und dem „Personal Guide to Living and Working in Austria“ sowie durch Relocation- und Onboarding-Services zu Themen wie Wohnen, Schule oder Gesundheitsversorgung auf workinaustria.com. So verbinden wir die internationale Bewerbung des Forschungs- und Arbeitsstandorts Österreich mit sehr konkreter Unterstützung auf dem Weg hierher. Dieses Gesamtpaket aus Karriereperspektive, Forschungsumfeld und Lebensqualität ist im Wettbewerb um globale Talente ein wichtiger Standortvorteil.
5 Erfolgsfaktoren für (bootstrappende) Start-ups
Kapital bleibt schwer zugänglich: Was Gründer*innen jetzt von bootstrappenden Start-ups lernen können.
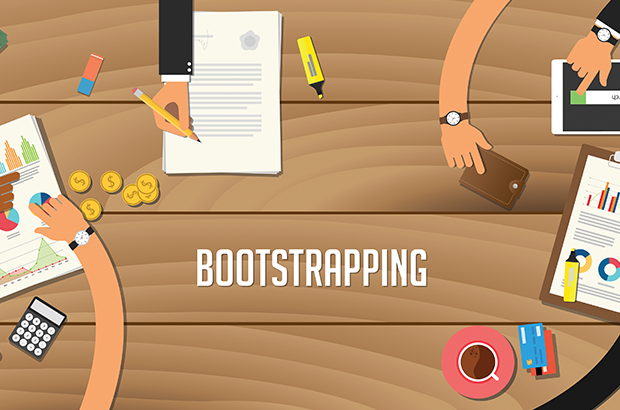
Andreas Lehr, Bootstrapper, Gründer und Host des Podcasts Happy Bootstrapping, hat mit über 150 bootstrappenden Gründer*innen gesprochen und aus den Gesprächen fünf Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Darunter Ansätze, die jetzt im aktuellen Funding-Klima von großer Bedeutung sind.
- Extreme Kund*innenfokussierung statt starker Wachstumsfokus.
- Profitables Wachstum mit kleinen Teams, Gründen in Teilzeit.
- Nischen-Strategien, die die Skalierung in einen breiteren Markt ermöglichen.
- Community-getriebene Produktentwicklung / Building in Public.
Lehrs Erkenntnis: „Bootstrapping gewinnt in der deutschen Start-up-Landschaft sichtbar an Gewicht. Immer mehr Gründer*innen setzen auf unabhängiges Wachstum. Genau die Strategien, die Bootstrapper*innen erfolgreich machen, werden für Gründer*innen in einem vorsichtigeren Markt zu wichtigen Werkzeugen, um Unternehmen stabil aufzubauen.“
5 Erfolgsfaktoren für (bootstrappende) Start-ups
1. Build in community, not just in public
- Eine Community ist eine dauerhafte Feedback-Quelle für bestehende und kommende Produkte.
- Aufbau enger Nutzer*innengruppen auf Discord, Instagram und per On-Site-Events sorgt für loyale Unterstützung.
- Eine Community liefert Ideen für neue Features und Produkte und hilft dabei sie zu validieren.
- Enge Interaktion sorgt für Loyalität und niedrigere Customer Acquisition Cost. Building in Community ist damit die Vertiefung von Building in Public.
Beispiel: Capacities.io ist eine Note-Taking-Software, die Notizen auf die menschliche Wahrnehmung optimierte Weise strukturiert. Die Gründer haben eine Community aus 5000+ Menschen auf Discord aufgebaut, was den Support- & Onboarding-Aufwand reduziert und die Produktbindung erhöht.
2. Keine Angst vor der Nische
- Start in einer sehr klar definierten Nische mit spitzem Nutzer*inproblem.
- Nischen ermöglichen schnelles Verständnis von Marktbedürfnissen und zielgerichtetes Produktdesign.
- Hohe Eintrittsbarrieren für Wettbewerber*innen durch Expertise und Fokus.
- Nischen können nach und nach erweitert werden, um einen breiteren Markt zu erreichen.
Beispiel: parqet.com startete als FinTech für Portfolio-Tracking für die Kunden*innen einer einzigen Bank. Die Schritt-für-Schritt-Erweiterung der Services sorgte für stabiles Wachstum und ausreichend unternehmerischer Ressourcen.
3. Produktfokus: Gut Ding will Weile haben
- Produktqualität und Nutzer*inerlebnis wichtiger als schnelle Releases.
- Intensive Iterationsphasen mit frühen Nutzer*innengruppen.
- Launches werden verschoben, bis das Produkt wirklich überzeugt.
- Kund*innennähe (direktes Feedback, Support) ist der Hebel für Produktentwicklung.
Beispiel: PROJO ist ein SaaS für Planungsbüros in der Architektur und Ingenieurswesen. Die Software wurde mit den ersten drei Kunden über zwei Jahre bei regelmäßigen Check-ins verfeinert.
4. Nicht nach Version eins aufgeben
- Erste Versionen sind oft nicht erfolgreich – Fortschritt entsteht durch Ausdauer.
- Anpassungen, Repositionierungen und mehrere Iterationen können notwendig sein.
- Gründer*innen profitieren langfristig von Beharrlichkeit in derselben Produktlinie. Expertise in der Nische entsteht nicht sofort.
Beispiel: Gründer Sebastian Röhl entwickelt verschiedene Apps im Self-Improvement-Bereich, um herauszufinden, was funktioniert: WinDiary, HabitKit, LiftBear. Viele Gründer*innen berichten von einem Hockey-Stick-Moment
5. Teilzeitgründen gibt Sicherheit
- Viele Bootstrapped-Projekte starten erfolgreich neben dem Hauptjob.
- Reduzierte Arbeitszeit (z.B. 4-Tage-Woche) ermöglicht risikoreduziertes Wachstum.
- Nebenberufliche Projekte schaffen Zeit für Markttests und frühe Umsätze.
- Erst später in Vollzeit wechseln, wenn Traction vorhanden ist.
Beispiel: Treazy, ein Start-up für Socken, wurde vom Gründerduo in Teilzeit aufgebaut und beschäftigt heute beide voll. Ein(e) Gründer*in muss nicht alles stehen und liegen, um ein Start-up aufzubauen, oft reichen drei Tage oder die halbe Woche, was finanzielle Sicherheit gibt und ein langsameres Wachstum möglich macht.
Innovation Leadership
Wie du Innovative Work Behavior in deinem Start-up von Anfang an gezielt entwickelst, förderst und damit dauerhaft erhältst.

Die allermeisten Unternehmen starten mit einer leuchtenden Vision: Sie wollen für eine große Idee aufbrechen, vielleicht sogar die Welt verändern. Dahinter stecken Mut, Kreativität und Entschlossenheit. Die Köpfe sind voller Gedanken und Zukunftsbilder, die Stimmung ist enthusiastisch. Doch häufig passiert dann etwas zwischen zwei Fundings, dem Teamwachstum oder den nicht enden wollenden To-do-Listen: Diese lebendige, sprudelnde Innovationskraft, die zu Beginn ganz selbstverständlich war, geht nach und nach verloren.
Innovation entsteht nicht durch bunte Post-its an der Wand. Grundlage für Innovation in Teams ist vielmehr das innovative Verhalten der Menschen in der Organisation. Der Nährboden dafür sind Räume, in denen Ideen geäußert und Experimente gewagt werden dürfen. Ein Schlüssel dafür ist die entsprechende Führung. Dadurch kann sich eine Unternehmenskultur etablieren, die innovatives Verhalten nicht nur kurzfristig bedient, sondern langfristig für Ideen, Weiter- und Neuentwicklungen sorgt. Doch was braucht es nun konkret, damit dieses innovative Verhalten entsteht und auch dauerhaft bleibt? Und wie können Gründer*innen von Anfang an genau diesen Rahmen schaffen?
Innovatives Verhalten dauerhaft verankern
Innovation wird häufig mit einem neuen Produkt oder einer neuen Dienstleistung gleichgesetzt. Doch ganz wenige machen sich Gedanken, wie der Weg dorthin verläuft: Was braucht es, um innovativ zu sein? Was ist notwendig, damit es nicht bei einer einzigen Idee bleibt, sondern sich daraus ein dauerhaftes innovatives Verhalten entwickelt, das den gesamten Unternehmensalltag prägt? Genau hier setzt der wissenschaftliche Begriff „Innovative Work Behavior“ an: Er beschreibt die Fähigkeit und Bereitschaft von Mitarbeiter*innen, aktiv neue Ideen einzubringen, Bestehendes zu hinterfragen und Lösungen jenseits ausgetretener Pfade zu entwickeln.
Dieses Verhalten ist in jedem Unternehmen wichtig. Besonders in Organisationen, die stark auf Innovation angewiesen sind, ist es überlebenswichtig. Häufig müssen sich diese Unternehmen neuen Herausforderungen stellen, sich schnell anpassen und mit knappen Ressourcen arbeiten. Ohne ein Team, das immer wieder bereit ist, kreativ zu denken und mutig zu handeln, bleibt Innovation nur ein Buzzword an der Bürowand oder im Slide-Deck.
Innovative Work Behavior zeigt sich zum Beispiel, wenn Teammitglieder proaktiv Verbesserungsvorschläge einbringen, für diese einstehen und sie auch selbst weiterentwickeln können. Es entsteht, wenn Menschen nicht nur mitdenken, sondern auch mitgestalten – und sich dabei sicher fühlen, auch mal eine ungewöhnliche und zunächst verrückt klingende Idee zu äußern.
Dieses Verhalten braucht Raum, Anerkennung und eine Kultur, die mehr belohnt als nur den reibungslosen Ablauf oder die perfekte, glänzende Endlösung. Denn genau diese kleinen, manchmal noch unfertigen Impulse sind oft die Samen für die nächste große Entwicklung.
Psychologische Sicherheit: Der unsichtbare Nährboden für mutiges Denken
Innovatives Verhalten ist eng damit verknüpft, ob sich Menschen sicher fühlen: Angst, Scham oder der Druck, „keine Fehler machen zu dürfen“, oder das Gefühl, sowieso nicht gehört zu werden, wirken wie lähmendes Gift. Das Konstrukt dahinter bezeichnen Forschende als psychologische Sicherheit: den unsichtbaren Nährboden für neue Ideen. Es ist das Gefühl, dass ich meine Meinung äußern darf, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen, dass ich Fragen stellen darf, auch wenn sie „dumm“ wirken, und dass ich Fehler machen darf und daraus lernen kann. In Teams, die psychologische Sicherheit erleben, trauen sich Menschen, unkonventionelle Gedanken auszusprechen, unbequeme Wahrheiten anzusprechen und Risiken einzugehen. Diese Räume wirken wie ein Experimentierfeld statt wie eine Fehlerfalle. Hier herrscht Offenheit für neue Ideen, Hinweise, kreative Gedankenblitze.
Die Leitung bzw. Führung eines Unternehmens spielt hier eine entscheidende Rolle: Sie bestimmt diese Kultur der Offenheit und des Vertrauens mit. Wer als Führungskraft selbst Fehler teilt, Unwissen eingesteht und aktiv nach Perspektiven fragt, öffnet die Tür für andere. Psychologische Sicherheit entsteht nicht durch schöne Werte an der Wand, sondern durch wiederholtes, gelebtes Verhalten. Dabei geht es nicht immer nur um Fehler und das Lernen daraus, sondern auch um das wertschätzende Hinterfragen: Es braucht eine Umgebung, in der Fragen gestellt werden dürfen, auch wenn sie unbequem sind. Eine Umgebung, in der nicht nur glänzende Ergebnisse zählen, sondern auch die Geschichten dahinter – die Irrwege, das Ringen und die Zweifel. Psychologische Sicherheit ist damit kein netter Soft-Faktor, sie ist die unverzichtbare Basis für innovatives Verhalten.
Freiräume für Innovation schaffen
Gleichwohl eröffnen sich ganz viele praktische Möglichkeiten: in Meetings explizit Raum für offene Fragen einplanen, „unfertige“ Ideen ausdrücklich willkommen heißen, die eigenen Irrwege sowie Zweifel teilen und immer wieder deutlich machen: „Hier darf gedacht, ausprobiert und auch mal danebengegriffen werden.“ Denn nur dort, wo Menschen mutig sein dürfen, entsteht echtes, lebendiges Innovationsverhalten.
Genau diese Freiräume sind auch ein Ort, an dem innovatives Verhalten und schlussendlich Innovationen entstehen. Diese Freiräume sind kein Luxus, den man sich irgendwann einmal leisten kann – sie sind die Voraussetzung für lebendige Innovationskraft in jedem Unternehmen. Prominente Beispiele wie 3M oder Google zeigen eine Möglichkeit: Dort dürfen Mitarbeitende einen Teil ihrer Arbeitszeit (z.B. 15 bis 20 Prozent) für eigene Projekte und Ideen nutzen. Dabei werden Räume geschaffen, in denen nicht alles kontrolliert und überwacht wird, sondern Vertrauen die Grundlage ist und Mitarbeiter*innen Dinge jenseits der Kernaufgaben ihrer Rolle ausprobieren dürfen. Statt Perfektion zu fordern, geht es darum, iterative Lernzyklen zu ermöglichen: ausprobieren, reflektieren, neu gestalten.
Jede vermeintlich „falsche“ Abzweigung wird dabei nicht als Makel angesehen, sondern als ein Baustein auf dem Weg zur nächsten besseren Lösung. Führung, die so denkt, ermöglicht genau diese iterative Weiterentwicklung. Dafür gilt es, sich bewusst Zeit und Raum zu nehmen – auch für Dinge, die nicht sofort in einem messbaren Return-on-Invest münden. Schon etliche Ideen aus solchen Freiräumen sind in großartigen Produkten und Dienstleistungen gemündet, wie zum Beispiel Gmail bei Google.
Nicht jedes Unternehmen kann und möchte nun gleich 20 Prozent Freiraum für alle einräumen. Das muss auch nicht sein: Es gibt unterschiedliche Wege, Freiräume zu schaffen – etwa durch feste Innovationsblöcke, thematische Fokus-Tage oder flexible Zeitkontingente, die situativ eingesetzt werden können. Ein entscheidender Erfolgsfaktor bei all diesen Konzepten ist jedoch, dass diese Zeiten eine fest verankerte, wenn auch variable Struktur darstellen und nicht bei der ständig währenden „Ich-muss-noch-schnell-etwas-fertig-machen“-Welle weggespült werden. Denn hinter dieser Struktur steht die feste Verbindung in der Unternehmenskultur. Diese Zeiten werden damit Ausdruck einer tiefen Überzeugung in der Organisation: Ständige Weiterentwicklung und Neugier sind nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich gewollt und verankert. Sie werden aktiv wertgeschätzt und gefördert.
Somit wird klar: Innovation ist kein linearer Sprint, sondern ein wellenartiger Prozess, der auch strategisch unterstützt werden kann. Führung, die das versteht, wird zur Quelle nachhaltiger Energie und hält die Innovationskraft langfristig lebendig. Am Ende geht es darum, dass Menschen ihr Potenzial entfalten können, dass Mitarbeitende Ideen einbringen und weiterentwickeln dürfen. Entscheidend dafür ist in einem beträchtlichen Maße die Haltung der Leitungsebene genau zu diesem Thema.
Die Autorin Katharina Lipok ist Teamentwicklerin, Leadership Coach und Lehrbeauftragte für Innovation Leadership.
Jetzt erst recht: Wie Krisen echte Gründer*innen hervorbringen
Deutschland erlebt ein Gründungs-Revival: 2024 wurden rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent nach Jahren des Rückgangs. Dabei entstehen in Krisenzeiten oft die stärksten Innovationen: BioNTech, Flix oder 1komma5° wurden in Umbruchsphasen gegründet und sind heute Marktführer. Doch warum zögerten viele gerade während Pandemie und Energiekrise? Es fehlt nicht nur an Risikokapital, sondern auch am Mut, neue Wege zu gehen. Jetzt ist ein radikales Umdenken gefordert: weniger Angst vor dem Scheitern, mehr Fokus auf nachhaltige Geschäftsmodelle und Zukunftsmärkte. Warum Krisen der beste Zeitpunkt sind, um groß zu denken, liest du im Folgenden.

Inflation, Unsicherheit, Strukturwandel: Viele Menschen schrecken aktuell vor dem Schritt in die Selbstständigkeit zurück. Steigende Preise, schwankende Märkte und unklare Zukunftsaussichten lassen viele potenzielle Gründer*innen zögern. Doch genau in solchen Umbruchsphasen entstehen traditionell die stärksten Innovationen. Während der Finanzkrise 2008–2010 entstanden weltweit Startups wie Airbnb und Uber, die heute Milliardenunternehmen sind. Auch in Deutschland gibt es Beispiele: BioNTech (2008) stellte mitten in unsicheren Märkten die Weichen für mRNA-Forschung und rettete während Corona Millionen Leben. Flix (2013) nutzte die Krise und die Fernbus-Liberalisierung, um ein global führendes Mobilitätsunternehmen aufzubauen. Auch jüngere Unicorns wie Personio (HR-Tech) oder 1komma5° (Solar) zeigen: Krisen eröffnen enorme Chancen für diejenigen, die mutig handeln.
Paradox ist jedoch, dass ausgerechnet in den Hochzeiten der jüngsten Krisen – Pandemie, Energiepreisschock, geopolitische Unsicherheit – die Gründungsquote in Deutschland zunächst eingebrochen ist. Viele hielten sich zurück, aus Angst vor Risiko. Doch genau das macht die aktuelle Entwicklung so spannend: Nach Jahren des Rückgangs deutet sich eine Trendwende an. 2024 wurden in Deutschland rund 585.000 neue Unternehmen registriert – ein Plus von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wenn alte Geschäftsmodelle ins Wanken geraten und bestehende Strukturen nicht mehr funktionieren, öffnet sich Raum für neue Ideen, kreative Geschäftsansätze und disruptive Technologien.
Wer heute gründet, baut nicht nur ein Unternehmen auf, sondern gestaltet aktiv die Zukunft mit. Die aktuelle Krise ist kein Hindernis, sondern ein Katalysator für Fortschritt. Doch warum ist die Gründungsquote in Deutschland in den Hochzeiten der letzten Krisen nicht gestiegen, sondern sogar gesunken? Die Gründe sind vor allem im Mindset zu sehen: zu viel Vorsicht, zu wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Viele lassen sich von gescheiterten Start-up-Stories entmutigen – anstatt von erfolgreichen Beispielen inspirieren. Hinzu kommt die Finanzierungslücke: Während in den USA oder UK auch Frühphasen-Investments leichter zugänglich sind, stoßen Gründer*innen hierzulande oft auf Hürden.
Ein neues Narrativ für Gründer*innen
Laut KfW-Gründungsmonitor 2025 bevorzugen 36 Prozent der 18- bis 29-Jährigen Selbständigkeit gegenüber einer Anstellung. Die Planungsquote für Gründungen ist nach einem Tief im Jahr 2023 wieder gestiegen – aktuell verfolgen 4,9 Prozent der Bevölkerung konkrete Gründungspläne. Gefordert ist ein Umdenken im Gründungsdiskurs: weg vom Businessplan-Dogma, hin zu Haltung, Resilienz und echten Netzwerken. „Zu viele bleiben in ihrer Idee stecken, anstatt ins Handeln zu kommen. Gerade in aktuellen Krisenzeiten zeigt sich, wer bereit ist, Systeme zu hinterfragen – und bessere aufzubauen. Wir brauchen Gründer*innen, die nicht nur an kurzfristigen Profit denken, sondern langfristig nachhaltige Unternehmen schaffen. Dabei zeigen die vergangenen Jahre, wie wertvoll Gründungen für eine ganze Volkswirtschaft sind. Weltweit wurden in Krisen neue Branchen geformt: Mobility (Flix), HealthTech (BioNTech), Renewable Energy (Enpal) oder HR-Tech (Personio). In unsicheren Zeiten wächst der Innovationsdruck dort am stärksten, wo alte Strukturen versagen – etwa im Gesundheitswesen, im Energiesektor oder in der digitalen Infrastruktur. Wer hier investiert, schafft nicht nur neue Geschäftsmodelle, sondern stärkt zentrale Zukunftsfelder.
Wirtschaftliche Bedeutung von Gründungen
Unternehmensgründungen sind weit mehr als individuelle Erfolgsgeschichten. Sie schaffen jedes Jahr Hunderttausende neuer Arbeitsplätze, treiben Innovationen voran und stärken den Wettbewerb – ganz nebenbei entlasten sie auch die öffentlichen Haushalte durch Steuererträge. Laut KfW Research tragen Start-ups entscheidend dazu bei, neue Technologien schneller in den Markt zu bringen und so die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern. Auf den Punkt gebracht: Wer gründet, schafft nicht nur für sich selbst neue Chancen, sondern immer auch für andere: Arbeitsplätze, Perspektiven und Impulse für ganze Branchen. Gründungen sind kein Nischenphänomen – sie sind ein zentraler Motor unserer Wirtschaft.
Auch im internationalen Vergleich zeigt sich Nachholbedarf: Nach OECD-Daten lag der Anteil von Venture Capital am deutschen Bruttoinlandsprodukt 2021 bei lediglich rund 0,11 Prozent – in den USA war er fast fünfmal so hoch. Wenn wir international mithalten wollen, müssen wir mutiger werden – und Krisen endlich als das sehen, was sie sind: der beste Zeitpunkt für neue Ideen und starke Unternehmen. Ich kenne diese Dynamik aus erster Hand: Mit meiner Beteiligung an GreenTech-Unternehmen wie Febesol und Thermondo will ich auch zeigen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle gerade in Krisenzeiten enorme Relevanz gewinnen können – für die Umwelt, für Investor*innen und für ganze Wirtschaftszweige.
Generation Z denkt Gründen neu
Gerade die Generation Z bringt frischen Wind in die Gründungsszene. Studien zeigen, dass viele junge Menschen heute bereits unternehmerisch denken – aber zu eigenen Bedingungen: digital, flexibel und sinnorientiert. Laut der Bertelsmann-Studie „Pioneering Gen Z Entrepreneurs“ streben Gen Z-Gründer*innen bewusst nach Nachhaltigkeit, Anpassungsfähigkeit und kollaborativen Arbeitsweisen. Dabei verbinden sie wirtschaftlichen Erfolg mit Selbstbestimmung, Work-Life-Balance und Purpose – und schaffen so ein neues Gründer-Mindset.
Diese neuen Gründer*innen fragen nicht nur nach Rendite, sondern auch nach Sinn und Selbstbestimmung. Doch um dieses Potenzial freizusetzen, braucht es Rückenwind: weniger Bürokratie, bessere Förderprogramme, Steuererleichterungen, Zugang zu Risikokapital. Denn ohne den finanziellen Spielraum laufen viele gute Ideen Gefahr, in der Konzeptphase stecken zu bleiben. Deutschland kann es sich nicht leisten, Gründungstalente mit Purpose-Mindset zu verlieren. Wir brauchen mutige Anreize für die Generation, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.
Der Autor Daniel Fellhauer ist Seriengründer, Transformationsexperte und Buchautor. 2009 gründete er während der Finanzkrise die FEBESOL GmbH und baute in den Folgejahren mehrere Unternehmen im Bereich Solar, Wärmepumpen und erneuerbare Energien auf. Heute ist er Chief Transformation Officer bei Thermondo und eingesetzter CEO bei FEBESOL.
Das Einfamilienhaus: Investition in Unabhängigkeit und Lebensqualität
Das Einfamilienhaus bleibt ein Symbol für Freiheit, Stabilität und Individualität. Wie modernes Bauen neue Maßstäbe setzt.

Der Traum vom eigenen Haus ist nach wie vor lebendig. Gerade für Gründer*innen und unternehmerisch denkende Menschen steht das Einfamilienhaus sinnbildlich für Erfolg, Unabhängigkeit und Lebensqualität. Doch ein Eigenheim ist heute weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf – es ist eine Investition in die eigene Zukunft und ein Ausdruck individueller Lebensentwürfe.
In einer Zeit, in der Werte wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und persönliche Freiheit an Bedeutung gewinnen, rückt das Einfamilienhaus als Lebens- und Arbeitsraum zunehmend in den Fokus.
Warum das eigene Haus mehr als nur ein Wohnraum ist
Ein Eigenheim bietet weitreichende Vorteile, die über das reine Wohnen hinausgehen:
- Unabhängigkeit: Keine Mietsteigerungen, keine Abhängigkeit von Vermieter*innen.
- Sicherheit: Eine Immobilie kann als wichtige Säule der Altersvorsorge dienen.
- Individualität: Architektur, Ausstattung und Raumaufteilung lassen sich den eigenen Vorstellungen anpassen.
- Wertsteigerung: Gerade in begehrten Lagen entwickeln sich Einfamilienhäuser oft positiv in ihrem Marktwert.
Nicht zuletzt schafft ein eigenes Haus Raum für Entfaltung – sei es für die Familie, für Hobbys oder für berufliche Aktivitäten im Homeoffice.
Moderne Anforderungen an das Einfamilienhaus
Der Anspruch an das Einfamilienhaus hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Heute zählen nicht nur Größe und Lage, sondern auch:
- Energieeffizienz: Häuser sollen den Energieverbrauch minimieren und gleichzeitig den Wohnkomfort maximieren.
- Nachhaltige Baustoffe: Umweltbewusstes Bauen rückt stärker in den Fokus.
- Flexibilität: Grundrisse sollten an veränderte Lebensphasen anpassbar sein.
- Technische Ausstattung: Smart-Home-Technologien gehören zunehmend zum Standard.
Wer heute baut oder kauft, achtet darauf, dass das Haus nicht nur den aktuellen Bedürfnissen entspricht, sondern auch zukünftige Anforderungen abdeckt.
Wege zum eigenen Einfamilienhaus: Planung und Umsetzung
Der Weg zum Einfamilienhaus beginnt mit einer gründlichen Planung. Wichtige Schritte sind:
1. Bedarfsanalyse: Wie viele Räume werden benötigt? Welche Flächen sind gewünscht? Welche Zukunftsszenarien sollen berücksichtigt werden?
2. Budgetplanung: Neben den Baukosten müssen Nebenkosten wie Grunderwerbsteuer, Notargebühren und Außenanlagen einkalkuliert werden.
3. Grundstückssuche: Lage, Größe, Erschließung und Umfeld sind entscheidende Faktoren für den späteren Wert und die Lebensqualität.
4. Partnerwahl: Ob Architekt*in, Bauträger oder Fertighausanbieter – die Wahl der richtigen Partner*innen beeinflusst Zeitplan, Qualität und Kosten erheblich.
Viele Bauinteressierte setzen dabei auf erfahrene Anbieter, die nicht nur Bauleistungen liefern, sondern auch Unterstützung bei der Finanzierung, Fördermittelberatung und Bauabwicklung bieten.
Zukunftsfähiges Bauen: Nachhaltigkeit, Technik, Individualität
Das Einfamilienhaus von heute muss mehr können als nur Schutz bieten. Gefragt sind zukunftssichere Konzepte, die ökologisches Bauen, moderne Technik und persönliche Wünsche in Einklang bringen.
Wichtige Trends:
- Effizienzhaus-Standards: Wer heute baut, orientiert sich oft an Standards wie KfW-40 oder KfW-55, um von Förderprogrammen zu profitieren und Energiekosten dauerhaft zu senken.
- Smart Home: Intelligente Heizungs-, Licht- und Sicherheitssysteme sorgen für Komfort und optimieren den Energieverbrauch.
- Nachhaltige Materialien: Holz, Naturdämmstoffe und ressourcenschonende Bauweisen stehen hoch im Kurs.
- Flexible Nutzungskonzepte: Häuser mit Homeoffice-Möglichkeiten, Einliegerwohnungen oder variablen Grundrissen passen sich wandelnden Lebenssituationen an.
Besonders zukunftsorientierte Anbieter kombinieren diese Trends zu Gesamtkonzepten, die sowohl ökonomische als auch ökologische Aspekte berücksichtigen.
Herausforderungen und Chancen
Natürlich bringt der Bau eines Einfamilienhauses auch Herausforderungen mit sich:
- Baurechtliche Vorgaben können die Gestaltungsspielräume beeinflussen.
- Baukosten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen.
- Energie- und Klimaschutzauflagen erfordern vorausschauende Planung.
Doch die Chancen überwiegen: Wer sich intensiv vorbereitet, kluge Entscheidungen trifft und auf erfahrene Partner setzt, schafft Werte, die über Generationen Bestand haben können.
Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten bietet ein selbstgenutztes Einfamilienhaus eine stabile Grundlage und eröffnet neue Möglichkeiten – von familiärer Geborgenheit bis hin zur flexiblen Nutzung als Arbeitsplatz.
Das Einfamilienhaus als Fundament für die Zukunft
Das Einfamilienhaus bleibt ein zeitloser Klassiker – und entwickelt sich gleichzeitig weiter. Es vereint individuelle Freiheit, wirtschaftliche Stabilität und nachhaltige Lebensqualität unter einem Dach.
Ob als Lebensmittelpunkt, Wertanlage oder Rückzugsort: Wer heute in ein eigenes Haus investiert, investiert in seine Unabhängigkeit und die Gestaltung der eigenen Zukunft.
Dabei geht es nicht nur um Quadratmeter und Grundrisse, sondern um ein Zuhause, das mit den eigenen Lebensplänen mitwächst. Ein Einfamilienhaus bietet die Möglichkeit, persönliche Werte wie Nachhaltigkeit, Komfort und Beständigkeit in konkrete Architektur zu übersetzen – und schafft damit einen Ort, an dem sich Wohnen, Arbeiten und Leben harmonisch verbinden lassen.
Schneller und innovativer denken – digitaler handeln
Hotspot Südostasien: Warum sich Gründer*innen und Start-ups im Handel stärker am südostasiatischen E-Commerce-Markt orientieren sollten.

Der E-Commerce befindet sich in einem rasanten Wandel – und nirgendwo wächst er derzeit so stark wie in Süd- und Nordasien. Dazu zählen dynamische Märkte wie Südkorea, Taiwan, Japan sowie die boomenden Wirtschaftsräume Südostasiens, darunter die Philippinen, Malaysia, Indonesien, Vietnam und Thailand. Während deutsche Start-ups oft noch auf klassische Handelsstrukturen setzen, hat sich diese Region zu einem globalen Wachstumsmotor entwickelt, in dem digitale und physische Vertriebskanäle nahtlos miteinander verschmelzen.
Für hiesige Gründer*innen und Start-ups eröffnet das enorme Chancen: Wer sich von den innovativen Geschäftsmodellen dieser Märkte inspirieren lässt, wird nicht nur im Wettbewerb besser mithalten, sondern kann selbst neue Maßstäbe setzen.
Ein Blick ins Innovationslabor
Südostasien steht exemplarisch für eine Region, in der besonders im Bereich Commerce Fortschritt und Anpassungsfähigkeit Hand in Hand gehen. Von Livestream-Commerce über die Integration von Finanzlösungen bis hin zur Nutzung von Super-Apps als Zahlungsmittel – die Region zeigt, wie Handel im digitalen Zeitalter neu gedacht werden kann. Plattformen wie Shopee und Lazada setzen auf hochpersonalisierte Kund*innenerlebnisse und nutzen dabei künstliche Intelligenz (KI) und Big Data, um Echtzeit-Lösungen zu bieten.
Das wirtschaftliche Potenzial der Region ist beeindruckend: Laut einer Analyse von Statista wird der Umsatz im E-Commerce-Markt Südostasiens im Jahr 2024 auf etwa 108 Milliarden Euro geschätzt. Bis 2029 soll der Markt mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,42 Prozent auf ein Volumen von rund 179,1 Milliarden Euro anwachsen. Diese Zahlen verdeutlichen nicht nur das enorme Wachstum, sondern auch die Innovationskraft der Region. Die Philippinen und Vietnam gehören zu den Ländern mit den höchsten Online-Nutzungsraten der Welt.
Wichtige Trends aus Südostasien
Deutsche Gründer*innen können von diesem Pioniergeist lernen und ihre eigenen Ansätze radikal hinterfragen. Welche Trends entstehen in Südostasien, die auch hierzulande das Potenzial haben, traditionelle Ansätze zu transformieren?
Mobile First: Die Zukunft ist mobil
Einer der markantesten Pfeiler der südostasiatischen Märkte ist der konsequente Fokus auf mobile Technologien. Smartphones sind dort nicht nur Kommunikationsmittel, sondern zentrale Plattformen für Handel, Unterhaltung und Banking. Laut einer Studie von Meta und Bain tätigen Konsument*innen bereits einen Großteil der Online-Käufe über mobile Endgeräte. In Südostasien sind Apps wie TikTok Shop, auf denen Verkauf, Unterhaltung und soziale Interaktion miteinander verschmelzen, schon fest etabliert.
Hierzulande wird Social Media bislang primär als Marketingkanal genutzt – ein Ansatz, der überdacht werden sollte. Gründer*innen müssen digitale Strategien entwickeln, die soziale Plattformen als integrale Vertriebskanäle nutzen. Dies erfordert nicht nur technologische Anpassungen, sondern auch ein tiefes Verständnis dafür, wie sich Konsumverhalten im digitalen Raum entwickelt.
Super-Apps: Die Macht der Integration
Ein weiterer Trend in Südostasien sind Super-Apps wie Zalo, Grab und Gojek. Diese vereinen eine Vielzahl von Dienstleistungen – von Essenslieferungen über Mobilität bis hin zu Finanzdienstleistungen – in einer einzigen Plattform. Der Vorteil: Nutzer*innen bleiben länger innerhalb des Ökosystems, was die Kund*innenbindung stärkt und zusätzliche Einnahmequellen erschließt.
In Deutschland und Europa gibt es noch keine Super-App auf dem Markt, auch wenn viele FinTechs wie Revolut, Vivid oder Klarna daran arbeiten. Mit den Vorbildern aus Südostasien sollten sich deutsche Start-ups häufiger die Frage stellen: Wie lassen sich verschiedene Angebote sinnvoll miteinander verknüpfen?
Statt einzelne Produkte oder Dienstleistungen isoliert anzubieten, sollten sie umfassende Lösungen schaffen, die den Alltag der Kund*innen effizienter gestalten. Dieser Ansatz erfordert zwar oftmals eine strategische Neuausrichtung, bietet jedoch erhebliches Potenzial für Wachstum und Differenzierung.
Künstliche Intelligenz: Mehr als nur ein Buzzword
Auch wenn KI mittlerweile im deutschen Handel angekommen ist, verläuft die Umsetzung noch schleppend. Oftmals fehlt das Know-how, was mit KI überhaupt alles möglich ist und wie sie sich in die vorhandenen Prozesse integrieren lässt. Der südostasiatische Handel ist da schon einige Schritte voraus: Zum Beispiel nutzen Plattformen wie Shopee maschinelles Lernen, um Kaufentscheidungen in Echtzeit zu analysieren und personalisierte Empfehlungen auszusprechen. Dies verbessert nicht nur das Nutzer*innenerlebnis, sondern steigert auch die Conversion Rate und reduziert Retouren.
Für Gründer*innen ist dies ein klarer Appell, KI nicht nur als Werkzeug zur Effizienzsteigerung zu betrachten, sondern als Herzstück ihrer Geschäftsmodelle zu integrieren. Von der Logistik bis hin zur Kund*innenansprache bietet KI die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig die Kund*innenzufriedenheit zu erhöhen. Da lohnt sich der Blick über den nationalen Tellerrand, um einfacher und vor allem schneller in die tatsächliche Nutzung zu kommen.
Online und Offline: Die Grenzen verschwimmen
Ein zentraler Erfolgsfaktor im südostasiatischen Handel ist die Fähigkeit, Online- und Offline-Kanäle auf kreative und einzigartige Weise miteinander zu verbinden. Besonders herausragend ist das Livestream-Shopping auf Plattformen wie Shopee oder Lazada, bei dem Produkte in Echtzeit vorgestellt und Kund*innen durch exklusive Angebote und Interaktion mit den Verkäufer*innen zum Kauf angeregt werden. Diese Kombination aus Unterhaltung und direkter Kaufmöglichkeit ist weit mehr als ein Trend – sie hat sich als fester Bestandteil des Shopping-Erlebnisses in der Region etabliert.
Auch innovative Ansätze im stationären Handel stechen hervor. So setzen Einzelhändler*innen in Städten wie Bangkok oder Jakarta auf Technologien wie interaktive QR-Codes, die detaillierte Produktinformationen, Bewertungen und Videos direkt auf das Smartphone der Kund*innen bringen.
Für Start-ups bietet die Verbindung von digitalem und physischem Handel somit immense Chancen, insbesondere durch den Einsatz technologiegetriebener Lösungen. Entscheidend ist, dass Unternehmen ein durchgängiges, kanalübergreifendes Erlebnis schaffen, das Kund*innenbedürfnisse und Bequemlichkeit in den Mittelpunkt stellt – sei es online, vor Ort oder mithilfe hybrider Modelle.
Fazit: Lernen von den Besten
Südostasien zeigt eindrucksvoll, wie Innovation und Anpassungsfähigkeit den E-Commerce der Zukunft gestalten. Deutsche Gründer*innen und Start-ups haben die Chance, von diesen Modellen zu profitieren, indem sie mutig neue Wege gehen und traditionelle Ansätze hinterfragen. Sei es durch Mobile-first-Strategien, die Integration von KI oder die Schaffung ganzheitlicher Ökosysteme – der Blick über den Tellerrand lohnt sich.
Der Autor Alexander Friedhoff ist Gründer und CEO von etaily, einer 2020 gegründeten Plattform, die internationale Marken mit Konsument*innen in Südostasien durch Markenmanagement, digitales Marketing und Vertrieb verbindet.
Beobachten statt Berechnen
Rechnerische Planspiele und das Wissen um aktuelle Trends bringen Gründern erste Erkenntnisse über die Zukunft. Wichtiger ist das systematische Beobachten des konkreten Marktes, um ihn zu verstehen und aktiv mitzugestalten.
Natürlich gehört das Glänzen auf dem Theorie-Parkett und das Schreiben von zahlenbasierten Businessplänen für Gründer zum Pflichtprogramm, um beispielsweise der Hausbank zu zeigen, wie man am Markt einsteigen und bestehen will; aber es kann und darf nicht zum Selbstzweck werden und vollständig das überlagern, weswegen der ganze Aufwand eigentlich betrieben wird: Nämlich mit vollem Einsatz ein unternehmerisches Konzept zu erarbeiten, es umzusetzen und unermüdlich weiterzuentwickeln.
Denn nicht nur für aus der Not heraus geborene Gründungen gilt, dass sie stets ein Wagnis darstellen; und zwar eben nicht nur ein betriebswirtschaftliches. Dass sie mit der Person des Gründers oder der Gründerin untrennbar zusammenhängen. Und dass sie entscheidend darauf beruhen, dass die Neu-Unternehmer den Einsatz und Willen haben, etwas zu gestalten!
Wie geht das, ein spezielles Markt-Umfeld – in der Regel eine Nische, ein Regionalmarkt oder ein enger Zielgruppen-Fokus – langsam und stetig (erstens) entlang klarer, konkreter, auf das eigene Unternehmen zugeschnittener Marktqualitätskriterien zu entwickeln und (zweitens) anhand von Indikatoren für eine Marktdynamik auch in der Richtung, in die man selber will, zu lenken? Dieser Kernfrage wollen wir uns im Folgenden widmen.
Strategic Foresight
Im angelsächsischen Kulturkreis ist für derlei Fragestellungen bereits seit Jahrzehnten eine Profession zuständig – und bestens etabliert –, die sich ausschließlich um genau solche Markt-Taktik und Business-Manöver kümmert: Strategic Foresight, die Zukunftsforschung. Hierzulande ist allerdings, wenn überhaupt, eher der Ableger der Trendforschung bekannt. Und das auch fast nur in Großunternehmen oder einigen Lifestyle-Branchen, die sich’s leisten können. Ansonsten stößt Zukunftsforschung auf Skepsis – nicht zuletzt dank einiger Trend-Gurus, die unverdrossen am eigenen Ruf basteln und lustige Trend-Labels und vielerlei Spielchen erfinden. Mit durchaus hohem Unterhaltungs-, aber allem Anschein nach wenig Gebrauchswert. Zukunftsforschung rangiert daher in der Einschätzung vieler gleich hinter „Astrologie 2.0“. Was aber ist wirklich dran an dieser scheinbar exotischen Disziplin?
Die größten Strategie-Fallen
Sie haben eine tolle Geschäftsidee und eine Strategie, wie Sie die Idee realisieren wollen. Doch nach kurzer Zeit stellen Sie fest: Die Idee ist gut – die Strategie aber nicht. Sie beschließen, das Strategiepferd zu wechseln. Dabei lauern viele Fallen, die sich vermeiden lassen.

Es gibt viele Gründe bzw. Notwendigkeiten für Strategiewechsel in der Gründungsphase: die wirtschaftliche Situation verändert sich oder das Kundenverhalten, oder Sie expandieren rasch. Für die meisten Gründer steht zu Beginn der Selbständigkeit das operative Geschäft im Fokus, sie müssen die gegenwärtigen Herausforderungen bewältigen.
Eine klare Unternehmensstrategie, geschweige denn strategische Überlegungen erfolgt bzw. erfolgen „zwischen Tür und Angel“, eher nebenbei und zufällig. Erst nachträglich geraten die langfristigen Zielsetzungen des jungen Unternehmens in den Blickpunkt. Erfolgt dann der Strategiewechsel, sollten Sie folgende Stolpersteine umschiffen.
1. Mangelnde Flexibilität
Sie sind nicht flexibel genug und „kleben“ an Ihren ersten strategischen Überlegungen fest. Die Leimrute Ihrer Ursprungsstrategie lässt Sie nicht mehr los. Eine Weisheit der Dakota-Indianer lautet: „Wenn Du merkst, dass Du ein totes Pferd reitest, steige ab.“ In aller Regel jedoch sagen Gründer: „Besorgen wir uns doch lieber eine stärkere Peitsche.“ Sie sollten den Mut aufbringen, Ihre bisherige Strategie unter die kritische Lupe zu legen und den Strategiewechsel ins Kalkül ziehen. Um sich von der Leimrute zu befreien, benötigen Sie strategischen Weitblick. Dieser lässt sich nicht erlernen oder herbeizitieren – gehen Sie mit einem strategieerfahrenen Partner Ihres Vertrauens in Klausur und legen Sie alles auf den Prüfstand. Verlassen Sie sich dabei nicht allein auf Ihr Bauchgefühl – nutzen Sie das Handwerkszeug der Strategieexperten.
2. Fehlendes belastbares Zahlenmaterial
Zu diesem Experten-Handwerkszeug gehören die Instrumente der Unternehmensanalyse. Überprüfen Sie die Chancen und Möglichkeiten sowie die Risiken und Gefahren Ihrer Geschäftsidee. Berücksichtigen Sie die Faktoren, auf die Sie keinen Einfluss haben, etwa wirtschaftspolitische Entwicklungen. Wichtig ist eine detaillierte Branchenanalyse: Welche Wettbewerber haben Sie, welche Schwächen der Konkurrenten können Sie nutzen, welche Abhängigkeiten etwa von Lieferanten sind zu beachten? Entscheidend ist die Kundenanalyse, hier hilft eine Kundenbefragung weiter: „Warum gehen Kunden zu einem Konkurrenzunternehmen und nicht zu mir?“ Der Zwang zum Strategiewechsel darf nicht zu Hektik und Aktionismus führen. Ein gelungener Strategiewechsel baut auf sauberem Zahlenmaterial zu Ihrem unternehmerischen Ist-Zustand auf. Diese Zahlen liefert auch die interne Unternehmensanalyse, bei der Sie Ihre Kernfähigkeiten, Kernschwächen und kritischen Erfolgsfaktoren überprüfen. Letztere gilt es in positive Erfolgsfaktoren zu verwandeln. Dies gelingt, indem Sie die Unternehmensprozesse in den Mittelpunkt rücken, die in der Wahrnehmung der Kunden eine dominante Rolle spielen.
3. Falscher Blickwinkel
Strategien scheitern deswegen so oft, weil die Entwickler der Strategie dabei primär die Brille des Unternehmens tragen. Beispiel Zielgruppenbestimmung: „Welche Kunden wollen wir?“, lautet die Frage, die zu einer egozentrischen Vertriebskultur führt. Notwendig ist ein Perspektivenwechsel, durch den die Frage: „Was kann unser Vertrieb für unsere Kunden tun?“ in den Mittelpunkt der strategischen Überlegungen rückt. Pointiert ausgedrückt: Setzen Sie beim Strategiewechsel und der Strategieentwicklung immer die Brille des Kunden auf!
4. Keine konkrete Vision
In der hektischen Gründungsphase fehlt es bei der Strategieorientierung oft an der Fundierung. Spätestens beim Strategiewechsel sollten Sie den Strategieprozess sauber aufsetzen. Dazu gehört die Visionsfindung: Strategische Planung ohne Vision ist weitgehend wertlos – und eine Vision ohne umsetzungsorientierte Strategie ebenso. Vision und Strategie gehören zusammen wie die zwei Seiten einer Medaille. Nehmen Sie sich die Zeit, um den Strategiewechsel im Detail vorzubereiten, indem Sie zunächst einmal eine Vision formulieren. Mit der Szenario-Technik lassen sich realistische, weil aus der gegenwärtigen Situation und der Ist-Analyse abgeleitete, mögliche und alternative Zukunftsbilder entwickeln. Eine Vision hilft, die Black Box des Alltagsgeschäftes zu verlassen, sie befreit von den Fesseln des operativen Geschäfts, sie weitet den Blick und eröffnet das Panorama auf Ihr Unternehmen, wie es in fünf oder zehn Jahren ausschauen könnte. Also: Gründen Sie eine Visions- und Strategie-Task-Force mit Mitgliedern, die es wagen, über den operativen Tellerrand hinauszuschauen.
Wie viel Wachstum verträgst du?
Worauf es grundlegend ankommt, wenn dein Ziel nicht nur ein schnelles, sondern ein gesundes, d.h. stabiles Unternehmenswachstum ist.

Ein jedes Unternehmen durchläuft ab dem Zeitpunkt der Gründung verschiedene Phasen. Gerade in den ersten Jahren kann neben allen üblicherweise auftretenden Spannungsfeldern einiges dafür getan werden, damit sich mittel- und langfristig ein gesundes Unternehmenswachstum einstellt.
Es gilt: Gesundes Wachstum geht immer von innen nach außen!
Die Wachstumswege
Als Wachstum bezeichnen wir alles, was mit einer Entwicklung zu tun hat. Ein Unternehmen kann sich dabei im gesunden Wachstum befinden, im Wachstum gehemmt sein, in krankes Wachstum abrutschen oder sich komplett vom Markt verabschieden. Dann heißt es „Game over“. Allein das Wissen, dass es grundsätzlich drei Wege für Wachstum gibt und einen Zustand, den es zu vermeiden gilt, sollte auf Gründer befreiend wirken. Jedes Unternehmen lässt sich einer dieser Wachstums-Kategorien zuordnen. Diese Standortbestimmung ist entscheidend, wenn sich ein Unternehmer mit der Frage befasst, was zu tun ist, um im gesunden Wachstum zu bleiben oder Wege dorthin zu finden.
Ein Start-up ist zumeist dadurch gekennzeichnet, dass es eine neue Idee für ein Produkt, eine Lösung oder einen Service gibt. Bis zu einer Größe von zehn bis 15 Mitarbeitern funktioniert die Gleichung „Wachstum = Mitarbeiter“. Umso mehr Menschen für das Unternehmen arbeiten, desto mehr Ideen- und Umsetzungspower entsteht. Sobald es allerdings größer wird oder nicht mehr alle Mitarbeiter an einem Standort sitzen, kommen neue Fragestellungen auf. Jetzt sind vor allem die inneren Wachstumsparameter von Bedeutung: Es braucht nun für einen reibungslosen Ablauf eine Organisation und für den Zusammenhalt eine gute Firmenkultur. Dabei reicht es nicht aus, dass Menschen in Unternehmen zusammenkommen, die sich lediglich auf der Arbeitsebene gut verstehen.
Stabil wird eine Organisation erst dann, wenn gemeinsame Werte und Motivationen ziel- und ergebnisgerichtet eingesetzt werden. Ansonsten wird das Team gehemmt oder stürzt sogar – nicht sofort, aber perspektivisch – in ein krankes Wachstum.
Ohne Wachstumsschmerzen geht’s nicht!
Gesund ist ein Unternehmen immer dann, wenn die äußeren Parameter wie etwa Umsatz, Erträge und Marktanteile stimmen und das Unternehmen im Inneren von einem innovationsfreudigen Team getragen wird, dessen Mitglieder sich in ihren Stärken ergänzen. In einem Start-up kommt es häufig zu der Situation, dass bei näherer Betrachtung alle inneren Parameter auf Grün stehen, nur fehlen die ersten Kunden, und damit die dringend benötigten Umsätze und Erträge. Jetzt kommt Druck auf – und dieser verändert Menschen. Bisher funktionsfähige Teams erleben, was es bedeutet, wenn Teammitglieder dem nicht gewachsen sind. Im Start-up arbeiten heißt für jeden, täglich „zu wachsen“, und als Unternehmen „er-wachsen“ zu werden, sich also aus einer Idee und einem kleinen Team zu einem funktionierenden und nachhaltig erfolgreichen Unternehmen zu entwickeln.
Dabei sind Wachstumsschmerzen an der Tagesordnung. Sie resultieren aus dem permanenten Spannungsfeld, das aus Budget, Zeit und Qualität besteht. Irgendein Parameter ist immer zu wenig vorhanden oder nicht optimal – zumindest so lange, bis das Geschäftsmodell den Nachweis seiner Tragfähigkeit erbracht hat.
So entsteht gesundes Wachstum
Da weder die Vertreter des Gründerteams noch einzelne Schlüsselpersonen alles gleichzeitig entwickeln können, erfolgt die Entwicklung in Phasen – was aber sollte der Gründer bereits beim Start beachten? Fünf Gesetzmäßigkeiten geben Aufschluss darüber, auf was es ankommt, wenn das Ziel nicht nur ein schnelles, sondern ein gesundes Unternehmenswachstum ist.
Greifbarer Umsatz schlägt große Visionen
Gründer haben in der Regel eine große Vorstellungskraft. Eine Vision trägt sie – das ist klasse, hat jedoch auch wachstumsgefährdende Nachteile. Große Visionen und große Umsatz-Wunschvorstellungen allein führen selten zu etwas Greifbarem, das sofort Kunden und Umsätze nach sich zieht. Neben allem Enthusiasmus braucht ein Start-up kurzfristig den Filter „viel Geld, schnell Geld“, um Produkte und Dienstleistungen so zu entwickeln und marktkonform anbieten zu können, dass die Probleme einer klar definierten Kundenzielgruppe gelöst werden können.
Diese Vorgehensweise ist notwendig, um zügig das passende Geschäftsmodell zu finden. Sobald es da ist, ist es wichtig, bei der Skalierung nicht nur auf Umsatz zu schauen, sondern alle anderen Parameter ständig mit zu orchestrieren, um gesundes Wachstums zu erreichen. Unternehmen, denen es nicht gelingt, schnell gute und zahlende Kunden zu generieren, über die sich das Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln kann, bleiben häufig im gehemmten Wachstum gefangen oder verschwinden vom Markt.
Wenig von viel ist mehr als viel von wenig
Viele Start-ups ringen um eine „Zwischenfinanzierung“. Sie brauchen einen klaren Plan, um den Eintritt in die „Todeszone“ zu verhindern. Gestartet werden die meisten Vorhaben mit Geld von Family & Friends, aber wenn die ersten paar hunderttausend Euro verbrannt sind und das Geschäftsmodell noch nicht auf sicheren Füßen steht, kommt Druck auf. Für große Investoren ist das Vorhaben – trotz der großen Vision des Gründers – jedoch nicht attraktiv. Und bei Investoren, die zwischen 500.000 bis 5 Mio. Euro investieren würden, ist ein Gründer zumeist mit den Bedingungen, die der Investor stellt, nicht einverstanden. Im Ergebnis kommen die meisten Start-ups so nicht aus den Startlöchern heraus.
Der Gründer muss dann die wirklich große Entscheidung treffen, ob es ggf. notwendig ist, erhebliche Anteile des Unternehmens abzugeben, um die lebensnotwendige und sinnvolle Finanzierung in Kombination mit dem richtigen strategischen Partner hinzubekommen. Für das gesunde Unternehmenswachstum heißt das, einen Partner zu finden, der hilft, notwendige Umsätze und Erträge mit zu realisieren und/oder organisatorisch Sicherheit in das Geschäftsmodell zu bringen.
Energie folgt der Aufmerksamkeit
Ein „bisschen gründen“ ist wie ein bisschen schwanger sein – eher schwierig. Ein Start-up zeichnet sich dadurch aus, dass es zu jedem Zeitpunkt flexibel ist, was nicht bedeutet, dass es seine Grundeinstellungen regelmäßig über den Haufen werfen sollte. Es geht darum, alle auftretenden Engpässe im Unternehmen in Ruhe und möglichst im Zusammenhang zu betrachten. In Start-ups sind Wellenbewegungen zu beobachten, in denen es Probleme mal mit Kunden, dann mit Mitarbeitern, dann mit den Produkten oder auch mit dem Geschäftsmodell an sich gibt. Diese Zyklen durchläuft jede Firma, nur sind sie in jungen Unternehmen häufig zeitlich viel enger getaktet. Es geht um ein ständiges Ausbalancieren und Dazu-Lernen, um herauszufinden, wie das Optimum aussehen muss, damit eine gesunde Skalierung möglich ist.
Hier ist die volle Konzentration auf die aktuell anliegende Fragestellung relevant. Anderenfalls läuft das Start-up Gefahr, sich zu verzetteln oder wichtige Hinweise zu übersehen. Menschen, die als Gründer alles auf eine Karte gesetzt haben, sind meistens in der Lage, sich darauf zu konzentrieren, Problemlösungen zu entwickeln und Rückschläge auszuhalten. Gesundes Wachstum geht immer von innen nach außen.
Kultur frisst Strategie
Die beste Unternehmensstrategie hilft nichts, wenn die Firmenkultur nicht getragen ist von Menschen, die miteinander arbeiten können und wollen. In Zeiten, in denen es in vielen Branchen einen Fachkräftemangel gibt, sollten sich Gründer gleich zu Beginn Gedanken machen, warum es sich lohnt, bei ihnen zu arbeiten, und nicht woanders. Das ist auch ein Verkaufsprozess, der im Aufbau einer Arbeitgebermarke mündet. Viele Start-ups sind angewiesen auf Top-Leute, die über das normale Pensum hinaus arbeiten, dafür allerdings zu Beginn nicht viel verdienen dürfen, weil es die Kapitalisierung nicht hergibt.
Das klingt erst einmal schwierig, ist aber lösbar über ein klares Konzept zur Entwicklung der Organisation, bei dem die Frage beantwortet wird, wie zusammengearbeitet werden soll. Zudem sollte eine unverwechselbare Firmenkultur etabliert werden, die erlebbar macht, warum die Menschen gern für das Unternehmen arbeiten, auch um so einen Sog auf neue und qualifizierte Mitarbeiter zu erzeugen.
Unternehmer können selbst der größte Engpass sein
Dieser Punkt klingt zugegebenermaßen hart, und doch ist er oft genau der Knackpunkt, an dem sich entscheidet, ob gesundes Wachstum möglich ist. Viele Start-ups entstehen durch Menschen, die das erste Mal eine Unternehmerrolle einnehmen. Auch wenn sie vorher viele Jahre lang erfolgreich im Management von Unternehmen gearbeitet haben, überfordert sie diese Rolle, weil sie jetzt zu 100 Prozent die Verantwortung tragen und oft genug eigenes Geld im Spiel ist.
Ein Unternehmen braucht in seinen Wachstumsphasen immer eine Leitfigur mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen. Langfristig erfolgreiche Unternehmer prüfen deshalb regelmäßig, auf welcher Position sie dem Unternehmen am besten dienen und zu seinem gesunden Wachstum beitragen können. Es gibt auch Gründer, die am wirkungsvollsten im Hintergrund – etwa in der Technik oder in der Gesamtstrategie – agieren und deshalb ganz bewusst einen Geschäftsführer für das operative Start-up-Geschäft eingestellt haben.
Fazit
Start-ups müssen in den ersten Jahren einen starken Fokus auf die äußeren Parameter legen, um möglichst viele Kunden zu gewinnen und der Firma so eine entsprechende Marktwahrnehmung zu verschaffen und um viel Geld für weitere Investitionen zu verdienen.
Parallel dürfen aber die internen Parameter nicht aus dem Auge verloren werden. Der Gründer oder das Gründerteam sollte sich frühzeitig über die gewünschte Organisation und die Führungskultur verständigen und die entsprechenden Umsetzungsschritte zügig einleiten.
Zudem sollte sich ein Gründer bzw. das Gründerteam selbstkritisch in den verschiedenen Phasen der Unternehmensentwicklung hinterfragen, ob er bzw. es (noch) über die notwendigen Kompetenzen verfügt, um das Unternehmen erfolgreich zu führen und zu dessen gesunden Wachstum beizutragen. Ist dies nicht der Fall, sollten alle Beteiligten so schnell wie möglich die notwendigen Konsequenzen ziehen.
Der Autor Oliver Wegner verhilft als Wachstums initiator Unternehmen zu gesundem Wachstum; er ist der Autor von „Die Wachstumsformel“ (Wiley), www.oliverwegner.com
Waren-Einfuhr aus Fernost
7 Tipps, die E-Commerce-Start-ups beim Direktimport von Waren aus China beachten sollten.

Die Produktionskosten in China sind niedrig, die Gewinnspanne beim Verkauf der in Fernost hergestellten Ware in Europa entsprechend hoch. Wer erfolgreich mit seinem E-Commerce durchstarten will, tut das durch den Direktimport aus China. Doch Importbedingungen, Zollverfahren und Vorschriften beschränken den Handel, und die Auswahl von Lieferanten und Produkten gestaltet sich oft schwieriger als gedacht. Was ist bei der Einfuhr von Waren aus China also zu beachten? Wir haben die wichtigsten Tipps zusammengestellt.
1. So findest du Lieferanten aus China
Tradeshows sind die mit Abstand beste Quelle, um Lieferanten zu finden. Es lohnt sich nicht nur die größte chinesische Handelsmesse Canton Fair zu besuchen, sondern auch branchenspezifische Tradeshows. So besteht die Möglichkeit, auf aus- und inländischen Fachmessen direkt mit potenziellen Lieferanten persönlich zu sprechen. Eine Faustregel besagt: Wenn das entsprechende Unternehmen sich mit einem Messestand präsentieren kann, hat es eine bestimmte Größe erreicht und kann damit im angemessenen europäischen Standard produzieren. Allerdings sollte beachtet werden, dass keinesfalls immer der ideale Lieferant den größten Messestand besitzt. Oft stellen auf den Fachmessen ebenso Agenten aus. Dabei handelt es sich um Zwischenhändler, welche beim tatsächlichen Hersteller dropshippen oder einkaufen. Daher ist beim Aufbau eines Auditverfahrens eine saubere Firmen- und Warenprüfung notwendig.
Zwar machen es B2B-Plattformen wie Globalsources.com oder Alibaba.com leicht, ohne viel Aufwand Produkte zu finden. Aber: Hier kann sich jeder registrieren. Es erfolgt keine Qualitätskontrolle der Waren oder der Unternehmen. Auf Alibaba sind auch Allround-Firmen stark verbreitet, die nahezu alles anbieten. Tatsächlich eignen sich diese Händler lediglich dafür, um eine Übersicht über Produktpaletten und potenzielle Preise zu erhalten. Allerdings sollte man dort nicht kaufen, da umso breit gefächerter und größer das Sortiment, desto höher ist die Chance, dass die meisten Produkte zugekauft werden. Dabei sind Kontinuität und Qualität nicht zu garantieren.
2. Bei der Lieferantenauswahl auf die Details achten
Was weist auf einen hervorragenden Lieferanten hin? Dabei empfiehlt es sich, die Details zu beachten. Renommierte Lieferanten bieten gute Dokumente wie Typenschilder und Anleitungen. Sind die Anleitungen nur im schlechten Scan vorhanden, sollte man die Finger von dem Unternehmen lassen. Häufig bedeutet das nämlich, dass es Produkte vom Lieferanten lediglich zukauft. Bei der Lieferantenauswahl ist es wichtig, keinesfalls am falschen Ende zu sparen. Bei wenig Erfahrung ist es sinnvoll, für Firmen- und Warenprüfungen externe Dienstleister zu betrauen. Gut bewertete sind auf Alibaba.com zu finden.
3. Die Produkte für dein E-Commerce prüfen
Es empfiehlt sich vor der ersten großen Auftragsvergabe, die Ware in den Händen zu halten und zu überprüfen, wie sie produziert wurde: Was die Produktionskette angeht, ist es entscheidend, sich über den Ablauf der Fertigung, die eingesetzten Materialien und das Personal dahinter zu erkundigen. Findet eine Qualitätssicherung statt? Kümmern sich echte Fachleute um die Entwicklung? Hier sollte alles über die Herstellung herausgefunden werden.
Beim Einkauf größerer Mengen sind Produktproben ein Muss. Daher ist es wichtig, sich zuvor mehrmals Einzelproben zusenden zu lassen und zu kontrollieren, ob diese die gewünschte Qualität bieten.
Geht es um ein völlig neues Produkt, sollte man sich im Vorfeld unbedingt einen Prototypen anfordern. Mit dem Lieferanten oder Produzenten empfiehlt es sich, Rücksprache zu halten, damit die Wünsche umgesetzt werden können.
Entscheidend ist auch die Prüfung der Ware und, ob diese deutschen Normen einhält. Das Entsprechen deutscher Standards gilt nicht als selbstverständlich. Hierzu helfen Fragen, wie etwa: Beliefert das Unternehmen schon europäische Kunden? Sind auch deutsche Firmen darunter? Kennt der Lieferant die europäischen Anforderungen?
Je nach Art des Produktes kann es sinnvoll sein, seine Musterprodukte in Europa oder Deutschland zu bestellen, da das schneller geht und günstiger ist.
4. Jedes Detail vertraglich festhalten
Vor allem bei Verhandlungen machen sich nicht nur Verständigungsprobleme, sondern auch die kulturellen Unterschiede deutlich bemerkbar. Es gibt einige Besonderheiten bei Verhandlungen und Vertragsabschlüssen, die zu beachten sind:
- Den Firmen in China sind langfristige Beziehungen wichtiger als einzelne Geschäfte. Deswegen kann es vorkommen, dass sich Verhandlungen entsprechend in die Länge ziehen. Hier ist Geduld gefragt!
- Häufig stellen Aussagen in Verhandlungen einen Richtwert dar, ohne dass sie völlig verbindlich sind.
- Die Beziehung hat mehr Bestand als die Verträge. Chinesen ist der persönliche Kontakt sehr wichtig. Zudem sollten Verhandlungen stets auf derselben Hierarchieebene geführt werden.
Beim Verhandeln darf der Geschäftspartner niemals "das Gesicht verlieren". Bei den chinesischen Landsleuten gilt dies als einer der größten Übel. Während der Konversationen kann es auch passieren, dass das Bejahen einer Aussage nicht uneingeschränkt ein "Ja" heißt, weil ein "Nein" seitens der Chinesen nicht denkbar ist.
Damit schließlich bei den eigenen Geschäften Sicherheit besteht, ist der Abschluss von Verträgen unverzichtbar. Bei diesen empfiehlt es sich, alle einzelnen Kriterien exakt aufzuführen. Nur wenn für beide Seiten jedes Detail klar ist, besteht die Möglichkeit, dass die kulturellen Feinheiten und Unterschiede letztlich nicht für beide Gesprächspartner ein Problem darstellen.
5. Logistikpartner für den Warenversand beauftragen
Das Versenden der Ware sollte keinesfalls der Lieferant übernehmen. Besser ist es, einen eigenen Logistikpartner zu finden, der mit dem Import aus China erfahren ist und um sämtliche Feinheiten der Kooperation Bescheid weiß.
Für den Fall, dass lediglich geringe Mengen eingeführt werden sollen beziehungsweise falls die Ware leicht und klein ist, rentiert sich das Versenden per Express von Dienstleistern, wie etwa FedEx, UPS oder DHL. Im Übrigen sollte immer eine Transportversicherung abgeschlossen werden, da einfach zu viel Unwägbares vorkommen kann.
6. Importvorschriften kennen und Dokumente prüfen
In die Bundesrepublik dürfen nicht alle Waren völlig ohne Kontrolle importiert werden. Hierbei geht es nicht um Zoll- oder Sicherheitsbestimmungen, sondern mehr um Beschränkungen gesamter Branchen. In den Bereichen Chemie, Stahl und Technologie sind vereinzelt klare Einfuhrbestimmungen gegeben. Da sich die Feinheiten dieser Regelungen stark unterscheiden können, empfiehlt es sich, sich hier von außen beraten zu lassen. Es liegt im eigenen Interesse, dass man bei einer Einfuhr alle Unterlagen vollständig und griffbereit hat. Denn, sobald die Ware am deutschen Zoll ist, trägt der Empfänger die ganze Verantwortung.
7. Steuern und Zölle korrekt einkalkulieren
Beim Einführen von Produkten aus China sind zusätzlich Zollgebühren, Importabgaben und inländische Abgaben, wie etwa die Einfuhrumsatzsteuer, zu bezahlen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs denkt nicht jeder gleich an diese Abgaben, teilweise werden diese auch völlig vergessen. Gerade Zölle sind dabei ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor. Deswegen sollte vor dem Kauf von Waren geklärt werden, ob sich die Einfuhr überhaupt rechnet. Nicht selten müssen, je nach Produkt, mehrere tausend Euro Schutzgebühr beim Staat hinterlegt werden. Dafür gibt es aber wenigstens die Möglichkeit, die Einfuhrumsatzsteuer später beim Finanzamt geltend zu machen.
Der Autor Michael Seibold ist CEO und Gründer von Trading EU GmbH. Über seine Plattform Hubtechnik24.de vertreibt er Hubwagen, Lager- und Transporttechnik an Firmen und Privatpersonen in ganz Europa.
5 Tipps, wie Nachhaltigkeit im E-Commerce gelingt
So baust du dir mit ressourcenschonenden und sozial verantwortungsbewussten Alternativen ein wirklich nachhaltiges E-Commerce-Business auf.

Schaut man auf die marktbeherrschenden E-Commerce-Unternehmen, scheint eine Verbindung von wirtschaftlich tragfähigem Online-Shopping und ernstgemeinter Nachhaltigkeit kaum möglich. Mit der Regenbogenkreis GmbH und unserem sorgfältig zusammengestellten Produktsortiment beweisen wir tagtäglich das Gegenteil. Fünf Aspekte solltest du unserer Erfahrung nach genau im Blick behalten, um ebenfalls ein wirklich nachhaltiges E-Commerce-Business betreiben zu können.
Erfolgreiches E-Commerce wird nicht selten mit rein gewinnorientiertem, ökologisch ignorantem und sozial unverträglichem Anbieten und Versenden von kurzlebigen, möglichst billigen Artikeln verbunden. Diese werden dann oft unter unerträglichen Bedingungen produziert und mit umweltschädlichen Containerriesen um die halbe Welt geschifft, um dann bereits innerhalb kürzester Zeit wieder in den Mülleimer zu wandern. Nichtsdestotrotz lässt sich eine nachhaltige Lebens- und Geschäftsphilosophie auch in der Online-Shopping-Branche verwirklichen. Mittlerweile findet man in den allermeisten Fällen nachhaltige, ressourcenschonende und sozial verantwortungsbewusste Alternativen zu den branchenüblichen Standards. Worauf sollten Sie also achten, wenn Sie ein nachhaltiges und gleichzeitig wirtschaftlich tragfähiges E-Commerce-Unternehmen gründen und betreiben wollen?
1. Ökostrom – Server und Rechner für Firma, Shop und Büros mit Ökostrom versorgen
Wer einen Web-Shop, einen Unternehmensstandort mit Büro-, Lager- und Versandräumen unterhält, verbraucht natürlich auch elektrische Energie. Diese sollte daher komplett von Ökostrom-Anbietern, wie Greenpeace Energy oder Lichtblick stammen, die ihre Kontingente nachweislich aus regenerativen Quellen beziehen – und eben nicht nur über eine grüne Fassade verfügen und sich gleichzeitig an Atom- und Kohlestrom-Pools bedienen. Der Regenbogenkreis legt hier sehr strenge Kriterien an, kann dann aber auch sicherstellen, dass "Green-Washer" bei der Energieversorgung des Unternehmens außen vor bleiben.
2. Geschäftskonto bei einer Ökobank
Typischerweise läuft der gesamte Zahlungsverkehr eines E-Commerce-Unternehmens vollständig digital ab, entsprechend eng und vertrauensvoll arbeitet man als Betreiber eines Online-Shops mit seiner Hausbank zusammen. Verfolgt man eine klar nachhaltig orientierte und sozial verantwortungsbewusste Lebens- und Firmenphilosophie, verbietet sich die Kooperation mit einem Institut, das direkt oder indirekt über Partner bzw. Beteiligungen Chemie- oder Rüstungsunternehmen finanziert. Weiterhin gelten auch Spekulationsgeschäfte als klares KO-Kriterium. Arbeitet man mit entsprechend aufgestellten Öko- oder Gemeinwohl-Banken, wie der GLS Gemeinschaftsbank oder der Ethikbank, zusammen, entstehen Synergieeffekte die man sich zu nutze machen kann. E-Commerce-Unternehmen die es mit der Nachhaltigkeit ernst meinen, können die Kooperation als weiteres Siegel ihrer Arbeit und Mission nutzen.
3. Ausschließliche Verwendung von Recyclingpapier
Leider ist es auch in einem modernen und technisch gut aufgestellten E-Commerce-Unternehmen noch immer nicht möglich, komplett auf Papier zu verzichten. Das fängt bei Lieferscheinen, Adressaufklebern und in analoger Form vorzuhaltenden Formularen und Dokumenten an und hört bei Toilettenpapier noch lange nicht auf. Wir bemühen uns zwar nach Kräften, kaum noch Papier zu verwenden, achten dann aber auch darauf, dass es sich ausschließlich um hundertprozentige Recyclingqualität handelt. Es werden leider immer noch viel zu viele Wälder für die Papierproduktion abgeholzt – diesem Raubbau an der grünen Lunge unseres Planeten muss dringend Einhalt geboten werden. Regenbogenkreis wurde übrigens ursprünglich gegründet, um mit dem Verkauf von Regenwaldprodukten aus Wildsammlung zum Schutz dieser so wichtigen Waldflächen beizutragen – im Laufe der Zeit haben wir dann unser Sortiment Schritt für Schritt erweitert, aber den Fokus nicht aus den Augen verloren.
4. Verwendung nachhaltiger Verpackungslösungen
Damit unsere Kunden unsere hochwertigen Produkte auch im einwandfreien Zustand erhalten können, müssen diese natürlich sicher und umfassend geschützt verpackt werden. Wer sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, dann aber rohölbasierte Plastikbehältnisse verwendet und die Leerräume der Kartonagen mit Styroporflocken flutet, verspielt komplett seine Glaubwürdigkeit. Wir setzen bei der Regenbogenkreis GmbH daher auf Recyclingkartons und polstern die Leerräume mit biologisch abbaubaren Verpackungs-Chips aus. Auf diese Weise sorgen wir nicht nur für eine widerstandsfähige und sichere Verpackung, die auch eine ruppigere Behandlung überlebt, sondern schonen gleichzeitig auch die begrenzten Ressourcen unseres Planeten. Die Produkte selbst befinden sich in wiederverwendbaren Violettgläsern (die wir übrigens auch unbestückt und "pur" anbieten) oder in Dosen aus Green PE, das aus Zuckerrohr gewonnen wurde.
5. Umsatzanteil als Spende der Erde zurückgeben
Seien wir ehrlich – selbst das ressourcenschonendste Unternehmen muss Umsatz erzielen, um Mitarbeiter entlohnen, Miete zahlen und Rücklagen bilden zu können. Ansonsten tendiert der Grad der Nachhaltigkeit gegen null, da eben keine ökologisch relevante Wirkung erzielt werden kann. Nichtsdestotrotz sollte aber auch ein gewisser Anteil des erzielten Umsatzes wieder direkt zurückfließen, um der Erde und der Natur unmittelbar zugute zu kommen. Die Auswahl passender und wirklich sinnvoller Projekte und Initiativen mag einen auf den ersten Blick erschlagen, dementsprechend sollte man sich von Beginn an bei der Recherche auf Aspekte konzentrieren, die einem besonders wichtig sind. Wir engagieren uns zum Beispiel bei der Tropenwaldstiftung Oroverde und kaufen kontinuierlich Regenwald auf, der dann nicht mehr rein gewinnorientierten Interessen zum Opfer fällt. Auf diese Weise konnten wir bereits mehr als 94 Millionen Quadratmeter Regenwald nachhaltig schützen.
Bei aller Fokussierung auf einem möglichst hohen Grad an Nachhaltigkeit sollte man aber auch keinen perfektionistischen Tunnelblick entwickeln. Oftmals bedarf es etlicher Schritte, die gewünschte Nachhaltigkeit zu erreichen – was aber nicht davon abhalten sollte, überhaupt den ersten Schritt zu gehen.
Der Autor Matthias Langwasser ist Gründer und Geschäftsführer des ganzheitlichen Unternehmens Regenbogenkreis, dessen Kerngeschäft ein veganer Online-Shop ist. Regenbogenkreis wurde 2011 gegründet.
Nachfolgen statt gründen
Sieben Tipps für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge im Mittelstand.

Ein bereits laufendes Unternehmen als Nachfolger zu übernehmen, kann eine attraktive und spannende Alternative zum Selbstgründen sein. Gerade im Mittelstand stehen aktuell viele inhabergeführte Betriebe vor der Wahl: Nachfolger finden oder Aufgeben. Eine gute Chance für Jungunternehmer, ein alteingesessenes Unternehmen zu übernehmen und ihm trotzdem die eigene Handschrift zu verleihen, vor allem im Bereich Digitalisierung.
Der Mittelstand ist eine wichtige Säule der deutschen Wirtschaft. Doch viele kleine und mittlere Betriebe stehen vor einer unsicheren Zukunft, weil ihre Inhaber keine Nachfolger finden. Bereits jetzt sind über 1,5 Millionen Inhaber und Inhaberinnen 55 Jahre oder älter. Das ist eine Chance für Jungunternehmer, die gerne ein eigenes Unternehmen starten möchten, ohne den Druck und das Risiko einer Neugründung.
Ein gut am Markt positioniertes Unternehmen zu übernehmen, dabei von einem bereits existierenden Kundenstamm und langjährigen Beziehungen sowie einer eingespielten Belegschaft zu profitieren, sind gewichtige Vorteile gegenüber einer Neugründung.
Offen stehen Nachfolgern aktuell zwölf Prozent der mittelständischen Betriebe in Deutschland, die laut KfW Research in den kommenden Jahren ihre Tore schließen müssten, wenn ihre Inhaber keinen Nachfolger finden.
Nachfolgeoptionen genau prüfen
Wer eine Unternehmensnachfolge plant, sollte ausschließlich Betriebe in die engere Auswahl nehmen, die zu den eigenen Ambitionen und Zielen passen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, das Businessmodell und die Branche, in der das einzelne Unternehmen beheimatet ist, genau zu prüfen. Hierzu gehört auch, sich einen umfassenden Überblick über die laufenden Geschäfte der Firmen sowie deren infrastrukturellen und personellen Status quo zu verschaffen. Es gilt etwa Fragen zu klären, wie groß das Wachstumspotenzial des jeweiligen Betriebs ist, welche Investitionen geplant sind, auf welchem Stand Maschinenpark und IT sind und ob die Mitarbeiter mit dem größten Know-how nach dem Eigentümerwechsel bleiben werden.
Von Experten beraten lassen
Die vielen Fragen, die bei einer Unternehmensnachfolge wichtig sind, lassen sich kaum in Eigenregie oder auf die Schnelle beantworten. Daher ist es wichtig, den Rat von Experten einzuholen. Sie können beispielsweise bei Rechtsfragen unterstützen, steuerliche Aspekte erläutern oder einschätzen, und Hinweise geben wie viel die Übernahme eines bestehenden Betriebs insgesamt kosten darf. In diesem Zusammenhang können etwa Banken mit fachlicher Expertise unterstützen. Kurzum: Wer sich mit dem Gedanken einer Unternehmensnachfolge trägt, braucht nicht zu befürchten, das gesamte Projekt alleine stemmen zu müssen.
Finanzierung richtig angehen
Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Nachfolge ist neben der Sondierung eines geeigneten Betriebes, der Analyse dessen Geschäftsmodells und des Zukunftspotenzials die Klärung der Finanzierung, vor allem wie viel Eigenkapital der Jungunternehmer aufbringen kann und soll. Im Allgemeinen wird ein Anteil von etwa 20 Prozent empfohlen, über den Nachfolger beim Kauf eines Unternehmens verfügen sollten. In der Regel ist aber zusätzliches Fremdkapital erforderlich, sei es als Geschäftskredit der Hausbank oder in Form von Ratenzahlungen auf den Kaufpreis. Als weitere Fremdkapitalquelle bieten sich Risikokapitalgeber an. Für Venture-Capital-Firmen gelten zukunftsfähige mittelständische Betriebe mit überzeugender Digital-Strategie als interessantes Investment.
Bund und Länder haben ebenfalls verschiedene Programme zur Unterstützung von Existenzgründern aufgelegt, die auch Firmennachfolgen abdecken. Beispiele hierfür sind der „ERP-Gründerkredit“ und das „ERP-Kapital für Gründung“ der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Und mit dem Mikrokreditfond Deutschland hat der Bund ein Bürgschaftssystem gestartet, das eine weitere Alternative sein kann. Darüber hinaus können sich Nachfolger in Kooperation mit ihrer Hausbank bei diversen Förderprogrammen der Bundesländer bewerben.
Eine wichtige Entscheidungshilfe für Fremdkapitalgeber sind in diesem Zusammenhang die Jahresabschlüsse des zu übernehmenden Betriebes mit Gewinn- und Verlustrechnung der vergangenen drei Jahre sowie die entsprechenden hinterlegten Sicherheiten des Kaufinteressenten. Neben den reinen Finanzaspekten spielen aber auch Aspekte wie das jeweilige Marktumfeld, die Kunden- und Wettbewerbssituation sowie der Digitalisierungsgrad des Betriebs und die daraus abzuleitenden Potenziale eine wichtige Rolle.
Kaufpreis umfassend ermitteln
Ein weiterer Meilenstein und nicht selten auch eine Herausforderung im Rahmen eines Übernahmeprozesses ist die Ermittlung des Kaufpreises für das mittelständische Unternehmen. Klassische Ansätze wie das EBIT-Verfahren oder die Orientierung am Ertragswert greifen dabei häufig zu kurz. Auch immaterielle Werte wie Geschäfts- oder Produktideen, das implizite Know-how der Mitarbeiter, die Unternehmenskultur, etablierte Beziehungen zu Lieferanten und Kunden sowie die Marktposition sollten in die Bewertung einfließen. Nicht zu unterschätzen ist zudem der emotionale Wert, der insbesondere beim Verkauf von Familienunternehmen eine wichtige Rolle spielt. Denn hier geht es vielen scheidenden Firmenlenkern weniger um rein finanzielle Aspekte als vielmehr um die Anerkennung ihres Lebenswerks.
Übergabeprozess nachhaltig planen
Ist die Entscheidung für eine Übernahme gefallen, sollte sich ein sauber strukturierter Übergabeprozess anschließen. Dieser ist in zweierlei Hinsicht sinnvoll. Zum einen wird der neue Eigentümer in die Strukturen des Unternehmens eingeführt. Der Vorgänger macht ihn mit notwendigen operativen Aufgaben vertraut und stellt ihn bei Kunden und Geschäftspartnern vor. Zum anderen kann der ehemalige Firmenlenker Vertrauen zu seinem Nachfolger aufbauen. Denn wer sein eigenes Unternehmen ein gesamtes Berufsleben lang aufgebaut hat, tut sich oft schwer, sein Lebenswerk in fremde Hände zu legen. Eine gemeinsame Übergangszeit hilft somit beiden Seiten – fachlich und emotional.
Digitale Neuausrichtung berücksichtigen
Unternehmensnachfolger sollten zudem überprüfen, inwieweit die Digitalisierung im Betrieb bereits fortgeschritten ist. Steckt die Entwicklung diesbezüglich noch in den Kinderschuhen, haben Nachfolger die Gelegenheit, Prozesse zu überdenken und als Firma innovativer am Markt aufzutreten. Nur wer Arbeitsabläufe und Geschäftsmodelle digital abbilden kann, bleibt konkurrenzfähig – auch im globalen Wettbewerb. Unternehmensnachfolge kann in diesem Zusammenhang die Chance sein, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen und eine neue, digitalere Unternehmenskultur zu implementieren. Eine sinnvolle Maßnahme in diesem Kontext ist es, das digitale Know-how der Mitarbeiter in Form von Weiterbildungen oder Workshops zu fördern. Sind weitere Kompetenzen erforderlich, können Nachfolger neue Stellen schaffen und diese mit von außen rekrutierten Fachkräften besetzen, die über entsprechende digitale Kenntnisse verfügen.
Kontakt zu den Mitarbeitern suchen
Bei Nachfolgeprozessen ist von Beginn an ein enger Dialog mit den Mitarbeitern notwendig. Eine offene Kommunikation hilft dabei, die Akzeptanz geplanter Veränderungen wie Modernisierungsmaßnahmen bei der Belegschaft zu steigern. Indem Unternehmensnachfolger auf jeden einzelnen persönlich eingehen und neue Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, können sie Vertrauen zu den Beschäftigten aufbauen und den Teamgeist stärken.
Es muss nicht immer Gründen sein
Die Unternehmensnachfolge ist ein solider Weg in die Selbständigkeit. Wer einen bestehenden Betrieb übernimmt, profitiert beispielsweise davon, dass es zu Lieferanten und Partnern bereits eine langjährige vertrauensvolle Beziehung gibt. Kunden und oft auch Stammkunden sind vorhanden. Und nicht zuletzt bilden die Mitarbeiter ein eingespieltes Team.
Der Autor Jan Friedrich ist Vice President Field Marketing Central Europe bei Sage, das Gründern, Selbständigen und kleinen Unternehmen Desktop-Software für Auftragsbearbeitung, Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung bietet.


