Aktuelle Events
Klug verhandelt ist die halbe Miete
Was ist bei der Anmietung von Geschäftsräumen zu beachten?
Autor: RA Dr. Babette GäbhatdWas ist bei der Anmietung von Räumen für das eigene Unternehmen zu beachten? Was sollte im Mietvertrag auf jeden Fall geregelt sein? Was muss man akzeptieren?
Geschäftsraummiete, Wohnraummiete und Pacht
Geschäftsraummiete liegt immer dann vor, wenn Räume nach dem vertraglichen Zweck zur gewerblichen oder freiberuflichen Nutzung angemietet werden. Bei Mischmietverhältnissen mit Wohn- und Gewerberaum gilt das Geschäftsraummietrecht, wenn mehr als die Hälfte der Gesamtfläche der Räume gewerblich genutzt wird. Die Rechtsvorschriften zur Pacht gelten, wenn ein komplett betriebsbereites Objekt, wie z.B. eine Gaststätte, zur Verfügung gestellt wird.
Mündlich oder schriftlich?
Um einen wirksamen Mietvertrag abzuschließen, müssen sich die Vertragsparteien über die „Gebrauchsüberlassung einer Mietsache gegen Entgelt für eine bestimmte Mietdauer“ verständigen. Ein Mietvertrag über Geschäftsräume kann auch mündlich geschlossen werden. Allerdings bedürfen Mietverträge, die für einen längeren Zeitraum als ein Jahr abgeschlossen werden, der Schriftform. Es empfiehlt sich aus Beweisgründen auf jeden Fall der Abschluss eines schriftlichen Mietvertrags.
Der inhaltlichen Gestaltung des Geschäftsraummietvertrags kommt besondere Bedeutung zu, denn der gesetzliche Schutz des Geschäftsraummieters ist nicht vergleichbar mit den gesetzlichen Schutzbestimmungen des Wohnraummieters. So gelten insbesondere weder Kündigungs- und Bestandsschutz noch die Sozialklausel noch die Vorschriften zur Regelung der Miethöhe und zum Räumungsschutz. Um sicher zu gehen, dass man als gewerblicher Mieter seine Rechtsposition sinnvoll absichert, empfiehlt es sich, anwaltliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen und den Geschäftraummietvertrag sorgfältig zu verhandeln.
Mietgegenstand und Nutzungsbestimmung
Das Gewerberaummietobjekt muss nach Anschrift, Lage und Umfang genau im Vertrag beschrieben sein. Ein Gewerberaummietvertrag enthält häufig auch eine Nutzungsbestimmung, die man aus Mietersicht möglichst weit formulieren sollte, z.B. "zur gewerblichen Nutzung".
Mietzins, Nebenkosten und Kaution
Die Miethöhe kann bei Vertragsabschluss zwischen den Vertragsparteien frei vereinbart werden, wobei ortsübliche Vergleichsmieten ein Maßstab für den geforderten Mietzins sein sollten. Mietwucher ist verboten. Gezahlt wird der Mietzins in monatlichen Beträgen, jeweils zu Beginn eines Monats im Voraus. Grundsätzlich sind nach dem Gesetz mit dem Mietzins alle Nebenkosten (also die Betriebskosten) abgegolten. In der Praxis der Geschäftsraummietverträge werden die Betriebskosten allerdings meist unter Bezugnahme auf die Betriebskosten-Verordnung ganz oder teilweise auf den Mieter umgelegt. Es ist ratsam, die Nebenkostenbestimmungen im Vertrag sehr sorgfältig zu verhandeln.
Mietzeit – am besten mit Verlängerungsoption
Die Laufzeit des Vertrags kann frei vereinbart werden. Es empfiehlt sich, im Fall eines befristeten Mietverhältnisses, eine Verlängerungsklausel vorzusehen, wonach sich das Mietverhältnis über die feste Vertragsdauer hinaus automatisch um eine bestimmte Zeitspanne verlängert, wenn es nicht zum Ablauf der Mietzeit von einer der Vertragsparteien gekündigt wird. Aus wichtigem Grund ist das Mietvertragsverhältnis für beide Parteien jederzeit kündbar.
Die Beendigung einer gewerblichen Tätigkeit oder wirtschaftliche Schwierigkeiten stellen jedoch grundsätzlich keinen wichtigen Grund dar, um das Mietverhältnis zu kündigen, es sei denn, im Vertrag ist ein Sonderkündigungsrecht für den Mieter vorgesehen für den Fall des Nichterreichens konkret genannter Mindestumsatzerwartungen über einen bestimmten Zeitraum. Insgesamt empfiehlt sich ein sehr gut verhandelter individueller Mietvertrag, um das eigene Unternehmen am gewählten Standort viele Jahrzehnte erfolgreich mit überschaubaren Mietkosten etablieren zu können.
Recht für Gründer*innen: Vorsicht bei Minijobber*innen auf Abruf
Was bei der Beschäftigung von Minijobber*innen zu beachten ist, damit aus dem Minijob nicht ungewollt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird.

In zahlreichen Branchen werden Minijobber gern auf Abruf beschäftigt, um die Flexibilität zu wahren. Insbesondere die Gastronomie und Saisonbetriebe profitieren von Beschäftigten, die je nach Arbeitsanfall tätig sind. Was hierbei zu beachten ist, damit aus dem Minijob nicht ungewollt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird, erklärt Tanja Eigner, Rentenberaterin bei Ecovis in Bad Kohlgrub.
Was gilt für Arbeit auf Abruf?
Bei Arbeit auf Abruf erbringt der/die Arbeitnehmende Arbeitsleistungen, deren Umfang vom Arbeitsanfall und auf einseitige Anweisung des Arbeitgebenden beruht. Wer Minijobber*innen auf Abruf beschäftigt, muss die arbeitsrechtlichen Vorschriften beachten: Wenn im Minijob keine wöchentliche Arbeitszeit festgelegt wurde, gilt nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz die gesetzlich vorgeschriebene Wochenarbeitszeit von 20 Stunden.
Wann Arbeitgebende einen Phantomlohn zahlen müssen
Selbst wenn Minijobber*innen weniger als 20 Stunden gearbeitet haben, besteht dennoch für 20 Stunden am Ende des Monats ein Vergütungsanspruch (Phantomlohn). Arbeitet also ein(e) Minijobber*in auf Abruf ohne entsprechende Vereinbarung beispielsweise nur acht Stunden pro Woche, muss der Arbeitgebende dennoch 20 Stunden vergüten. Dieser Phantomlohn ist auch die Grundlage für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge. Dadurch kann die Minijobgrenze schnell überschritten werden. Die Folge: Arbeitgeber*innen können ihre Arbeitnehmenden nicht mehr als Minijobber beschäftigen. Stattdessen sind sie bei der Krankenkasse als sozialversicherungspflichtig zu melden.
Die aktuelle Mindestlohngrenze
Damit das Arbeitsentgelt unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze (556 Euro monatlich für 2025) liegt, können Arbeitgebende und Arbeitnehmende unter Zahlung des Mindestlohns maximal eine monatliche Arbeitszeit von 43,37 Stunden vereinbaren. Wöchentlich wäre dies eine Arbeitszeit von maximal zehn Stunden. Höhere Stundenlöhne bedeuten folglich eine monatlich geringere Arbeitszeit.
Worauf Arbeitgebende achten sollten
Arbeitgebenden wird daher dringend empfohlen, die Arbeitsverträge zu kontrollieren und die Dauer der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit schriftlich in einer Abrufvereinbarung festzuhalten. Diese muss auch eine Mindest- oder Höchstarbeitszeit enthalten. Je nach vereinbarter Grenze darf der/die Minijobber*in die Mindestarbeitszeit um nicht mehr als 25 Prozent überschreiten und die Höchstarbeitszeit um nicht mehr als 20 Prozent unterschreiten. Die Deutsche Rentenversicherung führt alle vier Jahre eine Betriebsprüfung durch. Wer die wöchentliche Arbeitszeit nicht festhält, muss möglicherweise Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen.
Alternative: Arbeitszeitkonto
Alternativ besteht auch die Möglichkeit, ein Arbeitszeitkonto zu vereinbaren. In diesem Fall erhält der/die Arbeitnehmende ein vertraglich vereinbartes, monatlich gleichbleibendes Arbeitsentgelt. Je nach Bedarf kann der/die Minijobber*in unterschiedlich viele Stunden im Monat arbeiten und sammelt dabei Plus- oder Minusstunden auf dem Arbeitszeitkonto. Diese müssen die Minijobber*innen innerhalb eines vereinbarten Zeitraums ausgleichen. Aber auch hier sind wichtige Regelungen zu beachten. Es wird daher immer empfohlen, das Thema mit einem/einer Sozialversicherungsexpert*in zu besprechen.
Mindestlohn 2025 - das musst du wissen!
Was sich seit dem 1.1.2025 rund um den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland geändert hat und was jetzt steuerrechtlich zu beachten ist.

Seit dem 1. Januar 2025 gilt ein höherer gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland. Die Erhöhung bringt nicht nur Anpassungen beim Stundenlohn mit sich, sondern wirkt sich auch auf Minijobs und spezielle Regelungen für bestimmte Personengruppen aus. Im Folgenden liest du, was der neue Mindestlohn konkret bedeutet, wer davon profitiert und wie sich die Änderungen auf die Aufzeichnungspflichten auswirken.
Mindestlohn 2025: Höhe und Bedeutung
Seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 wurde dieser von damals 8,50 Euro auf 12,41 Euro im Jahr 2024 schrittweise gesteigert. Zum Jahresbeginn 2025 gilt ein erhöhter gesetzlicher Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde. Dieser Betrag gilt grundsätzlich für alle Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland – unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Arbeitnehmer*innen, dem Unternehmenssitz des Arbeitgebenden oder dem Wohnsitz des/der Beschäftigten. Damit fallen auch grenzüberschreitend tätige Arbeitskräfte und Saisonarbeitenden unter den Schutz des Mindestlohns.
Bei monatlichen Festvergütungen, Akkord- oder Stücklöhnen müssen Arbeitgebende den Stundenlohn rechnerisch ermitteln. Denn auch in diesen Fällen dürfen Arbeitgebende den Mindestlohn nicht unterschreiten.
Mindestlohn 2025: Auswirkungen auf Minijobs
Seit 2022 ist die Verdienstgrenze für Minijobs dynamisch an den Mindestlohn gekoppelt. Das bedeutet, dass mit jeder Mindestlohnerhöhung auch die Obergrenze für Minijob-Einkünfte angepasst wird. Ab Januar 2025 dürfen Minijobber*innen bis zu 556 Euro monatlich verdienen, was einer Arbeitszeit von etwa 43,3 Stunden pro Monat entspricht. Diese Anpassung sorgt dafür, dass Minijobber*innen nicht mit steigendem Mindestlohn ihre Arbeitszeit reduzieren müssen.
Für Minijobber*innen ist es besonders wichtig, die Auswirkungen des Mindestlohns auf ihre Arbeitszeit und das monatliche Einkommen im Blick zu behalten. Arbeitgebende und Arbeitnehmende sollten vor Jahreswechsel die Stunden und den Stundenlohn überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verdienstgrenze eingehalten wird und es nicht zu ungewollten Überschreitungen kommt.
Da sich mit der Erhöhung des Mindestlohns auch die Verdienstgrenzen für Minijobs und Midijobs verändern, ist es für Arbeitgebende und Beschäftigte wichtig, die aktuellen Regelungen genau zu kennen. Besonders Midijobber*innen profitieren von den neuen Einkommensgrenzen, da sie durch angepasste Sozialversicherungsbeiträge netto oft mehr verdienen.
Wer ist vom Mindestlohn ausgenommen?
Obwohl der Mindestlohn fast flächendeckend in Deutschland gilt, gibt es einige gesetzlich festgelegte Ausnahmen. Die Regelungen des Mindestlohngesetzes gelten nicht
- bei Praktikant*innen, die ein Pflichtpraktikum im Rahmen ihrer Schul- oder Berufsausbildung oder eines Studiums absolvieren,
- für Orientierungspraktika bis drei Monaten,
- für freiwillige Praktika während eines Studiums oder einer Ausbildung. Sie sind für maximal drei Monate vom Mindestlohn ausgenommen. Das gilt jedoch nur, wenn kein vorheriges Praktikumsverhältnis mit dem Unternehmen bestanden hat,
- für Personen unter 18 Jahren, die noch keine Berufsausbildung abgeschlossen haben,
- für Auszubildende, denn für sie gibt es seit 2020 spezielle Mindestausbildungsvergütungen,
- für ehrenamtlich Tätige und Langzeitarbeitslose: Letztere sind in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung vom Mindestlohn befreit.
Diese Ausnahmen berücksichtigen die besonderen Bildungs- und Berufsorientierungsbedürfnisse der jeweiligen Gruppen und sind darauf ausgelegt, zusätzliche Hürden auf dem Weg in den Arbeitsmarkt zu vermeiden.
Mindestlohn 2025: Aufzeichnungspflichten für Arbeitgebende
Ein wichtiger Bestandteil des Mindestlohngesetzes ist die umfassende Dokumentationspflicht für Arbeitgebende. Sie ist besonders wichtig für Minijobs, kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse und Beschäftigte in bestimmten Branchen mit erhöhtem Risiko für Lohnunterschreitungen, zum Beispiel im Baugewerbe, in der Fleischwirtschaft, im Gaststättengewerbe oder im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Arbeitgebende müssen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzeichnen oder aufzeichnen lassen. Die Dokumentationen sind spätestens sieben Tage nach der jeweiligen Arbeitsleistung beim Arbeitgebenden zu hinterlegen. Die Dokumentationen sind für mindestens zwei Jahre – besser vier Jahre – aufzubewahren.
Mindestlohn 2025: Bußgelder bei Verstößen
Die Pflicht zur Aufzeichnung soll die Kontrolle der Einhaltung des Mindestlohns durch den Zoll erleichtern. Arbeitgebende, die diese Vorschriften nicht einhalten, riskieren hohe Bußgelder, die bis zu 30.000 Euro betragen können. Ein Bußgeld von über 2.500 Euro kann zudem zum Ausschluss von öffentlichen Aufträgen führen. Auch Verstöße gegen den Mindestlohn sind Ordnungswidrigkeiten und streng sanktioniert. Arbeitgeber*innen, die den Mindestlohn nicht einhalten, drohen Bußgelder von bis zu 500.000 Euro.
Arbeitgebende müssen genau prüfen
Die Erhöhung des Mindestlohns bedeutet für Arbeitgebende, dass sie prüfen müssen, ob bei ihren Minijobber*innen und Geringverdiener*innen der gesetzliche Mindestlohn von 12,82 Euro eingehalten ist. Dazu sollten sie die bestehenden Arbeitsverträge prüfen lassen. Denn Fehler können schnell zu Nachforderungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Bußgeldern führen.
Der Autor Andreas Islinger ist Rentenberater und Steuerberater bei Ecovis in München.
Gleiches Recht für alle
Obwohl es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz bereits lange gibt, wissen die wenigsten, was es damit alles auf sich hat. Und das kann sehr teuer werden. Was Sie als Arbeitgeber über das Gesetz wissen sollten.
Während Regelungen für Diskriminierungsverbote früher verstreut in verschiedenen Vorschriften und Gesetzen zu finden waren, hat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eine einheitliche gesetzliche Grundlage geschaffen. Darin ist sowohl der Anspruch auf Entschädigung als auch der auf Schadensersatz erstmals klar geregelt. Zur Anwendung kommt das Gesetz immer dann, wenn eine Benachteiligung oder Diskriminierung von Bewerbern, Mitarbeitern oder auch von Kunden vorliegt bzw. vermutet wird. Relevant wird das AGG für Gründer spätestens dann, wenn der erste (freie) Mitarbeiter eingestellt werden soll und eine Stellenausschreibung zu formulieren ist.
Was untersagt das AGG?
Per Gesetz verboten sind nicht nur belästigende Verhaltensweisen wie Mobbing oder sexuelle Belästigung, sondern auch jede Art von unmittelbarer und mittelbarer Benachteiligung. Unter einer unmittelbaren Benachteiligung ist zu verstehen, dass eine Person aufgrund der im AGG genannten Kriterien schlechter behandelt wird als eine andere und daher beispielsweise nicht eingestellt wird. Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn Vorschriften oder Verfahren im Unternehmen eine Person ohne sachliche Rechtfertigung benachteiligen. Was heißt das?
AGG-sichere Stellenanzeigen
Wer in einer Stellenanzeige „einen persönlichen Assistenten“ oder eine „junge Aushilfe“ sucht, begibt sich bereits auf dünnes Eis. Denn diese geschlechts- oder altersbezogenen Formulierungen sind unzulässig. Ernsthaft an der Stelle interessierte Bewerber können die Stellenausschreibung als Indiz für eine Diskriminierung sehen und innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Nichteinstellung eine Entschädigung verlangen. Diese liegt im Ermessen des Arbeitsgerichts und ist nur für den Fall auf bis zu drei Monatsgehälter gedeckelt, dass der Bewerber auch bei einer diskriminierungsfreien Auswahl nicht eingestellt worden wäre. Zwar lässt sich aus einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot kein Beschäftigungsverhältnis begründen, dennoch lohnt sich die bewusste Formulierung von geschlechtsneutralen Stellenausschreibungen. Geschlechtsneutral muss dabei nicht nur die Überschrift, sondern auch das Kleingedruckte formuliert sein.
Auf Nummer Sicher gehen Sie, wenn Sie die im Job zu erledigenden Tätigkeiten in den Mittelpunkt stellen und keine detaillierten Anforderungen formulieren. Gefährlich können selbst Formulierungen wie „stresserprobt“ oder „belastbar“ sein, da diese möglicherweise behinderte Bewerber ausschließen.
EU-U.S. Privacy Shield ist ungültig - und nun?
Aus für Google, Facebook & Co. nach dem EuGH-Urteil „Schrems II“? Welche Auswirkungen das EuGH-Urteil auf die Nutzung von US-Tools und die Gestaltung deiner Online-Angebote wirklich hat.
In einer viel beachteten Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof am 16. Juli 2020 das sog. EU-U.S. Privacy Shield für ungültig erklärt. Was bedeutet das in der Praxis? Nach manchen Äußerungen der Datenschutzaufsichtsbehörden müssen jetzt alle Übermittlungen personenbezogener Daten in die USA gestoppt werden. Sofort. Das wäre das Ende für die Einbindung von Google Tools, die unternehmerische Nutzung von Facebook oder auch von Service Tools wie Salesforce, Monday u.v.m. Aber ist die Lage wirklich so ernst?
Im Unternehmensalltag sind die helfenden digitalen Tools kaum noch wegzudenken, das CRM-System bis hin zur Reisebuchung oder Projektmanagement ist selbstredend digital. In den unternehmerischen Online-Angeboten sind etliche Tools von Drittanbietern eingebunden, Google analysiert die Website-Nutzung, der Facebook-Zählpixel hilft bei passgenauer Werbung und Vimeo garantiert das optimale Bewegtbild-Erlebnis.
Etliche dieser Tools werden dabei von US-Unternehmen bereitgestellt. Auf alle diese Tools hat das EuGH-Urteil vom 16. Juli 2020 daher ganz erhebliche Auswirkungen.
Warum?
Wenn ein Unternehmen personenbezogene Daten verarbeitet, muss es sicherstellen, dass das datenschutzkonform erfolgt. Dafür braucht es auf erster Stufe zunächst eine Erlaubnis, diese Daten überhaupt zu verarbeiten. Wenn die Daten den Europäischen Wirtschaftsraum verlassen (also etwa auf Servern gespeichert werden, die in den USA stehen), muss das Unternehmen auf zweiter Stufe zusätzlich noch absichern, dass in dem Zielland auch ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht. Um diese zweite Stufe dreht sich das EuGH-Urteil.
Bisher nämlich war für die USA auf zweiter Stufe ein angemessenes Datenschutzniveau einfach nachzuweisen, wenn sich der Vertragspartner in den USA unter dem EU-U.S. Privacy Shield zertifiziert hatte. Die meisten großen Unternehmen hatten das erledigt und so konnten wir hier in der EU sehr einfach Daten auch in die USA schicken. Das geht jetzt nicht mehr so einfach. Das EU-U.S. Privacy Shield ist nach der EuGH-Entscheidung nämlich unwirksam. Es ist schlicht und einfach „weg“.
Was tun?
Unternehmen müssen auf die Suche nach einer anderen Möglichkeit gehen, ein angemessenes Datenschutzniveau auf der zweiten Stufe abzusichern (oder die Datenübermittlung sofort stoppen). Das heißt konkret:
1. Analyse: Du musst in deinem Unternehmen auf die Suche gehen, wo personenbezogene Daten in Drittländer außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Das kann bei Einsatz von digitalen Tools schnell der Fall sein, wenn die Server weltweit platziert sind.
2. Prüfe dann, wie dafür das angemessene Datenschutzniveau abgesichert ist. Typische Mittel dafür sind sog. Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission wie früher das EU-U.S. Privacy Shield für die USA oder auch sog. Standardvertragsklauseln (standard contractual clauses – SCC), die von der EU-Kommission veröffentlicht wurden und oft in Data Processing Agreements einbezogen werden.
3. Bei allen Übermittlungen, die sich auf das EU-U.S. Privacy Shield stützen, musst du sofort handeln: Gibt es eine alternative Lösung für ein angemessenes Datenschutzniveau? Oft können dies Standardvertragsklauseln sein.
4. Bei allen Übermittlungen, die sich auf Standardvertragsklauseln stützen, besteht angesichts des EuGH-Urteils jetzt auch akuter Handlungsbedarf (auch außerhalb der USA):
- Die Standardvertragsklauseln müssen 1:1, so wie sie von der EU-Kommission veröffentlicht wurden, vereinbart werden.
- Du musst überprüfen, ob dein Vertragspartner die Standardvertragsklauseln auch tatsächlich einhalten kann und einhält. Diese Prüfpflicht ist so klar vom EuGH jetzt ganz neu formuliert worden und gerade für die USA wichtig: Kann dein Vertragspartner überhaupt ausschließen, dass der US-Geheimdienst auch deine Daten einsieht? Du musst hier aktiv werden und deinen Vertragspartner dokumentiert danach fragen. Notwendig wird eine kleine Due Diligence (die du auf Nachfrage auch der Aufsichtsbehörde zeigen musst).
- Ob US-Unternehmen, die elektronische Kommunikationsdienste anbieten, den Zugriff von US-Geheimdiensten unterbinden können, ist gerade ziemlich fraglich. Wenn nicht, dann können auch die Standardvertragsklauseln die Übertragung in die USA nicht retten. Helfen könnte dann im Einzelfall etwa noch eine wirksame Verschlüsselung der übertragenen Daten.
5. Denkbar sind auch noch andere Mittel, um ein angemessenes Datenschutzniveau sicherzustellen. So kann eine Verschlüsselung in Kombination mit den Standardvertragsklauseln helfen, im Einzelfall können auch Einwilligungen der Betroffenen eine taugliche Grundlage sein.
6. Findet sich kein anderes, gutes Mittel, muss die Datenübermittlung gestoppt werden und die Daten abroad müssen zurückgeholt werden. Geschieht dies nicht, drohen Beschwerden, Klagen und gar schmerzhafte Bußgelder. Die Datenschutzaufsichtsbehörden legen gerade ihren Fokus auf dieses Thema und greifen zunehmend auch zu schmerzhaft hohen Bußgeldern.
Und was bedeutet dies nun ganz konkret?
Du musst aktiv werden, US-Transfers identifizieren und entweder stoppen oder mit den US-Unternehmen gemeinsam nach alternativen Absicherungen suchen. Das höchste Bußgeldrisiko für dein Unternehmen entsteht, wenn du trotz des EuGH-Urteils „Schrems II“ und US-Datentransfers jetzt gar nichts tust.
Die Autorin Dr. Kristina Schreiber ist auf die rechtliche Begleitung von Digitalisierungsprojekten spezialisiert und Partnerin bei Loschelder Rechtsanwälte
So nutzen Sie Servicemails rechtssicher für Ihre Werbung
Bestellbestätigungen oder Versandbenachrichtigungen per E-Mail können Ihnen als wertvolle Möglichkeit zur Werbung dienen. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass diese Werbung nicht immer zulässig ist und es somit schneller als gedacht zu Wettbewerbsverstößen und juristischen Nachspielen kommen kann.
Marketer nutzen Transaktionsmails, um Kunden ergänzend über Produkte und Angebote zu informieren (Cross-Selling). Hintergrund: Nach einem Kauf sind die Kunden in besonderem Maße positiv gestimmt und auch für weiterführende Produkte offen. Gleiches gilt für hochwertigere und teurere Produkte (Up-Selling). Auch diese können in einer Transaktionsmail beworben und Kunden gezielt stimuliert werden. Rechtlich stellt sich aber die Frage, ob solche E-Mails überhaupt Werbung enthalten dürfen, denn Kunden müssen in den Erhalt von Werbe-E-Mails einwilligen.
Durch das Erfordernis der Einwilligung soll sichergestellt werden, dass E-Mail-Adressaten nicht aufgrund massenhafter und unerwünschter Werbung unzumutbar belästigt würden (Ausuferungsgefahr). Schließlich müssen sie sich mit jeder E-Mail befassen – selbst wenn es nur ums Löschen geht. Für Transaktions- oder Servicemails gilt dies jedoch nicht. Der Grund: Eine unzumutbare Belästigung der Empfänger kann überhaupt nicht vorliegen, da sie sich – wie erwähnt – mit diesen E-Mails befassen müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie Werbung enthalten oder nicht.
Sogenannte Transaktions- oder Systemmails kommen vor allem im E-Commerce zum Einsatz. Dabei handelt es sich um automatisierte E-Mails, deren Versand durch die Kunden im Rahmen einer Transaktion angestoßen wird. Meist geht es dabei um Bestellbestätigungen, Auftragsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen oder Rechnungen. Für das Online-Marketing sind solche Servicemails deshalb interessant, weil der Kunde sich mit ihnen beschäftigen muss. Am Beispiel einer Rechnung wird das deutlich. Servicemails sind deshalb auch durch eine hohe Öffnungsrate gekennzeichnet. Experten sprechen von bis zu 80 Prozent.
Werbung im Internet und Vertragsabschluss
Viele halten das Internet für einen rechtsfreien Raum. Dieser Irrtum kann teuer werden. Hier erfahren Sie, was Sie beachten sollten, wenn Sie eine Internet-Präsenz aufbauen und betreiben wollen.
Betreiber geschäftlicher Internetpräsenzen werden immer wieder zu Adressaten kostspieliger Abmahnungen und einstweiliger Verfügungen, veranlasst durch Konkurrenten und Dritte. Denn viele Anbieter von Homepages und Webshops sind aufgrund der vergleichbar jungen Materie „Internetrecht“ verunsichert, wenn es um die rechtliche Bewertung ihres eigenen Handelns im Netz geht. Hier bringen wir Licht ins Dunkel.
Werbung im Internet
Wer zu geschäftlichen Zwecken eine Homepage oder einen Webshop betreibt, möchte auch durch Werbung im Internet auf seine Angebote aufmerksam machen. Vorsicht ist hier geboten, da ansonsten rechtliche Konsequenzen drohen können. Weit verbreitet ist etwa das Versenden von Werbemails. Diese Form der Werbung erscheint besonders vorteilhaft, da E-Mails sich für die massenhafte Versendung von Werbebotschaften gut eignen. E-Mail-Werbung ist kostengünstiger, arbeitssparender, schneller und gezielter einsetzbar als andere Werbemittel.
Bereits im Jahr 2004 hat sich der Bundesgerichtshof (BGH) mit der Zulässigkeit unverlangter E-Mail-Werbung auseinandergesetzt und entschieden, dass die Zusendung solcher E-Mails grundsätzlich gegen die guten Sitten im Wettbewerb verstößt und nur ausnahmsweise zulässig ist. Und zwar dann, wenn der Empfänger ausdrücklich oder konkludent (d.h. ohne ausdrückliche Willenserklärung, aber dennoch rechtlich relevant) sein Einverständnis erklärt hat bzw. wenn bei Gewerbetreibenden ein sachliches Interesse des Empfängers vermutet werden kann.
Unverlangte E-Mail-Werbung ist gerichtlich verfolgbar und kann für den Versender teuer werden. Verschärft wurde dieser Umstand auch durch eine Änderung im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), das in § 7 Abs. 2 Nr. 3 dieses Verbot jetzt ausdrücklich regelt und gleichzeitig die Rechtsprechung des BGH insofern verschärft, als eine vorherige ausdrückliche Einwilligung (nicht mehr nur die sog. konkludente Einwilligung) des Adressaten vorliegen muss.
Privatvermögen schützen
Was bedeutet Inhaber-Haftung, und in welchem Ausmaß kommt sie in der Praxis zum Tragen? Und wie können Sie Ihr Privatvermögen als Unternehmer trotz gesetzlicher Haftung bestmöglich schützen? Hier finden Sie die Antworten.
Persönliche Haftung bedeutet, dass der Unternehmer mit seinem gesamten Privatvermögen für alle seine geschäftlichen Entscheidungen haftet. Zum Privatvermögen gehören nicht nur angespartes Geld, Autos, Wertpapiere, private wie geschäftliche Ausstattung und sonstige bewegliche Gegenstände, sondern auch Immobilien, die auf seinen Namen im Grundbuch eingetragen sind, ebenso wie Forderungen gegen Dritte, Anwartschaften und sonstige geldwerte Rechtspositionen. In alle diese Vermögenswerte dürfen Gläubiger vollstrecken, wenn sie einen rechtskräftigen Titel, also im Regelfall ein rechtskräftiges Urteil gegen den Unternehmer vor Gericht erstritten haben. Die persönliche Haftung bedeutet daher eine erhebliche Bedrohung für den Unternehmer und seine Angehörigen.
Wer haftet, wer nicht?
Die Haftung mit dem Privatvermögen trifft kraft Gesetzes jede Privatperson und jeden Geschäftsmann, wenn derjenige nicht durch gesetzliche Bestimmungen im Rahmen einer Gesellschaft geschützt ist, eine eintrittspflichtige Versicherung abgeschlossen hat oder im Einzelfall mit seinen Kunden oder Gläubigern eine wirksame Regelung zur Haftungsbeschränkung oder zum Haftungsausschluss getroffen hat. Gesellschaftsrechtsformen, die das Privatvermögen der Inhaber explizit schützen, sind die GmbH, die Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) sowie die Aktiengesellschaft (AG).
Wird keine dieser Gesellschaftsrechtsformen gegründet, tritt der Unternehmer als Einzelunternehmer oder Einzelanbieter am Markt auf. Haben sich mindestens zwei Personen zusammengeschlossen, die ihre Waren oder Dienstleistungen gemeinsam anbieten, liegt eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) in Sinne der §§ 705 ff Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) vor.
Typische Gesellschaften des bürgerlichen Rechts sind Zusammenschlüsse von Freiberuflern wie Ärzten, Anwälten, Übersetzern, aber auch Beratern aller Art oder von sonstigen Anbietern. Ist Zweck der Gesellschaft der Betrieb eines Handelsgewerbes unter einer gemeinsamen Firma, so liegt eine offene Handelsgesellschaft (oHG) in Sinne der §§ 105 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) vor, die im Handelsregister einzutragen ist. Auf die oHG findet, soweit im Handelsgesetzbuch keine Spezialregelungen enthalten sind, ersatzweise das Recht der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts Anwendung.
Einkaufen mit Köpfchen
Was ist beim Wareneinkauf zu beachten? Welche Geschäftsbedingungen des Lieferanten müssen Sie akzeptieren? Was sollte im Einkaufsvertrag auf jeden Fall geregelt sein?
Professioneller Einkauf
Der Einkauf qualitativ sehr hochwertiger Ware zum günstigen Einkaufspreis entscheidet oft über den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Dabei kommt es nicht nur auf die Warenbeschaffenheit selbst an, sondern auch auf die Rahmenbedingungen, die dem Einkauf zugrunde gelegt werden. Der Einkauf kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Im Handel ist Schriftform sinnvoll, da beide Seiten die Belege für ihre Buchhaltung und die Abführung von Steuern brauchen.
Rahmenliefervertrag
Nimmt der einkaufende Unternehmer regelmäßig größere Mengen von Waren bei einem bestimmten Hersteller, Großhändler oder Lieferanten ab, verfügt er über eine stärkere Position im Markt und kann den Abschluss eines Rahmenliefervertrages vorschlagen. Ein solcher individuell verhandelter Rahmenliefervertrag legt alle wichtigen Themen fest und sichert die regelmäßige fristgerechte Belieferung des einkaufenden Unternehmens umfassend ab, da viele zusätzliche Themen aufgenommen werden können, die von großer praktischer Bedeutung sein können. Der Rahmenvertrag gilt dann dauerhaft für die Geschäftsbeziehung.
Produktbeschaffenheit und Pflichtenheft
Bezüglich komplexer Produkte ist die Vereinbarung aller Beschaffenheitsmerkmale sehr wichtig, damit die Ware auch genau den Anforderungen entspricht, die man als Einkäufer für den eigenen Weiterverkauf benötigt. Sorgfältige Produktbeschreibungen werden als „Pflichtenhefte“ bezeichnet. Diese sind sehr zu empfehlen, um spätere Enttäuschungen und Auseinandersetzungen zu vermeiden. Empfehlenswert ist auch die zusätzliche Klarstellung, dass die Ware allen in Deutschland zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden einschlägigen nationalen und EU-rechtlichen Rechtsnormen zu entsprechen hat.
Gewährleistung und Haftung
Wichtig ist es, dass für die Gewährleistung die gesetzlichen Regeln gelten, und der Hersteller, Lieferant oder Großhändler diese nicht wesentlich einschränkt. Viele Hersteller versuchen, die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr ab Warenauslieferung zu beschränken, was über allgemeine Geschäftsbedingungen im Verhältnis zu Unternehmern als Einkäufern zulässig ist. Hier lohnt es sich zu verhandeln, denn günstiger ist es für den Einkäufer, wenn die Gewährleistungsfrist von den gesetzlich vorgesehenen zwei Jahren bestehen bleibt oder sogar auf drei Jahre verlängert wird, was zulässig ist. Insgesamt empfiehlt sich beim regelmäßigen Bezug größerer Warenmengen ein sehr gut verhandelter individueller Rahmenliefervertrag, um für den Einkäufer ungünstige Verkaufsbedingungen des Herstellers, Lieferanten oder Großhändlers wegzuverhandeln.
Für eine Handvoll Euro
Wenn Streitigkeiten mit Geschäftspartnern oder Kunden drohen, bietet die Mediation eine sinnvolle und günstige Alternative zum teuren Rechtsstreit.
Wenn man Gründer fragt, worauf sie besonders stolz sind, dann sprechen sie vielleicht über den ersten großen Auftrag, über die reibungslose Finanzierung durch die Bank oder sie erzählen von der super Stimmung im Gründer-Team. A. Meier und H. Habermehl (Namen von der Redaktion geändert), seit Juli 2010 Inhaber einer eigenen Firma, verweisen hingegen auf einen Passus in ihrem Gesellschaftervertrag. Auf diesen Passus sind sie stolz, denn er beugt vor, falls die beiden Geschäftsführer und Gesellschafter sich einmal nicht mehr so gut verstehen.
Wenn sie sich einmal nicht einigen können oder gar Streit entsteht. Dann, so steht in dem Papier, werde man keinesfalls direkt vor den Kadi ziehen, sondern erst einmal einen unparteiischen Dritten, einen sogenannten Mediator, zu Rate ziehen.„Wir halten beide 50 Prozent der Gesellschafteranteile, da kann es nun einmal zu Patt-Situationen kommen“, erklärt Meier. Und weil solche Situationen der Firma bzw. der Unternehmung nicht schaden sollen, musste das Gründerduo eine Lösung finden – die Mediation.
Killerfaktor Dauerstreit
Bei der Mediation handelt es sich um ein alternatives Konfliktlösungsverfahren, das auf vermittelnden Gesprächen basiert. So soll etwa der Gang vor den Kadi und die damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen abgewendet werden. Zumal Rechtsstreitigkeiten in der Regel lange, oft zu lange dauern. Denn während die Streithähne ihre Energie vor Gericht verpulvern, kocht das Unternehmen auf Sparflamme, wichtige Entscheidungen unterbleiben. Außerdem zerrt ein Prozess derart an den Nerven der Beteiligten, dass das angeknackste Verhältnis zwischen den Streithähnen am Ende meist ganz zerrüttet ist. Auch das zieht negative Konsequenzen für die Firma nach sich, etwa wenn sich ein einst funktionierendes Geschäftsführerduo trennt oder ein wichtiger Geschäftspartner abspringt. Zu dem wirtschaftlichen Schaden kommt hinzu, dass der Ruf ruiniert wird. Am Ende wenden sich Kunden und Mitarbeiter ab. Wenn es richtig schlecht läuft, kann die Firma nach dem Prozess einpacken.
Dieses Risiko können Unternehmen mit Hilfe der Mediation vermeiden. Schließlich geht es hierbei – anders als beim Gerichtsverfahren – nicht darum, um jeden Preis Recht zu bekommen, sondern ganz im Gegenteil darum, zu kooperieren. „Es ist wie mit den Kindern und der Orange“, erklärt Volker Schlehe, Leiter des IHK-MediationsZentrums München die Arbeitsweise: Wenn sich zwei Kinder um eine Orange streiten, würde ein Richter jedem Kind die Hälfte der Frucht zuteilen. Der Mediator aber fragt, was die Kinder mit der Orange machen wollen. „Und dann kommt vielleicht heraus, dass ein Kind den Saft will und das andere die Schale.“
Workation: Rechte und Pflichten
Wer Mobile Working im Ausland plant, muss einiges beachten. Denn der Megatrend Workation birgt einige Tücken – vor allem in puncto Steuern. Steuerrechtler Prof. Dr. Christoph Juhn klärt auf.

Wehende Palmen, weißer Strand, kristallklares Wasser und blauer Himmel, so weit das Auge reicht – an solch paradiesischen Sehnsuchtsorten steigt sogar im grauen Arbeitsalltag der Gute-Laune-Faktor. Also auf die Koffer, fertig, los? Nicht so schnell! Wer das Büro gegen den Beach tauschen möchte, muss einiges beachten. Denn der Megatrend Workation kann einige Tücken bergen – vor allem in puncto Steuern.
Einfach mal weg
Arbeiten, wo andere Urlaub machen? Dank digitaler Vernetzung und zunehmend flexibler Arbeitsmodelle wird Workation immer beliebter – und das selbst in wirtschaftlich volatilen Zeiten. Wie eine aktuelle PwC-Studie zeigt, erwarten viele Beschäftigte mittlerweile von ihren Arbeitgebenden, dass sie es ihnen gestatten, ihre Tätigkeit mobil im Ausland zu verrichten. Dabei sind längst nicht nur Jüngere Workation-affin. Mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent) gibt an, dass ein vorhandenes Workation-Angebot ein wichtiges Kriterium bei der Jobwahl sei. Beinahe jeder Dritte (30 Prozent) würde sogar ein Stellenangebot ausschlagen, sollte die Firma keine Remote-Work-Optionen im Ausland bieten. Bei den 18- bis 29-Jährigen steigt die Zahl auf 45 Prozent. Entsprechend wichtig ist es, sich möglichst umfassend mit Workation zu befassen und das Thema transparent zu kommunizieren.
Nicht alles ist überall möglich
Wollen arbeitswütige Sommerfrischler*innen ihren Job im Anschluss an den zweiwöchigen Mittelmeertrip im Strandhotel ausüben, bedarf es zunächst der Zustimmung des Arbeitgebenden. Während Mitarbeitende zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Workation haben, existieren in zahlreichen Firmen bereits standardisierte Prozesse und Guidelines, über die etwa die Personalabteilung Auskunft geben kann. Allerdings zeigt die bereits erwähnte PwC-Studie auch, dass in Unternehmen, die mobiles Arbeiten am Ferienort anbieten, nur eine knappe Mehrheit der Angestellten (52 Prozent) den festgelegten Antragsprozess kennt. Etwa ein Viertel (28 Prozent) weiß zwar, dass es einen Prozess gibt, kennt aber nicht die genauen Schritte, die zum Arbeiten vom Büro an den Strand führen. Und fast jede(r) fünfte Arbeitnehmende (19 Prozent) weiß nicht einmal, ob es überhaupt einen festgelegten Antragsprozess gibt. Dadurch ergibt sich sowohl für Unternehmen als auch für Beschäftigte eine Reihe von Risken. Diese lassen sich jedoch leicht managen – insbesondere, wenn sich beide Parteien neben Arbeits-, Aufenthalts- und Sozialversicherungsfragen auch mit steuerrechtlichen Aspekten auseinandersetzen.
Wo soll’s denn hingehen?
Für Arbeitgebende spielt vor allem der Ort des „Arbeitsurlaubs“ eine entscheidende Rolle. Nicht für jedes Unternehmen kommt Mobile Working am Urlaubsort in einem der weltweit 195 Länder infrage. Anders als bei normalen Dienstreisen beschränken zahlreiche Firmen die Workation-Destination auf die Europäische Union oder Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums. Der Grund: Aufenthalte in sogenannten Drittstaaten benötigen häufig eine Aufenthaltsgenehmigung. Zwar existieren in einigen Ländern Workation- oder Remote-Work-Visa, allerdings ist die Antragsstellung für einen Aufenthaltstitel beziehungsweise eine Arbeitserlaubnis nicht nur langwierig, sondern oft auch mit Extrakosten verbunden. Innerhalb der EU genießen alle Bürger*innen hingegen eine Niederlassungsfreiheit, wodurch sie in jedem der 27 Mitgliedstaaten sesshaft werden und arbeiten können. Das macht den Prozess sowohl für die verantwortliche Personalabteilung als auch für die „Workationeers“ insgesamt einfacher.
In der Regel reicht hier eine Anmeldung beim Ausländeramt beziehungsweise bei der Gemeinde sowie eine A1-Bescheinigung, die Angestellte in ihren Arbeitsferien immer mit sich führen sollten. Denn mit Letzterem weisen sie nach, dass sie während ihrer Workaway-Tätigkeit über ihr Heimatland sozialversichert sind, und müssen keine doppelten Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Ausnahmen bestätigen allerdings auch in der Bürokratie die Regel. So verlangt beispielsweise Belgiens Arbeitnehmerentsendegesetz eine sogenannte LIMOSA-Meldung für alle, die hier temporär arbeiten. Das Online-System erfasst detaillierte Informationen über den Arbeitnehmenden, den Arbeitgebenden, die Art der Tätigkeit und die Dauer des Aufenthaltes. Ziel ist es vor allem, Schwarzarbeit zu verhindern und den sozialen Schutz der entsandten Beschäftigten zu gewährleisten, was mit der ordnungsgemäßen Anwendung des belgischen Arbeits- und Sozialrechts einhergeht.
Andere Länder, andere Regeln
Grundsätzlich fallen Bundesbürger*innen, die nur vorübergehend mobil in der Welt arbeiten, unter das deutsche Arbeitsrecht. Entsprechend müssen sich Arbeitnehmende auch bei zirka vier Wochen Meeresblick und Schirmchendrinks an Vorschriften etwa bezüglich der sicheren Ausstattung des Arbeitsplatzes in einem Co-Working-Space oder der täglich zulässigen Arbeitszeiten richten. Mit einer Ausnahme: Ist eine ausländische Bestimmung günstiger für Arbeitnehmende, gilt mit dem sogenannten Günstigkeitsprinzip immer die für den Workationeer vorteilhaftere Vorschrift. Entsprechend kritisch sollten Unternehmen und Mitarbeitende hier nicht nur im Einzelfall prüfen, ob und unter welchen Umständen ausländisches Arbeitsrecht greift. Die wichtigsten Punkte sollten in einer Zusatzvereinbarung festgehalten werden.
Die Zeit und die Steuern
Zahlreiche Firmen beschränken ihre Workation-Optionen zudem in zeitlicher Hinsicht. So kann in manchen Unternehmen 54 Tage remote aus 50 Ländern gearbeitet werden, während andere lediglich 20 Tage in 27 Staaten genehmigen. Das hat nicht zuletzt auch steuerliche Gründe, denn Arbeiten aus dem Ausland kann sowohl eine Einkommensteuerpflicht der/des Arbeitnehmenden als auch eine Lohnsteuerverpflichtung des Arbeitgebenden im Ausland auslösen. Ob zusätzliche Abgaben an die Finanzbehörde des Gastlands abgeführt werden müssen, hängt vorrangig davon ab, wie lange die Tätigkeit dort ausgeübt wird. Für gewöhnlich können in Deutschland steuerlich ansässige Arbeitnehmende bis zu 183 Tage im Jahr remote auf Reisen arbeiten, ohne dass es sich steuerlich auswirkt, wobei dies auch von der individuellen Einschätzung des jeweiligen Finanzamts abhängt. Menschen, die mehr als die Hälfte des Jahres mobil in der Welt tätig sind, gelten auch im Gastland als steuerlich ansässig, wodurch eine doppelte Erklärungspflicht entsteht. Die genaue Höhe der Abgaben ist dabei individuell und unter Berücksichtigung des jeweiligen Rechts sowie der einschlägigen Doppelbesteuerungsabkommen zu klären.
Achtung: Betriebsstätte
Mobile Working im Ausland kann bei Arbeitgebenden auch für einen hohen administrativen Aufwand sorgen, beispielsweise in Form von Registrierungs-, Erklärungs-, Buchführungs- und sonstigen Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten. Und diese sollten sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Steuerbehörden legen bei Prüfungen mittlerweile vermehrt Augenmerk auf mögliche Betriebsstättengründungen durch Beschäftigte, die vorübergehend mobil in der Welt arbeiten. Unter bestimmten Voraussetzungen kann im Rahmen eines Workation-Aufenthalts eine neue Betriebstätte begründet werden. Besondere Aufmerksamkeit schenken Kontrolleur*innen dabei Mitarbeitenden, die befugt sind, Verträge im Namen des Unternehmens zu schließen – also Organmitglieder oder Führungskräfte, die beispielsweise Projekte leiten oder anderen wesentlichen Geschäftstätigkeiten nachgehen. Sollte hier die Gründung einer Betriebsstätte im Ausland festgestellt werden, hat das nicht nur bürokratische und rechtliche Folgen, sondern potenziell auch steuerliche. Im Ernstfall kann es sogar zu einer Verlagerung der Erträge ins Ausland und einer doppelten Besteuerung der Unternehmensgewinne kommen.
Der Autor Prof. Dr. Christoph Juhn ist Professor für Steuerrecht, Steuerberater und besitzt einen Master of Laws. 2015 gründete er die JUHN Partner GmbH und 2017 die JUHN BESAU GmbH. Parallel dazu betreibt der Steuerprofi unter @juhnsteuerberater einen erfolgreichen YouTube-Kanal.
Genussrechte – eine bessere Alternative der Mitarbeitendenbeteiligung?
Seit der Verabschiedung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes wird eine bisher wenig beachtete Methode der Mitarbeitendenbeteiligung für Jungunternehmen interessant: Genussrechte. Warum es sich lohnt, diese Alternative genauer zu betrachten.
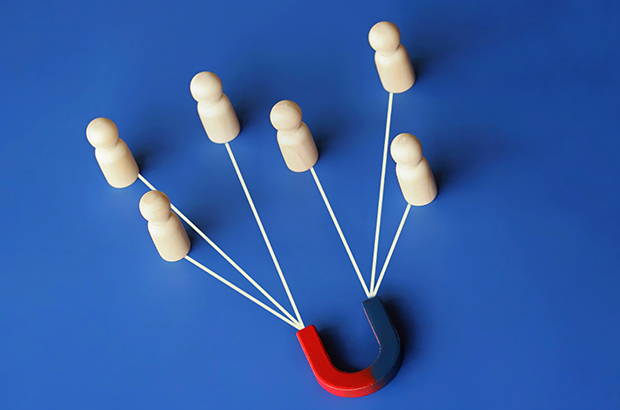
Beteiligungen für Mitarbeitende sind für junge Unternehmen essentiell, um auf dem Arbeitsmarkt um die besten Talente konkurrieren zu können. Arbeitnehmende müssen sich dank gut ausgestalteter Beteiligungsprogramme nicht mehr zwischen lukrativem Gehalt und innovativem Arbeitgebenden entscheiden – wovon insbesondere Start-ups profitieren.
Die technische Umsetzung eines Beteiligungsprogramms für Mitarbeitende kann auf unterschiedliche Arten und Weisen erfolgen. Aktuell sind in Deutschland Virtual Stock Option Plans (VSOPs) die gängige Form in der Praxis. Doch seit der Verabschiedung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes wird eine weitere – bisher wenig beachtete – Methode für Jungunternehmen interessant: Genussrechte. Doch welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben Genussrechte und VSOPs und warum lohnt es sich, diese Alternative genauer zu betrachten?
Virtuelle Beteiligung
Im deutschen Venture Capital-Markt werden Mitarbeitendenbeteiligungen typischerweise durch virtuelle Anteile abgebildet (VSOPs). Mitarbeiter*innen werden dabei wirtschaftlich so gestellt, als hätten sie eine echte (gesellschaftsrechtliche) Beteiligung am Unternehmen erhalten. Allerdings erhalten Beschäftigte bei VSOPs nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen das Unternehmen. Das bedeutet, dass sie im Falle eines Exits eine Sonderzahlung erhalten. Dabei ist der Strukturierungs- und Verwaltungsaufwand gering, da Unternehmen zur vertraglichen Beteiligung in der Regel auf standardisierte Verträge zurückgreifen können. Da keine Gesellschaftsanteile übertragen werden, gelangen keine Mitarbeiter*innen in das Cap Table und der Gang zum Notariat bleibt erspart. Nachteilig sind hingegen die steuerlichen Konsequenzen für die Mitarbeitenden: Bei entsprechender Ausgestaltung kommt es zwar zum Zeitpunkt der Ausgabe der virtuellen Beteiligung nicht zu einer Besteuerung der Mitarbeiter*innen. Allerdings unterliegt der Erlös dann bei Zahlung der normalen Lohnversteuerung mit einem Spitzensteuersatz von 45 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.
Genussrechte als Alternative?
Aufgrund aktueller steuerlicher Gesetzesänderungen rückt eine andere Gestaltungsmöglichkeit (wieder) in den Fokus: eigenkapitalähnliche Genussrechte. Im Folgenden werfen wir einen detaillierten Blick auf das Beteiligungsmodell.
Ausgestaltung
Genussrechte können inhaltlich annähernd genauso flexibel ausgestaltet werden wie VSOPs und stellen aus juristischer Sicht ebenfalls keine reale Beteiligung dar, sondern nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen das Unternehmen auf die Beteiligung am Gewinn. Aber auch eine Teilhabe am klassischen Exit-Erlös kann vereinbart werden. Bei der Ausgabe der Genussrechte leistet der Arbeitnehmende entweder eine Kapitaleinlage oder er erhält das Genussrecht schlicht unentgeltlich/verbilligt. Genussrechte können vom Arbeitgeber zu einem beliebigen Nennwert ausgegeben werden und eine Teilhabe am Gewinn und/ oder einem Liquidations-/Exiterlös mit oder ohne Verzinsung sowie mit oder ohne Verlustbeteiligung vermitteln.
Aufwand und praktische Umsetzung
Verträge für Genussrechte können für nahezu jede Gesellschaft maßgeschneidert gestaltet werden. Die Ausgabe obliegt – wie auch bei VSOPs – grundsätzlich der Geschäftsführung. In der Praxis sollte bei der Ausgabe ein entsprechender Gesellschafterbeschluss die Geschäftsführungsmaßnahme flankieren, um mögliche Streitigkeiten in Bezug auf die Wirksamkeit der Maßnahme vorzubeugen. Oftmals ist dies aufgrund von satzungsrechtlichen Zustimmungsvorbehalten ohnehin notwendig.
Der Beteiligungs- und Verwaltungsaufwand ist gering, da Unternehmen – wie bei den VSOPs – auf standardisierte Verträge zurückgreifen können. Formerfordernisse sind nicht gegeben und ein Gang zum Notar ist ebenfalls nicht notwendig.
Die für Mitarbeitendenbeteiligungen üblichen Vesting- bzw. Leaver-Regelungen unterscheiden sich bei den Genussrechten von den VSOPs kaum. Ein Augenmerk sollte bei einem Verfall aufgrund eines Leaver-Events auf die Rückübertragung von Genussrechten an den Arbeitgebenden gelegt werden. Dies sollte im Beteiligungsprogramm geregelt werden.
Steuerliche Vorteile der Genussrechte
Die Gewährung von Genussrechten (wie auch von echten Anteilen) führte bislang zum Zeitpunkt der Zuteilung zu einer lohnsteuerpflichtigen Sachzuwendung in Höhe des Marktwerts der gewährten Beteiligung, auch wenn noch kein Exit-Erlös erzielt wurde (Dry-Income-Problematik). Dafür profitieren echte Anteile sowie Genussrechte von einem linearen Steuertarif für Kapitaleinkünfte mit einem maximalen Steuersatz von 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer (§ 32d EStG).
Zukunftsfinanzierungsgesetz – Steuerliche Begünstigung von Genussrechten
Mit Inkrafttreten des Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) am 1. Januar 2024 hat der Gesetzgeber die Regelungen des § 19a EStG überarbeitet, um die genannte Dry-Income-Problematik zu mildern und um Beteiligungen für Mitarbeitende im Venture Capital-Bereich attraktiver zu machen. Die Vorschrift findet sowohl auf echte Anteile wie auch auf Genussrechte Anwendung.
Eine Dry-Income-Problematik besteht zwar bei VSOPs nicht, denn die Lohnsteuerpflicht fällt bei entsprechender Strukturierung bei VSOPs erst zum Zeitpunkt eines Exits in Höhe des individuellen (progressiven) Steuersatzes mit maximal 45 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer an. Der lineare Steuertarif für Kapitaleinkünfte (max. 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) auf etwaige Wertzuwächse findet im Rahmen der VSOPs jedoch gerade keine Anwendung – im Gegensatz zu eigenkapitalähnlich ausgestalteten Genussrechten. Damit können Genussrechte bei entsprechender Ausgestaltung das „Beste aus beiden Welten“ vereinen: Einen Besteuerungsaufschub im Rahmen der Lohnsteuer für die unentgeltliche/verbilligte Einräumung des Genussrechts und einen niedrigen Steuertarif für Kapitaleinkünfte bei der Realisierung des Wertzuwachses beim Exit. Sollte der Wert des Genussrechts dann niedriger sein als zum Zeitpunkt der Gewährung, ist für die aufgeschobene Lohnsteuer dann auch nur der niedrigere Wert maßgebend.
Bedingungen für den Besteuerungsaufschub
Der Besteuerungsaufschub für etwaig anfallende Lohnsteuer im Zusammenhang mit der unentgeltlichen/verbilligten Einräumung wird unter bestimmten Voraussetzungen gewährt: Zu diesen zählt, dass eine qualifizierte Unternehmensbeteiligung vom Arbeitgebenden zusätzlich zum regulären Arbeitslohn unentgeltlich oder vergünstigt am Unternehmen eingeräumt wird (keine bloße Entgeltumwandlung), die Gründung des Unternehmens nicht länger als 20 Jahre zurückliegt und das Unternehmen zum Zeitpunkt der Einräumung des Genussrechts einen Jahresumsatz von EUR 100 Mio. oder eine Jahresbilanzsumme von EUR 86 Mio. nicht überschreitet sowie nicht mehr als 1.000 Mitarbeitende hat.
Dies stellt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der eigenkapitalähnlichen Genussrechte gegenüber den VSOPs dar. Denn eine Beteiligung über virtuelle Anteile an einem Unternehmen gilt gerade nicht als Vermögensbeteiligung im Sinne des § 19a EstG i.V.m. dem 5. VermBG und profitiert somit – anders als die Genussrechte – nicht von der Begünstigung des § 19a EStG.
Der Besteuerungsaufschub endet nach § 19a EStG erst, wenn entweder das Genussrecht ganz oder teilweise entgeltlich oder unentgeltlich übertragen wird (Exit) oder das Dienstverhältnis beendet wird, spätestens aber nach 15 Jahre. Sofern das Unternehmen gegenüber dem Finanzamt unwiderruflich erklärt, im Exit-Fall für die Lohnsteuer zu haften, endet der Besteuerungsaufschub auch nicht beim Wechsel des Arbeitgebenden oder spätestens nach 15 Jahren, sondern tatsächlich erst beim Exit.
Fazit
Für die Einführung eines Beteiligungsprogramms für Mitarbeitende in Form von eigenkapitalähnlichen Genussrechten bzw. die Umstellung eines bestehenden virtuellen Mitarbeitendenbeteiligungsprogramms (VSOP) auf eigenkapitalähnliche Genussrechte sprechen steuerrechtliche Vorteile. Dazu zählt insbesondere der Besteuerungsaufschub für etwaig anfallende Lohnsteuer im Zusammenhang mit der unentgeltlichen/ verbilligten Einräumung und die Anwendung des linearen Steuersatzes für Kapitaleinkünfte auf etwaige Wertzuwächse. Hierdurch bekommen Start-ups im umkämpften Arbeitsmarkt um die besten Talente starke Argumente im Vergleich zur Konkurrenz.
Allerdings sollten sich Unternehmer*innen durch eine fachkundige Beratung absichern, um Risiken von eigenkapitalähnlichen Genussrechten vorzubeugen. Dazu zählen insbesondere die saubere Strukturierung zur Einhaltung der steuerlichen Erfordernisse sowie die Abwägung mit alternativen Modellen, insbesondere virtuelle und reale Beteiligungsmodelle für Mitarbeitende.
Die Autoren:
Dr. Andreas Demleitner ist Rechtsanwalt & Steuerberater im Bereich Corporate Tax bei PwC und berät als Partner sowohl Start-ups als auch Investor*innen im Venture Capital-Umfeld mit den Schwerpunkten Durchführung von Finanzrunden und Implementierung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen, Andreas.demleitner@pwc.com
Dr. Minkus Fischer, EMBA, ist Local Partner bei PwC Legal im Bereich Legal Deals im Stuttgarter Büro. Er berät seit über zehn Jahren in den Bereichen Corporate/M&A, mit einem Schwerpunkt in Venture Capital-Transaktionen, Minkus.fischer@pwc.com
Stolperstein Verpackungsgesetz
Wer Verpackungen in den Umlauf bringt, muss sich laut Gesetzgeber im Anschluss finanziell an deren Verwertung beteiligen. Wir zeigen, was E-Commerce-Gründer*innen beachten sollten, um rechtssicher zu agieren.

Wer Verpackungen in den Umlauf bringt, muss sich laut Gesetzgeber im Anschluss finanziell an deren Verwertung beteiligen. Das betrifft insbesondere Gründer*innen im E-Commerce, deren Waren in den meisten Fällen per Paketdienst oder Spedition zugestellt werden. Denn das Verpackungsgesetz, das am 1. Januar 2019 in Kraft getreten ist, gilt für die meisten Unternehmer*innen, die mit Ware befüllte und beim Endverbrauchenden anfallende Verpackungen inklusive Füllmaterial in Verkehr bringen. Vielen Gründer*innen ist nicht bewusst, dass sie als Onlinehändler*in vom Prinzip der erweiterten Produktverantwortung betroffen sind. Und das bedeutet konkret, dass sie für die Rücknahme und Verwertung zu sorgen haben.
Konkret statt abstrakt
Besteht Unsicherheit, ob ein Unternehmen ein sogenannter Erstinverkehrbringer ist, sind ein paar einfache Fragen zu beantworten. Zunächst einmal muss geklärt sein, ob die Ware von einem anderen Händler erhalten oder zuerst in den Umlauf gebracht wurde. Dann gilt es herauszufinden, ob die Verpackung systembeteiligungspflichtig ist und ob sie als Müll beim Endverbraucher anfällt. Zu den systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gehören sowohl Um- und Verkaufsverpackungen als auch Packstoffe und Packmittel. Das umfasst Kartonagen genauso wie beispielsweise Stretchfolie. Aber auch Glas, Kunststoffe und Naturmaterialien zählen dazu. In der Praxis ist oftmals zu sehen, dass sich Gründer*innen mit der Definition des Begriffs Endverbraucher*in schwertun. In diesem konkreten Fall sind damit nicht ausschließlich Privathaushalte gemeint, der Gesetzgeber schließt auch sogenannte vergleichbare Anfallstellen mit ein. Dazu können beispielsweise Gastronomiebetriebe zählen, wenn sie ein bestimmtes Volumen an Müll nicht überschreiten. Fallen Händler*innen unter das Verpackungsgesetz, steht vor dem ersten Versand die Pflicht zur Registrierung bei der Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister LUCID. Im Anschluss muss die Lizensierung durch ein duales System erfolgen. Beim Überschreiten von bestimmten Mengen schreibt der Gesetzgeber zudem eine Vollständigkeitserklärung gemäß Verpackungsgesetz vor.
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht
Erfahrungsgemäß verstehen einige Unternehmen die Nichteinhaltung des Gesetzes als eine Art Kavaliersdelikt. Dabei gilt es zu bedenken, dass es sich dabei um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die nach § 34 Abs. 1 und Abs. 2 VerpackG mit einer Geldbuße von bis zu 200.000 Euro geahndet werden kann. Da der Gesetzgeber keine Unterschiede bei der Unternehmensgröße macht, betrifft das Großhändler*innen genauso wie Kleinunternehmen. Um Gründer*innen Support bei der Erfüllung des Verpackungsgesetzes zu geben, hilft ein(e) verlässliche(r) Partner*in, der/die weiß, wie das optimale Vorgehen ist und Tipps bei der Umsetzung geben kann.
Der Autor Jens Mühlenbruch ist Verantwortlicher für Projekt- und Vertriebsentwicklung bei der BB-Verpackungen GmbH in Stuhr.
Alle wollen grenzenloses Remote-Arbeiten, außer die Regierungen der meisten Länder
Fernarbeit beweist, dass die Welt noch nicht global ist. Von überall aus zu arbeiten ist der einfache Teil; sich mit Arbeitsgenehmigungen, Versand-Fragen, Zahlungen, Steuern und Versicherungen in der ganzen Welt zu befassen, ist der schwierige Teil – und zwar sowohl auf Seite der Arbeitgebenden als auch der Arbeitnehmenden. Doch trotz der Probleme lohnt sich das Recruiting über die Grenzen hinaus. Aber: Überwiegen die Vorteile den Nachteilen? Und wie kann man den Herausforderungen der internationalen Gesetze effektiv begegnen?

Nicht zuletzt die Covid-19 Pandemie hat gezeigt, dass sich der Arbeitsmarkt verändert. Zeit- und ortsunabhängiges Arbeiten wird mehr gefordert denn je – sei es von Arbeitnehmenden oder Arbeitgebenden. Die tatsächliche Umsetzung von Remote Work über Ländergrenzen hinweg ist jedoch auf dem Papier leichter als in der Arbeitswelt. Während Prozesse und Strukturen vergleichsweise unkompliziert angepasst werden können, stellen komplexe, rechtliche Anforderungen in den jeweiligen Ländern die größere Herausforderung dar. Konkret lohnt sich für Unternehmen daher zunächst die Frage: Welche Compliance Aspekte gibt es zu beachten?
Andere Länder, andere Sitten
Angefangen bei Arbeitserlaubnissen, müssen Unternehmen die rechtlichen Gegebenheiten individuell für jedes Land prüfen. Sobald die Arbeitsgenehmigung vorhanden ist, warten aber weitere Herausforderungen, die viel Bürokratie und wenig Gestaltungsfreiraum mitbringen. Steuervorgaben, Sozialversicherungen und Arbeitsschutzregelungen unterscheiden sich oft von Land zu Land, insbesondere außerhalb der EU. Bevor also ein Arbeitsverhältnis zwischen Unternehmen und Mitarbeitende aus dem Ausland eingegangen wird, müssen beide Parteien sich mit Fragen zu Probezeiten, verpflichtenden Sozialleistungen und Mindesturlaub auseinandersetzen oder – bestenfalls – bereits auseinandergesetzt haben.
Da die Anforderungen und Informationen zu internationalen Arbeitsbedingungen sehr vielfältig und komplex oder zum Teil auch schwer zugänglich sind, empfiehlt sich eine Employer of Record-Lösung. Diese ermöglicht Unternehmen, Mitarbeitende weltweit einzustellen, ohne dafür Niederlassungen oder Tochtergesellschaften zu gründen und verantwortet zudem Personalprozesse. Ab einer gewissen Größe können EOR-Lösungen jedoch sehr kostspielig werden. Deshalb müssen Unternehmen abwägen, inwiefern sich der Einsatz der finanziellen Ressourcen für den grenzübergreifenden Zugang zu qualifizierten Mitarbeitenden lohnt. Und erst, wenn sichergestellt wurde, dass alle rechtlichen Bedingungen erfüllt werden können, folgt der nächste Punkt auf der Agenda: Mitarbeitende weltweit mit dem richtigen aber auch sicherem Equipment ausstatten.
Einheitliches Equipment überall – aber bitte nur mit sicheren Daten
Um ihrer Tätigkeit – zumindest technisch – überhaupt erst nachgehen zu können, benötigen Arbeitnehmende die nötige Ausstattung. Laptops, Smartphones und alle weiteren erforderlichen Endgeräte müssen dementsprechend an Orte auf der ganzen Welt verschickt werden. Als weniger problematisch erweisen sich dabei Lieferungen in die USA, EU oder UK. Der Versand in Drittstaaten hingegen ist aufgrund von hohen Zöllen und damit verbundenen Auflagen oft mit hohem logistischem Aufwand verbunden. Um Lieferungen auf globaler Ebene zu vereinfachen und zu automatisieren, bieten sich auf dem Markt verschiedene Software-Lösungen an.
Als weitere Herausforderung kommt die Sicherheit der Daten hinzu, mit denen Arbeitnehmende und Arbeitgebende von überall aus arbeiten. Anders als bei einem festen Bürostandort mit stationären Computern, lassen sich Daten in remote-first Unternehmen nur schwer überwachen. Um die Datensicherheit trotzdem zu gewährleisten, setzen an dieser Stelle Mobile-Device-Management-Systeme an. Damit werden Computerdaten unabhängig von Zeit und Ort sicher verwaltet – auch bei Offboarding-Prozessen. Sind die Mitarbeitenden erst einmal ausgestattet, die Daten gesichert und die Arbeit erledigt, stehen Gehaltszahlungen an.
Die nächste Herausforderung: Währungen weltweit
Sobald Arbeitnehmende von unterschiedlichen Ländern aus arbeiten, bedeutet das für Unternehmen häufig, die Gehälter in lokalen Währungen auszuzahlen. Damit sind gleichzeitig Wechselkursrisiken und hohe Spesen verbunden. Ein Lösungsansatz, um Spesen zu reduzieren, stellt die aktive Zusammenarbeit mit Banken dar. Insbesondere moderne Online-Banken wie Revolut, Wise, n24 bieten den zusätzlichen Vorteil, Überweisungen mit verringerten Wechselkursrisiken zu tätigen. Doch neben der rechtmäßigen Bezahlung von Gehältern sehen sich viele Unternehmen mit einer weiteren Schwierigkeit konfrontiert: Alle Mitarbeitenden gleich zu behandeln.
Gleichbehandlung vs. Gesetze
Arbeitskräfte in der ganzen Welt einzustellen, hat zur Folge, dass für diese unterschiedliche Gesetze gelten. Auch wenn Unternehmen den Anspruch haben, alle Mitarbeitenden gleich zu behandeln, stoßen sie spätestens bei dem Thema Urlaubs- und Feiertage an ihre Grenzen. Die Anzahl der gesetzlichen Urlaubstage ist in jedem Land individuell festgelegt. Auch die gesetzlichen Feiertage unterscheiden sich von Land zu Land. Hinzu kommen Ausnahmen, in denen Länder zu besonderem Anlass zusätzliche Feiertage vergeben, wie beispielsweise am Todestag von Queen Elizabeth in den UK. Außerdem werden Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, in manchen Ländern laut Gesetz mit einem Urlaubstag ausgeglichen oder sogenannte ‘Floating Holidays’ vergeben, an die sich gehalten werden muss. Und Zuschläge, zum Beispiel für Nacht- oder Wochenendarbeit, variieren ebenfalls. Da nicht alle Länder einheitliche Regelungen haben, sind Unternehmen also gezwungen, eine gerechte Lösung unter Einhaltung aller Gesetze zu finden. Ein Lösungsansatz hierfür sind beispielsweise individuelle Benefits für alle Mitarbeitende, damit ungleiche Gesetze kompensiert werden. Und obwohl eine Reihe von Schwierigkeiten auf remote-first Unternehmen zukommen, weist Fernarbeit trotzdem zentrale Vorteile auf.
Wo Herausforderungen liegen, warten auch Chancen
In Zeiten von Fachkräftemangel ermöglicht es Remote Work, qualifizierte Mitarbeitende auf der ganzen Welt zu finden. Die Suche nach Personal muss nicht mehr nur auf ein Land oder eine Stadt, in der Unternehmen sitzen, beschränkt werden, sondern kann international ausgedehnt werden. Auf der anderen Seite haben Arbeitnehmende, die aufgrund ihrer familiären Situation oder anderer Ursachen ortsgebunden sind, genauso die Möglichkeit, ein passendes Unternehmen zu finden.
Zudem wirkt sich ein internationales Team vor allem auf global agierende Unternehmen positiv aus. Multikulturelle Teams, die unterschiedliche Zeitzonen abdecken und verschiedene Sprachen sprechen, können wegen ihrer unterschiedlichen Hintergründe wertvollen Input liefern, da sie selbst unterschiedliche Zielgruppen darstellen – und davon profitieren Unternehmen auf wirtschaftlicher sowie Mitarbeitende auf persönlicher Ebene.
Da das Thema Work-Life-Balance innerhalb des aktuellen gesellschaftlichen Wandels immer mehr an Bedeutung gewinnt, schafft Fernarbeit einen weiteren Vorteil: Flexibles Arbeiten unabhängig von Zeit und Ort. Mitarbeitende sparen sich beispielsweise den Weg zur Arbeit und können sich Arbeitszeiten selbst einteilen. Und Unternehmen gewinnen an Attraktivität, während sie geeignetes Personal weltweit finden können.
Fazit: Nicht alles auf einmal und schon ist Remote Work möglich
Auch wenn internationale Länder und Gesetze viele Hürden für Remote-Arbeit darstellen, liegen darin große Chancen, mit denen sich Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen können. Dabei können durchaus Kompromisse eingegangen werden, indem das Recruiting zunächst in spezifische Länder oder Ländergruppen, wie zum Beispiel innerhalb der EU, erweitert wird. Wichtig ist letzten Endes, eine Balance zwischen eingesetzten Ressourcen und daraus resultierenden Benefits zu finden – sodass letztendlich das “friendly” in remote-friendly in den Vordergrund rückt und das Unternehmen noch attraktiver macht.
Die Autorin Lydia Kothmeier ist VP of Operations bei Storyblok, Anbieter eines Headless Content Management System (Headless CMS). Mit Hintergrund- und Fachwissen aus M&A, Financial Planning & Analysis, People Management sowie Erfahrung als Business Consultant und als Prokuristin, kann Lydia heute umso mehr Kenntnisse in ihrer Tätigkeit anwenden.

