Aktuelle Events
Der Wert der Glaubwürdigkeit: Grundlagen der Nachhaltigkeitskommunikation
Nachhaltigkeit bedarf in erster Linie des engagierten Handelns, unter Berücksichtigung des geläufigen Drei-Säulen-Modells aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit. Handeln wird innerhalb dieses Themenkomplexes als die eine Grundlage gewichtet, die – um im unternehmerischen Kontext zu bleiben – nachhaltigeres Wirtschaften überhaupt erst ermöglicht. Im Wettbewerb des Marktes ist das aber womöglich zu wenig, um gegen die Konkurrenz zu bestehen. „Tue Gutes!“ reicht dann nicht aus, die Verbraucher sollen auch wissen, dass Gutes geschieht. Eine weitere tragende Säule in diesem Zusammenhang: die Glaubwürdigkeit.

Tue Gutes und rede darüber
Ein oft gehörter, weil vielfach wiederholter Grundsatz für die Kommunikation in Sachen Nachhaltigkeit. Denn nachhaltiges Handeln wird im Idealfall, also bei konsequenter Umsetzung, zu einem Markenzeichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Damit wird sie gleichermaßen ein wichtiger Faktor für das Marketing und die Markenkommunikation. Funktionieren kann das aber nur, wenn die Grundlagen eingehalten werden. Das gilt insbesondere unter den Vorzeichen Digitalisierung und Social Media, durch die sich die Kommunikation insgesamt erheblich gewandelt hat.
Glaubwürdigkeit
Unter anderem sind Aussagen im Internet jederzeit überprüfbar. Vertrauen zu den Verbrauchern lässt sich daher nur dann aufbauen, wenn die Leistungen in Sachen Nachhaltigkeit und die dazugehörige Kommunikation miteinander in Einklang sind. Glaubwürdigkeit ist aus diesem Grund ein wichtiger Pfeiler, wenn es einerseits um den Vertrauensaufbau und andererseits um die funktionierende Außendarstellung geht.
Authentizität
Taten statt Sprüchen, das meint unter anderem auch notwendige Kompetenzen und die Fähigkeit, diese kommunizieren zu können. Das verleiht nicht nur eine authentische Wirkung, sondern in gleichem Maße Autorität – für Geschäftspartner wie Verbraucher ein wichtiges Signal, weil sie sich mit ihren Belangen bei einem gewissenhaften und kundigen Gegenüber gut aufgehoben wissen.
Dialogbereitschaft
Allerdings sollte dazu die gewonnene Authentizität mit der notwendigen Dialogbereitschaft verbunden werden. Authentisches Auftreten erhöht zwar die Interaktionsbereitschaft der Verbraucher, diese muss aber auch angenommen werden. Das ist aus verschiedenen Gründen eine Herausforderung, die einmal mehr auf den veränderten Bedingungen der sozialen Medien beruht:
- Über Social Media kann Nachhaltigkeitskommunikation keine Einkanal-Kommunikation mehr sein. Für Unternehmen bedeutet das zumindest in Teilen einen Kontrollverlust.
- Andererseits sind die sozialen Medien so bedeutsam geworden, dass an ihnen kein Weg vorbeiführt. Die Kommunikation findet dort ohnehin statt und nur durch eine proaktive Beteiligung kann überhaupt so etwas wie teilweise Kontrolle zurückgewonnen werden.

Transparenz
Ein Punkt, der eng verknüpft ist mit Glaubwürdigkeit und Authentizität: Nachhaltiges Wirtschaften ist ein unglaublich komplexer Prozess, wenn er denn auf allen denkbaren Ebenen angegangen wird. Das heißt in der Konsequenz, dass die gewünschten Ziele gegebenenfalls erst langfristig erreicht werden können. Das ist tatsächlich ein fester Bestandteil des Weges zu mehr Nachhaltigkeit, der eben darum jedoch nicht außen vorgelassen werden sollte.
Etwaige Rückschläge müssen genauso wie erfreuliche Fortschritte offen thematisiert werden können. Die Verbraucher in dieser Hinsicht in die Kommunikation einzubeziehen, schafft nicht nur weiteres Vertrauen, es eröffnet zudem die Möglichkeit, Lösungen und Verbesserungen zu finden, an die bislang gar nicht gedacht wurde.
Kontinuität
So wie Nachhaltigkeit im Unternehmen braucht auch die damit verbundene Kommunikation unbedingt Kontinuität. In beiden Fällen ist es so, dass der Erfolg nur durch langfristiges und vor allem regelmäßiges Engagement zu erreichen ist. Die größte Schwierigkeit in dieser Hinsicht besteht darin, auch in kritischen Phasen – also wortwörtlich dann, wenn Kritik laut wird – am Ball zu bleiben und den Dialog nicht aufzugeben.
Praxisbeispiele: Wie Unternehmen ihre Nachhaltigkeitskommunikation gestalten
Das Thema Nachhaltigkeit ist sehr komplex, was nicht zuletzt daran liegt, dass es ganzheitlich gedacht werden muss. Branchenübergreifend bedeutet das für die Unternehmen zahlreiche Überschneidungen hinsichtlich geeigneter Maßnahmen. Dennoch sorgen unterschiedliche Geschäftsfelder selbstverständlich für unterschiedliche Schwerpunkte – was dann gleichsam für die Kommunikation in diesem Bereich gilt.
- Das Modeunternehmen C&A spricht auf der Firmen-Website gezielt das Thema eines nachhaltigen Produktkreislaufs an, das allgemeinhin mit dem Konzept "Cradle-to-Cradle" zusammengefasst wird. Mit den Bemühungen um eine Lizenzierung der Kleidungsstücke nach Cradle to Cradle CertifiedTM-Standards beweist das Unternehmen, wie Mode- und Umweltbewusstsein miteinander vereinbart werden können. Die dazugehörige Seite klärt die Verbraucher umfangreich auf, und zwar nicht nur über die firmenseitigen Ziele, sondern bezieht die Verbraucher mit ein, indem Möglichkeiten aufgezeigt werden, über den Kauf hinaus einen aktiven Beitrag zu einem umweltschonenden Mode-Kreislauf leisten zu können.
- Der Beiersdorf-Konzern vereint einige namhafte Marken, die allesamt Produkte für die Hautpflege verkaufen. Laut Unternehmensseite ist der gemeinsame Grundstein aber stets eine nachhaltige Lieferkette. Die Aufschlüsselung der einzelnen Maßnahmen, mit denen eben jene Nachhaltigkeit erzielt werden soll, ist aufgrund des Detailgrads der Information in der Schnittmenge zwischen verbraucherorientiertem und auf Experten zugeschnittenen Content anzusiedeln.
- Die BMW Group macht mit ihrem Internetauftritt auf die verschiedenen Bereiche aufmerksam, in denen Verantwortungsbewusstsein von den Automobilherstellern gefragt ist. Neben den Nachhaltigkeitsfaktoren, die sich auf ökologische und ökonomische Fragestellungen beziehen, wird außerdem die soziale Komponente, das gesellschaftliche Engagement, als eine zentrale Aufgabe hervorgehoben. Im Rahmen der firmeneigenen Kernkompetenzen ist das Unternehmen auf verschiedenen Ebenen um langfristige Lösungen für die "Hilfe zur Selbsthilfe" bemüht und stellt die unterschiedlichen Ansätze vor.
- Das Darmstädter Unternehmen Merck steht für spezialisierte und innovative Produkte in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Das Geschäft dreht sich insgesamt aber immer um technologischen Fortschritt und die damit verbundenen, möglichen Verbesserungen für das alltägliche Leben. Ohne Neugierde ist keines davon zu erreichen, weshalb der Konzern diese Eigenschaft zum zentralen Thema einer eigenen, interaktiven Website gemacht hat. Auf diese Weise wird nicht nur ein elementarer Wert für die Arbeit des Unternehmens an die Verbraucher herangeführt, diese werden durch das interaktive Design gleich mit einbezogen - immer ihrer eigenen Neugierde folgend. Das schafft eine Verbindung zwischen Konzern und Verbraucher.
Kommunikation, richtig dosiert
Abgesehen von der Glaubwürdigkeit braucht es in der nachhaltigen Kommunikation außerdem das rechte Maß. Die Möglichkeiten bei den Nachhaltigkeitsmaßnahmen und -aktivitäten etwa sind überaus vielfältig und vielschichtig, aber längst nicht alle dafür geeignet, um an die Verbraucher weitergetragen zu werden. Durch vernachlässigte Kommunikation können aber wichtige Aspekte der Markenführung nicht nach außen dargestellt werden, kaum anders verhält es sich jedoch, wenn die gewünschte Botschaft im Überangebot der Kommunikationskanäle nicht mehr deutlich wird.

Die Probleme nachhaltiger Kommunikation
Ein grundsätzliches Problem in der Nachhaltigkeitskommunikation mit den Verbrauchern liegt darin, dass nur ein Bruchteil aller dahingehenden Aktivitäten für diese überhaupt von Belang sind. Das betrifft viele Maßnahmen (ökologisch wie sozial) entlang der Wertschöpfungskette, aber auch firmeninterne Aktivitäten. Diese Dinge können zwar sehr wohl kommuniziert werden, nur ist die Zielgruppe dafür eine andere, nämlich eher Experten. Umgekehrt sollte das gesteigerte Bewusstsein für und Interesse an der Herkunft von Produkten und der Herstellungsweise Anlass genug sein, diese Themen nicht auszusparen - denn in dieser Hinsicht sind die Verbraucher in den vergangenen Jahren deutlich sensibler geworden.
Eine solche Unterscheidung ist insofern sinnvoll, als dass die kommunizierten Inhalte – der Content – Nähe zum Leser schaffen sollen, sie sollen eine Verbindung herstellen. Entsprechend müssen die Inhalte in eine Beziehung zum alltäglichen Leben der Kunden gesetzt werden können. Das allerdings können längst nicht alle Nachhaltigkeitsaktivitäten erfüllen.
Darüber hinaus ist die Kommunikation selbst bei weitestgehend klar abgesteckten Themenbereichen immer noch problematisch. Besonders das rechte Maß zu finden ist für viele Unternehmen nach wie vor eine Herausforderung. Das ist in vielen Fällen der fälschlichen Annahme geschuldet, dass etwa eine steigende Zahl der Kommunikationskanäle zwangsläufig ein Mehr an Kommunikation zur Folge haben müsse. Daraus allerdings erwachsen erst die tatsächlichen Probleme:
- Zu viel Information
Betroffen hiervon sind Kunden, Mitarbeiter, Experten und Geschäftspartner gleichermaßen, die zum Beispiel mit immer mehr Pressemitteilungen und Mediengesprächen, mit einer immer dichteren und umfassenderen internen Kommunikation oder immer umfangreicheren und zahlreicheren Image-, Themen- und anderen Corporate-Publikationen bis hin zu Geschäftsberichten überhäuft werden. - Zu wenig Mehrwert
Vor allem in den sozialen Medien führt ein solche übertriebene Aktivität jedoch dazu, dass die Angebote zum einen kaum mehr überschaubar werden und zum anderen redundante Inhalte liefern. Der eigentlich angestrebte Mehrwert für die Adressaten wird dadurch verwässert. - Zu viel Rechtfertigung
Wenig hilfreich ist außerdem, wenn der Kommunikationsaktionismus begleitet wird von einem gefühlten Rechtfertigungsdruck, hervorgerufen durch den Glauben, über eine strengere Reglementierung im Unternehmen und eine lückenlose Überwachung der Nachhaltigkeitsfortschritte zu mehr Glaubwürdigkeit zu gelangen. Die Einführung von Unternehmensprinzipien und ähnlichem oder die Erhebung von Leistungsindikatoren sind im ungünstigsten Fall aber wenig mehr als Hemmnisse für den Arbeitsalltag. Deshalb will auch die unternehmensinterne Kommunikation von Nachhaltigkeitsmaßnahmen richtig dosiert sein.
Weniger ist mehr: Grundlagen nachhaltiger Kommunikation
Die quantitative Problematik der nachhaltigen Kommunikation ließe sich mit relativ einfachen Mitteln geraderücken. Es braucht im Prinzip und vor allem eine Besinnung auf das Wesentliche. Hierzu sind drei Maßgaben von besonderem Belang:
- Effizienz ist ohnehin ein elementarer Faktor von wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und das gilt ebenfalls für die Kommunikation. Gefordert ist daher zum einen der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen (etwa Budgets, Mitarbeiter oder Dienstleister), zum anderen die Ausrichtung auf eine langfristige Wirkung.
- Konsistenz bezieht sich auf eine Kommunikation, die übereinstimmt mit den Werten, der Infrastruktur und auch der Leistungsfähigkeit eines Unternehmens.
- Suffizienz umschreibt die Angemessenheit der Kommunikation, also den Grad der ausreicht, um gesetzte Ziele verwirklichen und die Erwartungen von Kommunikationspartnern erfüllen zu können.
Im Grunde kreist suffiziente Kommunikation um drei Hauptmerkmale. Sie ist knapp in dem Sinne, dass sie auf die Maßnahmen und Aktivitäten reduziert wird, die wirklich notwendig sind, um die vorrangigen Kommunikationsziele zu erfüllen. Eine ähnliche Beschränkung auf das Wesentliche betrifft auch den Umfang von veröffentlichtem Content (hinsichtlich der Menge der enthaltenen Botschaften) sowie den Umfang von Publikationen generell.

Das zweite Merkmal ist Relevanz. Sie kann nur dann erreicht werden, wenn das notwendige Bewusstsein für die Themen vorhanden ist, die für das Unternehmen von Bedeutung sind. Nur auf dieser Grundlage ist es möglich, eine zielgerichtete Kommunikation aufzubauen und an die Kommunikationspartner zu richten. Das ist im modernen, digitalen Kommunikationszeitalter eine Notwendigkeit, wenn die Inhalte nicht beliebig oder sogar intransparent werden sollen. In der fast unüberschaubaren Fülle ständig neuen Contents ist die Relevanz deshalb ein entscheidender Faktor.
Zu guter Letzt braucht es den nötigen Fokus, das heißt in der Praxis beispielsweise, sich nur auf bestimmte Kommunikationskanäle zu konzentrieren. Nämlich all diejenigen, die einerseits das Potenzial haben, die Wirkung zu verbessern und die andererseits nicht die Gefahr bergen, die Themen zu verwässern.
Glaubwürdigkeit durch Berichterstattung
Die Problematik, wie die Unternehmensbemühungen um die Nachhaltigkeit letztlich doch noch an die Verbraucher getragen werden können, bleibt aber selbst bei Kenntnis der Kommunikationsgrundlagen in der praktischen Umsetzung bestehen. Als probates Mittel für die Darstellung dieser Bemühungen haben sich regelmäßige Nachhaltigkeitsberichte erwiesen – sie dienen gleichzeitig als Nachweis gegenüber anderen Interessengruppen, beispielsweise Investoren.
Gründe für die Nachhaltigkeitsberichterstattung eines Unternehmens
Die Beweggründe für die Berichterstattung für die Nachhaltigkeitsarbeit eines Unternehmens können allerdings ganz verschieden sein.
- Gesellschaftliche Ansprüche hat prinzipiell jedes Unternehmen zu erfüllen, da es nicht losgelöst von seinem gesellschaftlichen Umfeld handeln kann. Mit Hilfe der Berichterstattung kann das unternehmerische Handeln auf seine soziale Wirkung hin überprüft und legitimiert werden. Die Bereitstellung von Informationen, etwa an die Stakeholder, dient gleichzeitig der nachhaltigen Beziehungspflege zwischen eben jenen und dem Unternehmen.
- Der offene Umgang mit Nachhaltigkeitsaspekten fördert außerdem den Aufbau der Reputation eines Unternehmens. Wenngleich die Wirkung nicht sofort (im wirtschaftlichen Sinne) messbar sein dürfte, ist ein tadelloser Ruf ein wichtiger Faktor für die Beziehungen zu Lieferanten, Händlern, Behörden und nicht zuletzt den Verbrauchern. Darüber hinaus kann die Nachhaltigkeitsberichterstattung auch hinsichtlich des Wettbewerbs ein Vorteil gegenüber Konkurrenten sein – Nachhaltigkeitsberichte tauchen nämlichen ebenfalls in Rankings auf, etwa beim Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und future e.V. Erforderlich ist hier aber die schon angesprochene Kontinuität.
- Damit eine solche Reputation allerdings erworben werden kann, muss der Grundstein dafür gelegt werden. Eine transparente Berichterstattung sorgt für die dazu notwendige Glaubwürdigkeit und sichert sie zugleich.
Darüber hinaus kann sich die Wirkung eines Nachhaltigkeitsberichts aber ebenso gut nach innen wenden, etwa im Sinne einer betriebsinternen Informationsquelle, durch die die Mitarbeiter einerseits über die Nachhaltigkeitsziele aufgeklärt und andererseits für die Einhaltung der damit verbundenen (betriebsinternen) Maßnahmen sensibilisiert werden. Der Berichterstattung kommt auf diese Weise – wie auch im Allgemeinen – eine wichtige Funktion im Bereich des Controllings zu.
Probleme von Nachhaltigkeitsberichten
Gänzlich unproblematisch ist das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung allerdings nicht, was vor allem hinsichtlich der externen Testierung dieser Berichte gilt. Die Frage, um die es dabei geht, lautet: Können solche Testate die Glaubwürdigkeit von Nachhaltigkeitsberichten verbessern? Haben sie überhaupt einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit, die Unternehmen durch die Offenlegung von Zielen, der Erreichen oder Problemlagen aufzubauen versuchen?

Die Antwort darauf ist nicht so leicht, denn obwohl die transparente Nachhaltigkeitskommunikation insgesamt ein wichtiges Element für die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens ist, muss dennoch beachtet werden, dass die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung damit keinesfalls gleichzusetzen ist – sie ist lediglich ein Teilaspekt. Folglich muss auch der Wert einer Testierung in dieser Hinsicht hinterfragt werden, wenngleich die Prüfung grundsätzlich eine Chance sein kann, wenn es um die Entwicklung eines Unternehmens geht. Die Wirkung ist in diesem Fall aber wohl auch eher nach innen gerichtet als an die Öffentlichkeit.
Unabhängig von der Testat-Frage lässt sich zumindest beobachten, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung in immer größerem Umfang ein fester Bestandteil der nachhaltigen Unternehmenskommunikation wird. Tatsächlich ist sie auch für kleine und junge Unternehmen ein denkbares Mittel, die Außenwirkung im Bereich Nachhaltigkeit zu verbessern. Die damit verbundenen Anforderungen, wie sie etwa von Seiten des Deutschen Nachhaltigkeitskodex oder der Global Reporting Initiative gestellt werden, sollten dabei kein Hindernis sein. Im Zweifelsfall wird für einen ersten Bericht auf eine Vorlage zurückgegriffen, in der bereits alle wichtigen Punkte skizziert sind.
Anforderungen und Möglichkeiten von Nachhaltigkeitsberichten
Apropos Anforderungen. Der Verweis auf gleich zwei Institutionen, an deren Leitlinien sich die Unternehmen orientieren müssen, zeigt schon die Komplexität dieses Themas. Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PwC weist deshalb auf einige wesentliche Merkmale hin, die ein Nachhaltigkeitsbericht zu erfüllen hat:
- Die Maßgabe der Vollständigkeit ist beispielsweise erst dann erfüllt, wenn alle Kriterien berücksichtigt wurden, mit Hilfe derer die Auswirkungen nachhaltiger Maßnahmen auf die im Bericht abgebildeten Bereiche angemessen dargestellt werden können.
- Dazu gilt der Grundsatz der Richtigkeit, was bedeutet: Die Verlaufs- und Zustandsangaben sind nachprüfbar und zutreffend; Annahmen und Absichten sind glaubhaft, stehen also nicht im Widerspruch zum tatsächlichen Handeln des Unternehmens; die daraus resultierenden Folgerungen sind rechnerisch und sachlich richtig; der Maßstab für die Beurteilung der Richtigkeit ist die Sorgfalt, die ein gewissenhafter und ordentlicher Geschäftsführer walten lassen würde.
Zu beachten ist außerdem, die Darstellung der einzelnen Informationen insofern angemessen zu gestalten, dass sie einer realistischen Gewichtung im Hinblick auf die Wirksamkeit in Sachen Nachhaltigkeit insgesamt wiederspiegelt. Wichtig ist überdies eine klare und verständliche Form der Berichterstattung.

Influencer für nachhaltige Kommunikation
Die Schnittmenge zwischen nachhaltiger Kommunikation zwischen Unternehmen und Verbrauchern lässt sich ohne Zweifel in den Sozialen Medien finden. Nirgendwo sonst ist die Auseinandersetzung direkter und transparenter, nirgendwo sonst steht die Glaubwürdigkeit derart auf dem Prüfstand. Soziale Medien sind deshalb ein wichtiger Gradmesser, indem sie gleichermaßen Greenwasher enttarnen oder aber ehrliche Absichten belohnen können.
Denn die sogenannten „Influencer“ wirken im Netz als wichtige Multiplikatoren. Sie verfügen innerhalb einer bestimmten Zielgruppe oder eines bestimmten Themengebiets über eine hohe Reputation – etwa ganz konkret beim Thema Nachhaltigkeit – und damit über eine dementsprechend große Reichweite. Unterschieden werden muss in diesem Zusammenhang allerdings die Kommunikation in den sozialen Netzwerken von Facebook über Twitter bis zu Google+ und in Blogs: Die Schnelllebigkeit des Informationsaustauschs in den sozialen Medien macht es schwieriger, einen nachhaltigen Effekt zu erreichen.
In dieser Hinsicht sind Blogs von Vorteil (Stichwort: Indexierung in Suchmaschinen), aber generell gilt, dass auch die positive (Marketing-)Wirkung von Influencern erst dann nutzbar wird, wenn das Verhältnis zu ihnen von Glaubwürdigkeit – darunter ist unter anderem eine harmonische Beziehung hinsichtlich der Themenschwerpunkte zu verstehen – und Nachhaltigkeit geprägt ist. Insofern bilden Influencer im Kreis der Mittel der Nachhaltigkeitskommunikation keine Ausnahme.
Sie möchten selbst ein Unternehmen gründen oder sich nebenberuflich selbständig machen? Nutzen Sie jetzt Gründerberater.de. Dort erhalten Sie kostenlos u.a.:
- Rechtsformen-Analyser zur Überprüfung Ihrer Entscheidung
- Step-by-Step Anleitung für Ihre Gründung
- Fördermittel-Sofort-Check passend zu Ihrem Vorhaben
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Astrogeografie: Die unterschätzte Macht der Orte
Wie die Standortfrage den Erfolg deiner Ideen mitbestimmt, erläutert Business-Astrologin Franziska Engel.

Manche Ideen scheinen wie von selbst zu wachsen, sobald sie an einem bestimmten Ort entstehen. Gespräche fließen leichter, Kooperationen ergeben sich im richtigen Moment und Entscheidungen fallen mit einer Klarheit, die sich kaum planen lässt. Und dann gibt es Orte, an denen das Gegenteil geschieht. Projekte stocken, Motivation sinkt und selbst gute Pläne fühlen sich schwer an.
Diese Unterschiede sind kein Zufall. Jeder Mensch steht in einer individuellen Beziehung zu bestimmten Orten. Diese Verbindung lässt sich astrogeografisch sichtbar machen und zeigt, wo persönliche Linien und Themen in Resonanz treten. Orte entfalten ihre Wirkung also nicht aus sich selbst heraus, sondern im Zusammenspiel mit der Person, die dort lebt oder arbeitet. Wer diese Zusammenhänge versteht, erkennt, dass Standortentscheidungen nicht nur von Zahlen abhängen, sondern auch von Resonanz.
Wenn Zahlen zu wenig sagen
In der Wirtschaft gilt die Standortwahl meist als nüchterne Rechenaufgabe. Es geht um Steuern, Infrastruktur, Fachkräfte oder Marktpotenziale. Doch diese Faktoren erklären nicht, warum manche Gründer*innen an einem Ort aufblühen, während sie an einem anderen stagnieren.
Als Business-Astrologin mit Fokus auf internationale Wirtschaft, beschäftige ich mich seit Jahren mit dieser Fragestellung. In meiner Arbeit verbinde ich wirtschaftliches Denken mit astrogeografischen Analysen, die zeigen, welche Orte mit den individuellen Anlagen und Potenzialen einer Person in Resonanz stehen. Dabei geht es nicht um allgemeine Zuschreibungen zu Ländern, Städten oder Regionen, sondern um den persönlichen Bezug zwischen Mensch und Ort.
Jeder Mensch hat ein eigenes energetisches Muster, das durch astrogeografische Linien sichtbar gemacht werden kann. Diese Linien zeigen, wo bestimmte Themen wie etwa Kreativität, Kommunikation, Wachstum oder Stabilität besonders aktiv werden.
Wer diese individuellen Zusammenhänge kennt, kann Standortentscheidungen bewusster treffen. Ein Ort kann dann gezielt gewählt werden, um eine bestimmte Entwicklungsphase zu unterstützen oder neue Impulse in ein bestehendes Projekt zu bringen.
Ein Ort, an dem Ideen nur so sprühen. Ein anderer, an dem sich plötzlich Klarheit einstellt. Oder ein dritter, an dem trotz aller Mühe nichts richtig funktioniert. Diese Erfahrungen kennt fast jede(r), der/die gründet oder neue Wege geht. Es geht hierbei nicht darum, einem Ort bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. Entscheidend ist, wie dieser Ort mit dem eigenen astrologischen Muster in Verbindung steht. Erst daraus entsteht Resonanz oder Spannung.
Diese Resonanz kann sowohl auf die Standortwahl als auch auf die Gestaltung von Arbeitsräumen angewendet werden. Schon kleine Veränderungen können spürbar machen, ob sich jemand in seiner Energie bewegt oder dagegen arbeitet. Die Position eines Schreibtischs, die Blickrichtung, Licht oder Farben, all das beeinflusst, wie sich persönliche Linien am Ort entfalten können. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich die Atmosphäre verändert, sobald ein Raum in seiner Balance ist.
Wenn Ort und Mensch zusammenarbeiten
Erfolg entsteht dort, wo Menschen und Orte miteinander harmonieren. Wenn der Standort das stärkt, was jemand in die Welt bringen möchte, entsteht eine natürliche Leichtigkeit. Ideen fließen, Kommunikation wird klarer und Entscheidungen fallen mühelos. Diese Sichtweise gewinnt gerade jetzt an Bedeutung.
Immer mehr Gründer*innen arbeiten ortsunabhängig und leben in Bewegung. Sie wechseln Länder, Zeitzonen und Kulturen. Für sie ist die Frage nach dem richtigen Ort oft keine Entscheidung auf Dauer, sondern eine, die sich ständig neu stellt.
Es ist aber nicht nur wichtig, passende Standorte zu finden, sondern auch die Orte, an denen man sich bereits befindet, bewusst zu verstehen. Denn jeder Ort, an dem man sich aufhält, trägt eine bestimmte Resonanz im persönlichen System. Wer erkennt, welche Energie dort gerade wirkt, kann sie gezielt nutzen, ob zur Fokussierung, zur Inspiration oder für einen Neuanfang.
Gerade für digitale Nomad*innen, Freelancer*innen oder Unternehmer*innen, die regelmäßig unterwegs sind, kann dieses Wissen zum Schlüssel werden. Es geht nicht darum, ständig auf der Suche nach dem perfekten Ort zu sein, sondern die Qualität des jeweiligen Ortes zu erkennen und bewusst mit ihr zu arbeiten. Wenn Menschen verstehen, wie der Ort, an dem sie sich gerade befinden, mit ihnen in Resonanz steht, können sie viel freier und klarer handeln. Dann wird Bewegung selbst zu einem stabilen System.
Standortwahl als Zukunftskompetenz
In klassischen Gründungsprozessen wird der Standort oft zu Beginn festgelegt und danach kaum hinterfragt. Man sollte ihn jedoch als lebendiges Element sehen, das sich mitentwickelt. So wie sich Menschen verändern, wandeln sich auch ihre Resonanzen. Ein Ort, der früher förderlich war, kann später blockierend wirken, und umgekehrt. Viele erkennen erst im Rückblick, dass der Standort Teil ihrer Entwicklung war. Er erzählt, wo etwas begonnen hat und wo sich neue Wege auftun.
Diese Erkenntnis macht die Standortwahl zu einer echten Zukunftskompetenz. Wer versteht, wie Mensch und Ort zusammenwirken, kann bewusster steuern, wann ein Wechsel sinnvoll ist und wann Stabilität gebraucht wird. So wird die Standortplanung zu einem Werkzeug für innere und äußere Klarheit.
Der Ort als stiller Mitspieler
Orte sind keine Zufälle, sondern Wegbegleiter. Sie spiegeln, wo man steht, und zeigen, was sich entfalten möchte. Manche öffnen Türen, andere laden dazu ein, innezuhalten. Wenn wir die Sprache unserer Orte verstehen, treffen wir Entscheidungen mit mehr Bewusstsein. Dann wird der Standort zu einem stillen Mitspieler, der leise, aber kraftvoll dabei hilft, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. So entsteht Erfolg nicht nur durch Strategie, sondern auch durch die Verbindung zwischen Mensch, Ort und dem, was entstehen will.
Die Autorin Franziska Engel ist Diplom-Wirtschafts-Sinologin und geprüfte (Business-)Astrologin des Deutschen Astrologen Verbandes e.V., www.unternehmen-astrologie.de
Die neue Ära des E-Commerce 2026
Mit einem prognostizierten E-Commerce-Umsatz von über 125 Mrd. Euro in Deutschland stehen Marktteilnehmende vor wichtigen Herausforderungen in Sachen Agilität und Rechtskonformität.

Die Handelslandschaft im deutschsprachigen Raum hat im Jahr 2026 einen Reifegrad erreicht, der durch eine hocheffiziente Symbiose aus regulatorischer Präzision und technologischer Autonomie gekennzeichnet ist. Nach den volatilen Jahren der Post-Pandemie-Ära hat sich der Markt stabilisiert, jedoch auf einem völlig neuen Niveau der Komplexität.
Mit einem prognostizierten E-Commerce-Umsatz von über 125 Milliarden Euro allein in Deutschland und einer rasant steigenden Online-Durchdringung in Österreich, die nun die 75-Prozent-Marke bei den regelmäßigen Käufer*innen überschreitet, stehen Marktteilnehmer*innen vor der Herausforderung, Agilität mit absoluter Rechtskonformität zu vereinen.
Regulatorische Transformation und die Ökonomie der Transparenz
Ein entscheidender Faktor im Jahr 2026 ist die vollständige Integration der EU-Zollreform, die die bisherige 150-Euro-Freigrenze für Zollabgaben endgültig abgeschafft hat. Diese Maßnahme hat das Geschäftsmodell vieler Cross-Border-Akteur*innen grundlegend verändert, da nun jeder Euro Warenwert ab dem ersten Cent vollumfänglich erfasst wird. In Kombination mit der verschärften Ökodesign-Verordnung (ESPR) müssen Produkte, die in Deutschland und Österreich vertrieben werden, nun über einen digitalen Produktpass verfügen.
Daten zeigen, dass Unternehmen, die diese Transparenz proaktiv nutzen, ihre Konversionsraten um bis zu 18 Prozent steigern konnten, da das Vertrauen in die Produktherkunft zum primären Kaufargument avanciert ist. Die Logistikkosten sind durch die verpflichtenden Recycling-Abgaben im Rahmen der erweiterten Produzentenverantwortung (EPR) im Schnitt um 12 Prozent gestiegen, was die Konsolidierung von Warenströmen in lokalen Hubs wie dem Hamburger Hafen oder dem Logistikzentrum Wien-Süd wirtschaftlich alternativlos macht.
Social Commerce 2.0: Umsatzwachstum durch algorithmische Relevanz
Der Social Commerce hat sich von einer experimentellen Nische zu einem tragenden Pfeiler des Einzelhandels entwickelt. Im Jahr 2026 generiert TikTok Shop in den fünf wichtigsten EU-Märkten, darunter Deutschland, signifikante Marktanteile, wobei die Erhöhung der Verkäufer*innenprovision auf 9 Prozent die Spreu vom Weizen getrennt hat. Statistiken belegen, dass 42 Prozent der 18- bis 34-Jährigen in der DACH-Region ihre Kaufentscheidungen primär auf Basis von Video-Content treffen.
Dabei zeigt sich ein interessantes Gefälle: Während deutsche Konsument*innen verstärkt auf die Validierung durch technische Expert*innen und zertifizierte Reviewer setzen, reagiert der österreichische Markt überproportional stark auf Community-basierte Empfehlungen und lokales Micro-Influencing. Marken, die ihre Werbeausgaben von klassischem Search (SEA) hin zu inhaltsgetriebenem Social Commerce umschichten, verzeichnen 2026 einen um bis zu 30 Prozent höheren Return on Ad Spend (ROAS), sofern sie die kulturellen Nuancen der DACH-Region in ihrer Tonalität präzise treffen.
Agentic Commerce und die Datengetriebene Logistik
Die technologische Speerspitze bildet der Agentic Commerce, bei dem autonome KI-Agenten den Beschaffungsprozess für den/die Endverbraucher*in übernehmen. Im Jahr 2026 nutzen bereits knapp 15 Prozent der Haushalte in Deutschland KI-gestützte Assistenten, um automatisierte Preisvergleiche und Qualitätsprüfungen durchzuführen.
Dies hat zur Folge, dass die Preiselastizität im Markt abnimmt; Produkte werden zunehmend über ihre "Maschinenlesbarkeit" und algorithmische Sichtbarkeit verkauft. Parallel dazu hat die Logistik in Österreich durch den massiven Ausbau von Pick-up-Stationen eine Effizienzsteigerung erfahren. Da die Kosten für die "Letzte Meile" durch den Fachkräftemangel auf über 7 Euro pro Haustürzustellung gestiegen sind, nutzen 2026 bereits 40 Prozent der urbanen Käufer*innen in Wien, Graz und München automatisierte Abholstationen. Dies reduziert nicht nur die CO2-Bilanz, sondern senkt die Retourenquote signifikant, da die Paketübergabe beim ersten Versuch garantiert ist.
Strategische Schlussfolgerungen für den Markterfolg
Der Erfolg im DACH-Markt 2026 ist untrennbar mit der Fähigkeit verbunden, Daten in Echtzeit zu operationalisieren. Die Gewinner*innen sind Unternehmen, die ihre Lieferketten so flexibel gestaltet haben, dass sie auf regulatorische Änderungen innerhalb weniger Wochen reagieren können.
Während Deutschland durch seine schiere Marktgröße und die hohe Kaufkraft besticht, bietet Österreich als Testmarkt mit hoher digitaler Affinität ideale Bedingungen für Pilotprojekte im Bereich des autonomen Handels. Für globale Akteur*innen bedeutet dies: Investitionen in lokale Compliance, eine radikale Ausrichtung auf Video-Content und die technologische Vorbereitung auf eine Welt, in der Algorithmen die neuen Gatekeeper des Konsums sind, bilden das Fundament für nachhaltiges Wachstum in einer der anspruchsvollsten Wirtschaftsregionen der Welt.
Fazit: Resilienz durch Innovation und Adaption
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der E-Commerce in Deutschland und Österreich im Jahr 2026 kein Terrain für Kurzentschlossene mehr ist, sondern ein hochkomplexes Ökosystem, das operative Exzellenz fordert. Die Zeiten, in denen reines Arbitrage-Geschäft oder ungebremstes Mengenwachstum zum Erfolg führten, sind endgültig vorbei. Heute wird der Markt von jenen dominiert, die den "DACH-Dreiklang" beherrschen: kompromisslose regulatorische Compliance, technologische Vorreiterrolle bei der KI-Integration und eine tiefgreifende kulturelle Lokalisierung.
Für internationale Akteur*innen und lokale Marktführer*innen gilt gleichermaßen: Wer die hohen Standards der deutschsprachigen Konsumenten in Bezug auf Datenschutz, Nachhaltigkeit und Servicequalität nicht nur als Hürde, sondern als Qualitätsmerkmal begreift, wird langfristig von der enormen Kaufkraft und der Loyalität dieser Märkte profitieren. Der Blick auf 2026 zeigt deutlich, dass die Zukunft des Handels im DACH-Raum digitaler, grüner und intelligenter ist als je zuvor. Es ist eine Ära, in der Vertrauen durch Daten belegt und Wachstum durch algorithmische Relevanz gesichert wird.
Die Autorin Yuwei Bao ist Assistenz der Geschäftsführung bei der Wiener E-Business-Agentur Zeevan
Zwischen Pflichtoptimismus und echter Zuversicht
Wie sich Hoffnung vermitteln lässt, wenn man als Führungskraft selbst nach Orientierung sucht.

Krisen erschüttern, Unsicherheit prägt Strategien und selbst Top-Führungskräfte kämpfen oft im Verborgenen mit eigenen Zweifeln. Inmitten dieser Herausforderungen gewinnt ein Konzept an überraschender Bedeutung: Hoffnung. Nicht als naiver Wunschgedanke, sondern als psychologisches Kapital mit nachweislicher Wirkung, für Motivation, Leistung und Widerstandskraft im Team. Hoffnung aktiviert nicht nur, sondern sie liefert innere Energie. Nicht nur um zu formulieren, auch um zu verfolgen, selbst wenn Hindernisse den Weg erschweren. Hoffnung im Führungskontext ist eng mit Optimismus, Selbstwirksamkeit und Resilenz verbunden, den vier Komponenten des sogenannten Psychological Capital (PsyCap). So beeinflussen Führungspersönlichkeiten mit hohem PsyCap nicht nur die psychische Stärke ihrer Mitarbeitenden, sondern steigern auch deren Engagement und Leistungsfähigkeit. Entscheidend dabei: Die Hoffnung der Mitarbeitenden wächst nicht im Vakuum. Sie orientiert sich am Verhalten der Führung. Wer selbst Zuversicht ausstrahlt, erzeugt emotionale Ansteckung. Gerade in unsicheren Zeiten wirkt Hoffnung also nicht nur stabilisierend, sondern sogar produktiv.
Persönliche Gradwanderung
Führungskräfte stehen dabei vor einer paradoxen Aufgabe: Sie sollen Hoffnung vermitteln, obwohl sie selbst häufig mit Erschöpfung, Isolation oder auch inneren Zweifeln ringen. Während der Pandemie berichteten knapp 70 Prozent der C-Level-Führungskräfte, ernsthaft über einen Rückzug nachgedacht zu haben, viele von ihnen griffen im Zuge dessen zu ungesunden Bewältigungsstrategien. Wer Hoffnung jedoch glaubwürdig verkörpern will, muss sich innerlich auch selbst tragen. Dies gelingt nur durch eine bewusste Selbstfürsorge, klare Grenzen und resilienzfördernde Routinen. Dabei bringt der Satz ‚Die Realität definieren und Hoffnung geben‘ die ethische Herausforderung von Führungskräften auf den Punkt. Hoffnung bedeutet hierbei eben nicht, aufkommende Probleme kleinzureden oder schlechte Nachrichten vollständig auszublenden. Vielmehr geht es darum, auch in schwierigen Situationen Wege aufzuzeigen, wie es weitergehen kann. Authentizität spielt in diesem Zusammenhang jedoch eine Schlüsselrolle. Denn wer ausschließlich auf eine positive Rhetorik setzt und kritische Lagen nur beschönigt, verliert schnell an Vertrauen. Umgekehrt erzeugt Hoffnung somit auch erst dann Wirkung, wenn sie mit Ehrlichkeit und einer nachvollziehbaren Perspektive verbunden bleibt.
Angst ersetzt kein Zukunftsbild
Entscheidungen im Führungskontext lassen sich häufig auf zwei Emotionen zurückführen: Angst oder Hoffnung. Zwar erzeugt Angst kurzfristig eine Bewegung, doch langfristig führt sie zu Misstrauen, Rückzug und Resignation. Mitarbeitende, die keine hoffnungsvolle Perspektive mehr erkennen, neigen häufiger dazu, zu kündigen oder brennen schneller aus. Dabei zählt Vertrauen zu den stärksten Treibern von Mitarbeiterbindung und Engagement. Ohne Integrität, Verlässlichkeit und offene Kommunikation kann aber auch Hoffnung keine richtige Wirkung entfalten. Erst das Zusammenspiel von Zuversicht und erlebtem Vertrauen aktiviert echte Veränderungskraft. Gerade auch im Mittelstand rückt das Thema Hoffnung in der aktuellen Zeit immer mehr in den Fokus. Mit knapp 80 Prozent der Unternehmen, die für 2025 einen Abschwung erwarten, wird die Fähigkeit zur Zuversicht zur Überlebensfrage, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Handlungsfelder hervor:
1. Zukunftsplanung trotz Unsicherheit: Dabei stechen vor allem drei strategische Hoffnung ersetzt selbstverständlich keine Strategie, aber sie motiviert überhaupt erstmal, eine zu entwickeln. In komplexen Märkten hilft sie so dabei, Visionen zu bewahren und langfristige Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren.
2. Arbeitskultur und Generationen verbinden: Die Erwartungen jüngerer Generationen verlangen nach einem neuen Führungsverständnis. Hoffnungsvoll geführte Organisationen schaffen damit ein Gefühl der Zugehörigkeit, vermitteln ihren Angestellten einen Sinn und nutzen Unterschiedlichkeit als eine entscheidende Stärke.
3. Krisenkommunikation mit Haltung: Hoffnung zeigt sich nicht in auswendig gelernten Durchhalteparolen, sondern in glaubwürdiger Orientierung. Wer klare Ziele formuliert und selbst kleine Fortschritte gut sichtbar macht, ermöglicht seinen Mitarbeitenden Identifikation und verleiht Bedeutung selbst in widrigen Zeiten.
Persönliche Kompetenz
Dabei lässt sich Hoffnung auch trainieren, nicht nur als Haltung, sondern als bewusste Führungsdisziplin. Im ersten Schritt gilt es, ein Vorbild zu sein. Denn wenn die Führungskraft sie sichtbar lebt, kann Hoffnung auf die Mitarbeitenden überspringen. Hierbei braucht es jedoch ein wirklich emotionales Vorleben, statt nur einer einfachen Vision auf Papier. Zudem müssen Führungskräfte im Vorfeld auch einmal echte Grenzen setzen. Nur wer selbst psychisch stabil bleibt, kann für andere zum Hoffnungsträger werden. Burnout-Prävention und eine gesunde Selbstreflektion gelten deshalb nicht nur als ein scheinbarer Luxus, sondern erweisen sich als eine echte Pflicht. Auch das klare Zeigen von Resilienz nach Rückschlägen spielt eine wichtige Rolle. Hoffnung benötigt Raum zum Lernen. Um die psychologische Sicherheit im Team zu stärken, braucht es auch die Fähigkeit Scheitern, als einen Teil des Arbeitsprozesses annehmen zu können, um damit auch eine Entwicklung sichtbar zu machen. Schlussendlich müssen Führungspersönlichkeiten ihren eigenen Einflussbereich genau kennen. Uneingeschränkte Klarheit über gestaltbare Faktoren schützt so vor einem plötzlich aufkommenden Gefühl der Ohnmacht und fokussiert die teaminterne Energie auf das, was tatsächlich verändert werden kann. Genau in diesem Spannungsfeld wächst Hoffnung.
Strategisches Kapital
Führung bedeutet mehr als Strategie und Zahlen – sie verlangt Haltung. Hoffnung beschreibt in diesem Zusammenhang keine naive Wunschvorstellung, sondern eine produktive Kraft im Unternehmen, die Orientierung, Motivation und Verbundenheit im Team schafft. Entscheidend dafür ist jedoch eine Führung, die realistisch bleibt, Vertrauen aufbaut und die Zukunft glaubwürdig gestaltet. Nur wer Hoffnung nicht nur fordert, sondern sie auch selbst verkörpert, kann sie in seinen Mitarbeitenden pflanzen.“
Der Autor Ben Schulz ist Unternehmensberater, Vorstand der Ben Schulz & Partner AG und SPIEGEL-Beststeller-Autor.
Mehr als ein Accessoire: Warum Taschen im Alltag von Gründerinnen, Berufstätigen und Kreativen immer wichtiger werden
Ein redaktioneller Blick auf aktuelle Taschentrends, Funktion, Materialien und die Bedeutung gut durchdachter Accessoires im beruflichen und privaten Alltag.

Die Arbeitswelt verändert sich – und mit ihr auch das, was wir täglich mit uns tragen. Zwischen Homeoffice, Coworking-Space, Kundenterminen und privaten Verpflichtungen verschwimmen die Grenzen immer stärker. Das zeigt sich auch bei einem Gegenstand, der lange Zeit als klassisches Modeaccessoire galt: der Handtasche. Heute übernimmt sie Funktionen, die weit über den ästhetischen Anspruch hinausgehen. Sie soll organisieren, schützen, transportieren – und gleichzeitig zum persönlichen Stil passen.
Gerade Frauen, die beruflich viel unterwegs sind oder mehrere Rollen gleichzeitig erfüllen, setzen zunehmend auf funktionale, vielseitige Designs. Die Nachfrage wächst nach Taschen, die genügend Platz für Laptop, Unterlagen, Alltagsbedarf und persönliche Essentials bieten, ohne dabei an Eleganz zu verlieren. Dass sich auf Plattformen eine große Auswahl an Damen Handtaschen in unterschiedlichsten Modellen findet, liegt vor allem daran, dass die Lebensrealitäten vielfältiger geworden sind. Eine Tasche begleitet heute nicht mehr nur ein Outfit – sie begleitet den gesamten Tag.
Funktion und Design wachsen zusammen
Taschen haben sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Während früher klare Trennlinien zwischen Business-, Freizeit- und Abendtaschen existierten, rücken hybride Formen immer mehr in den Vordergrund. Besonders gefragt sind:
- Clean gestaltete Tote Bags, die Laptoptasche und Allrounder zugleich sind
- Crossbody-Modelle, die Bewegungsfreiheit bieten
- Minimalistische Rucksäcke aus hochwertigen Materialien
- Strukturierte Handtaschen, die Professionalität ausstrahlen
Unternehmerinnen, Freelancerinnen und Studierende wollen Modelle, die mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllen: genügend Stauraum, sichere Fächer, hochwertige Verarbeitung und ein Design, das sowohl im Büro als auch in der Freizeit funktioniert.
Materialien, die Trends bestimmen
Neben der Optik spielt das Material heute eine zentrale Rolle. Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Qualität sind Kriterien, die Käuferinnen zunehmend wichtiger nehmen. Besonders beliebt sind:
- Vegane Lederalternativen, die robust und zugleich ästhetisch sind
- Recycelte Kunststoffe für sportive Modelle
- Glattes Rindsleder für langlebige Business-Taschen
- Textilgewebe mit wasserabweisenden Eigenschaften
Viele Marken setzen inzwischen auf zertifizierte Herstellungsprozesse oder innovative Materialtechnologien, die Design und Umweltbewusstsein miteinander verbinden.
Organisation wird zum neuen Luxus
Während Mode früher vor allem durch äußere Merkmale bewertet wurde, zählt im Alltag vieler Frauen etwas anderes: Struktur. Taschen mit cleveren Innenfächern, separaten Laptop-Compartments, Reißverschlusstaschen und durchdachten Details erleichtern den Alltag enorm.
Immer mehr Modelle sind so aufgebaut, dass:
- Unterlagen knickfrei transportiert werden
- Technikgeräte sicher verstaut sind
- Snacks, Schlüssel, Kosmetik und Bargeld getrennt voneinander Platz finden
- Ordnung auch bei einem vollen Tagesprogramm problemlos möglich ist
Dieser Fokus auf Organisation spiegelt einen klaren gesellschaftlichen Trend wider: Effizienz und Ästhetik schließen sich nicht mehr aus.
Warum Taschenwahl auch ein Stück Selbstbestimmung ist
Accessoires sagen viel über Personen aus – das gilt heute mehr denn je. Die Tasche entscheidet darüber, wie sicher wir uns im Alltag bewegen, wie gut wir vorbereitet sind und wie einfach es ist, flexibel zu reagieren. Sie unterstützt dabei, berufliche und private Aufgaben miteinander zu verbinden und den Tag souverän zu meistern.
Gerade Gründerinnen und junge Professionals betrachten eine gut gewählte Tasche daher als Teil ihrer persönlichen „Work-Equipment-Strategie“. Sie soll:
- Professionalität signalisieren
- Individualität zeigen
- Komfort bieten
- Vertrauen schaffen
Es ist kein Zufall, dass Taschen zu den Accessoires gehören, die Menschen am häufigsten bewusst auswählen – sie sind Ausdruck von Stil, Struktur und Mobilität.
Trends, die den Markt prägen
Gegenwärtig lassen sich drei große Trends beobachten:
1. Modularität
Taschen mit austauschbaren Gurten, separaten Pouches und variablen Tragemöglichkeiten.
2. Understatement
Zurückhaltende Farben, klare Linien, hochwertige Materialien – weniger Statement, mehr Stil.
3. Smarte Details
RFID-Schutz, wasserabweisende Materialien, Laptop-Padding, leichte Konstruktionen.
Diese Trends zeigen: Funktion wird zunehmend zum stilprägenden Element.
Fazit: Die richtige Tasche ist eine Investition in den Alltag
Eine gut gewählte Tasche ist viel mehr als ein Modeartikel. Sie ist ein täglicher Begleiter, der Ordnung schafft, Professionalität vermittelt und Flexibilität ermöglicht. Angesichts der großen Auswahl an Designs, Materialien und Formen lohnt sich ein bewusster Blick auf das, was wirklich zählt: Qualität, Funktion und ein Stil, der sich in verschiedene Lebenssituationen einfügt.
Wer heute eine Tasche auswählt, entscheidet sich nicht nur für ein Accessoire, sondern für ein Werkzeug, das den Alltag erleichtert und gleichzeitig ein Stück Persönlichkeit transportiert. Genau deshalb wachsen Anforderungen, Auswahl und Innovationskraft in diesem Segment stetig – und machen die moderne Handtasche zu einem unverzichtbaren Bestandteil des mobilen Lebens.
Zeit ist Geld: Was Unternehmer bei Flugverspätungen wissen sollten
Für Unternehmer, die beruflich unterwegs sind, kann eine Flugverspätung nicht nur ein Ärgernis sein, sondern echte wirtschaftliche Schäden verursachen. Wer seine Rechte kennt und gezielt Schritte unternimmt, kann zumindest einen Teil der Schäden abmildern.

In der Geschäftswelt gilt eine alte Weisheit: Zeit ist Geld. Für Unternehmer, die beruflich unterwegs sind, kann eine Flugverspätung nicht nur ein Ärgernis sein, sondern echte wirtschaftliche Schäden verursachen, etwa verpasste Meetings, zusätzliche Hotelkosten oder Produktivitätseinbußen. Wer in solchen Fällen seine Rechte kennt und gezielt Schritte unternimmt, kann zumindest einen Teil der Schäden abmildern.
Welche Ansprüche bestehen und ab wann?
Als Geschäftsreisende stehen Ihnen in der EU dieselben Fluggastrechte zu wie Privatpersonen. Laut der EU-Verordnung 261/2004 kann bei einer Flugverspätung ab drei Stunden am Zielort eine Entschädigung verlangt werden, abhängig von der Flugstrecke zwischen 250 € und 600 €. Weiterhin sind Airlines verpflichtet, Betreuung (z. B. Mahlzeiten, Hotelunterkunft bei Übernachtung, Kommunikationsmöglichkeiten) zu leisten. Grundsätzlich gibt es nämlich auch bei komplexen, unscheinbaren Situationen eine Entschädigung Flugverspätung. Daher ist es immer sinnvoll sich ordentlich zu informieren.
Beispielsweise sieht das Gesetz vor, dass bei reiner Verspätung (nicht durch außergewöhnliche Umstände) eine Entschädigung wie folgt geltend gemacht werden kann:
- 250 € für Strecken bis 1.500 km bei mindestens 3 Stunden Verspätung
- 400 € bei mittleren Distanzen (bis ca. 3.500 km)
- 600 € bei Langstrecken (über 3.500 km) und Verspätung von mindestens 4 Stunden
Professionelle Plattformen kümmern sich um Ihre Entschädigung und agieren dabei nach dem Prinzip „Kein Erfolg, keine Gebühr“, eine Provision wird nur im Erfolgsfall fällig.
Besondere Aspekte für Unternehmen & Geschäftsreisen
Für Unternehmer gelten ein paar zusätzliche Überlegungen:
1. Vertragliche Risiken & Haftung intern
Auch wenn die Entschädigung Ihnen als Airline-Kunde zusteht, sind beim internen Kostenersatz gegenüber Ihrem Unternehmen oft andere Regeln relevant, etwa, wie der Ausfall von Arbeitszeit oder verpasste Termine intern bilanziert oder entschädigt werden.
2. Zeitverlust & Opportunitätskosten
Eine Verspätung kostet nicht nur Geld in Form von Ausgaben, sondern vor allem entgangene Geschäftschancen. Eine Stunde im Wartebereich statt im Meeting kann deutlich teurer sein als die Flugentschädigung selbst.
3. Proaktives Vorgehen & Dokumentation
Heben Sie alle Belege auf (Bordkarten, E-Mails, Quittungen für Verpflegung oder Transfers), notieren Sie exakte Verspätungszeiten und beanstanden Sie sofort am Flughafen, das erleichtert spätere Geltendmachung.
4. Fristen & rechtlich verbindliche Schritte
In Deutschland beträgt grundsätzlich die Verjährungsfrist für Entschädigungsansprüche drei Jahre, gezählt vom Jahresende des Flugs.
Zur praktischen Umsetzung kann es sinnvoll sein, einen spezialisierten Dienstleister einzubinden, der die Kommunikation mit der Airline übernimmt und rechtliche Schritte begleitet. Ein solcher Service etwa übernimmt die gesamte Korrespondenz, solange die Forderung erfolgreich durchgesetzt wird.
Hintergründe & Ursachen: Warum Flüge verspätet sind
Dass Flugverspätungen kein seltenes Phänomen sind, zeigen aktuelle Zahlen: Deutschland weist eine Verspätungsquote von rund 30,82 % auf, damit gehört das Land zu denjenigen mit besonders vielen gestörten Flügen. Am häufigsten liegen die Ursachen bei Airlines selbst (z. B. technische Defekte, Crew-Probleme), rund 45 bis 49 % der Fälle, während Wetter nur in etwa jedem zehnten Fall als Auslöser genannt wird.
Darüber hinaus zeigt eine Analyse für deutsche Flughäfen, dass Frankfurt mit über 23 Minuten durchschnittlicher Abflugverspätung in den letzten Jahren besonders betroffen war. Ein absoluter Spitzenwert im Ländervergleich.
Beispielrechnung: Was kann realistisch geltend gemacht werden?
Angenommen, ein Unternehmer fliegt auf eine Strecke von ca. 2.000 km und erreicht sein Ziel mit einer Verspätung von 3 Stunden. Er würde laut den Regelungen Anspruch auf 400 € Entschädigung haben. Nach Abzug einer üblichen Provision des Dienstleisters verbleibt ein Nettobetrag, der zumindest Teile des entstandenen Schadens decken kann.
Parallel dazu wäre wertvoll, intern zu berechnen, wie hoch der Wert einer Stunde zusätzlicher Arbeitszeit oder verpasster Meetings ist, diese Opportunitätskosten übersteigen oft deutlich den Entschädigungsbetrag.
Fazit & Handlungsempfehlungen für Unternehmer
1. Kenntnis der Rechte: Jeder Geschäftsreisende sollte seine Rechte nach EU-Verordnung 261/2004 kennen.
2. Dokumentation & schnelles Handeln: Belege sicherstellen, am Flughafen reklamieren, Fristen beachten.
3. Externe Unterstützung erwägen: Anbieter können Aufwand und rechtliches Risiko übernehmen.
4. Interne Bewertung: Nutzen Sie Verspätungskosten nicht nur in Geld, sondern auch in Zeit und Geschäftsausfall.
Zeit ist ein knappes und wertvolles Gut, und gerade für Unternehmer können Flugverspätungen eine erhebliche Problemdimension annehmen. Wer seine Rechte kennt und angemessen reagiert, kann zumindest die finanziellen Folgen begrenzen. Nachdem ein Flug schnell hunderte Euro verschlingt ist dies ein lohnenswertes Entgegenkommen, welches ein Großteil der Fluggäste nicht in Anspruch nehmen. Für viele wirkt es zu komplex, weswegen es absolut sinnvoll ist hier einen Dritten zu engagieren, der die Aufwände komplett übernimmt.
Routine schafft Erfolg!
Wie du mit Geduld, Disziplin und Routine Exzellenz schaffst und dein Unternehmen langfristig erfolgreich aufstellst.
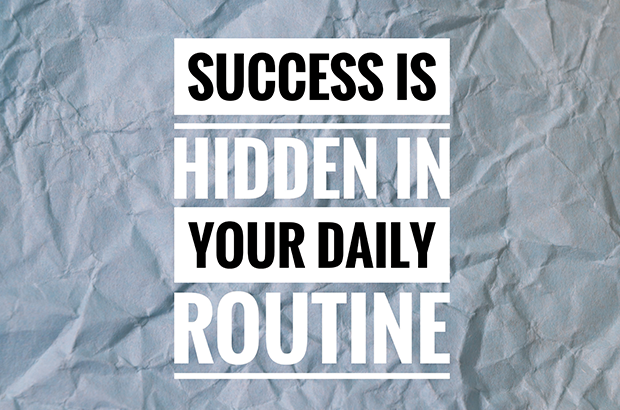
Erfolg klingt aufregend, oder? Große Deals, bahnbrechende Ideen, inspirierende Reden und dieser Nervenkitzel, wenn alles zusammenkommt. Doch hier folgt die unbequeme Wahrheit: Langfristiger Gründungserfolg hat weniger mit diesen Highlight-Momenten zu tun, sondern viel mehr mit der konsequenten Wiederholung scheinbar unspektakulärer Aufgaben. Klingt ernüchternd? Vielleicht. Aber genau hier liegt der Unterschied zwischen jenen, die langfristig wachsen, und denen, die nach einer anfänglichen Euphorie wieder von der Bildfläche verschwinden.
Langfristig schlägt Konsistenz Kreativität
Stell dir eine(n) Profisportler*in vor. Niemand wird Weltmeister*in, weil er/sie hin und wieder ein herausragendes Spiel abliefert. Es sind die unzähligen, oft unspektakulären Trainingseinheiten, die den Unterschied machen. Ähnlich ist es als Gründer*in. Ja, deine Idee war genial. Ja, dein Pitch war großartig. Aber weißt du, was wirklich zählt? Die tägliche Disziplin, immer wieder die gleichen „langweiligen“ Dinge zu tun: Prozesse zu optimieren, E-Mails zu beantworten, Buchhaltung zu pflegen, Anfragen von Kund*innen zu managen.
Keine(r) postet auf LinkedIn: „Heute zum zehnten Mal hintereinander mein CRM gepflegt.“ Genau solche Aktivitäten sind es jedoch, die dein Business am Laufen halten. Sie sind das Fundament, die unsichtbaren Muskelbewegungen unter der Oberfläche. Ohne sie bricht alles zusammen.
Die Macht der Wiederholung
Erfolg ist ein Marathon, kein Sprint. Viele Gründer*innen unterschätzen, wie entscheidend es ist, konsequent an den Grundlagen zu arbeiten. Die tägliche Akquise, das ständige Finetuning der internen Abläufe, die regelmäßige Analyse von Zahlen – das sind die Bausteine eines stabilen Geschäfts. Manchmal fühlt es sich an, als würde man in einem Hamsterrad laufen. Aber genau dieses Hamsterrad ist oft das Sprungbrett für nachhaltiges Wachstum.
Kennst du das Gefühl, wenn du eine Aufgabe zum hundertsten Mal machst und denkst: „Das kann doch nicht der Schlüssel zum Erfolg sein!“ Doch, genau das ist er. Routine schafft Exzellenz. Meisterschaft kommt nicht durch einmaliges Talent, sondern durch ständige Wiederholung. Dafür bedarf es einer großen Portion Disziplin, besonders dann, wenn sich die Motivation mal wieder eine Auszeit gönnt.
Die Illusion der Abkürzung
Es gibt keinen magischen Shortcut zum Erfolg. Natürlich gibt es Glückstreffer, und ja, manchmal explodieren Start-ups über Nacht. Aber für die meisten ist es ein langer, harter Weg, geprägt von Ausdauer und Wiederholung. Die erfolgreichsten Gründer*innen sind nicht diejenigen, die auf den nächsten großen Hype aufspringen, sondern jene, die bereit sind, Tag für Tag diszipliniert an ihrem Business zu arbeiten.
Erfolg ist keine Rakete, die senkrecht nach oben schießt, sondern eher wie eine Bergwanderung: anstrengend, manchmal frustrierend, aber mit jeder Etappe kommst du dem Ziel näher. Und das Beste daran? Du entwickelst dich unterwegs mit.
Wie du langweilige Aufgaben spannend machst
Jetzt denkst du vielleicht: „Okay, ich verstehe, dass ich durchhalten muss. Aber wie halte ich durch, wenn es sich so eintönig anfühlt?“ Gute Frage! Hier sind einige Strategien:
- Setze klare Ziele: Auch die monotonste Aufgabe ergibt Sinn, wenn du sie als Teil eines großen Plans siehst. Mach dir bewusst, wofür du arbeitest.
- Gamification: Belohne dich für (kleine) Meilensteine. Fortschritt fühlt sich besser an, wenn du ihn sichtbar machst.
- Systeme statt Motivation: Verlass dich nicht darauf, dass du jeden Tag „Lust“ hast. Schaffe feste Routinen, die keine Willenskraft mehr kosten.
- Automatisiere, wo es geht: Nutze Tools, um repetitive Aufgaben effizienter zu gestalten. Digitalisierung ist nicht nur ein Buzzword, sie ist deine beste Mitarbeiterin.
- Wechsle die Perspektive: Stell dir vor, du wärst ein(e) Investor*in. Würdest du in jemanden investieren, der/die nur die spannenden Dinge erledigt?
- Finde Gleichgesinnte: Austausch mit anderen Gründer*innen kann motivieren, inspirieren und dich auf Kurs halten.
- Erkenne den langfristigen Wert: Viele Aufgaben erscheinen kurzfristig lästig, zahlen sich aber langfristig aus. Denke an einen Gärtner, der jeden Tag seine Pflanzen gießt – das Ergebnis sieht er erst später.
- Mache Pausen gezielt: Harte Arbeit bedeutet nicht, sich auszubrennen. Plane bewusst Erholungsphasen ein, um langfristig leistungsfähig zu bleiben.
Disziplin schlägt Stimmung
Motivation ist flüchtig, Disziplin bleibt. Gerade dann, wenn es langweilig, anstrengend oder zäh wird, zeigt sich, wie ernst es dir wirklich ist. Es ist einfach, motiviert zu sein, wenn alles läuft. Die eigentliche Arbeit beginnt, wenn du keine Lust hast und es trotzdem machst.
Die Kunst der Geduld
Ein weiteres Erfolgsgeheimnis gefällig? Geduld. Wir leben in einer Welt, in der alles schnell gehen muss. Wachstum, Reichweite, Erfolg – am besten gestern. Echte Unternehmer*innen wissen jedoch: Die besten Dinge brauchen Zeit. Große Unternehmen wurden nicht in einer Nacht aufgebaut. Es waren Jahre der konsequenten, manchmal eintönigen, aber essenziellen Arbeit, die letztlich den Unterschied gemacht haben. Geduld bedeutet nicht, passiv zu sein. Es bedeutet, kontinuierlich aktiv zu bleiben, auch wenn der Output auf sich warten lässt.
Die Langweiligen gewinnen
Es mag nicht sexy klingen, aber die Wahrheit ist: Große Erfolge entstehen nicht durch einzelne Geistesblitze, sondern durch tägliche, oft unscheinbare Arbeit. Das ist kein Mythos, sondern die Realität erfolgreicher Gründer*innen. Während andere sich vom nächsten Trend ablenken lassen, arbeitest du weiter. Während andere den Fokus verlieren, bleibst du dran. Das ist keine Schwäche, sondern dein (unfairer) Vorteil.
Der Preis der Konsequenz
Was dabei oft unterschätzt wird: Es kostet Kraft, Tag für Tag dieselben Aufgaben zu erledigen. Nicht, weil sie objektiv schwer wären, sondern weil unser Kopf nach Abwechslung schreit, nach Neuem, nach Reiz. Doch genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen.
Erfolgreiche Gründer*innen bleiben fokussiert, sagen nicht bei jeder Gelegenheit: „Das könnten wir auch noch machen“, sondern sagen stattdessen öfter: „Nein. Das lassen wir jetzt bewusst weg.“ Denn Klarheit bedeutet nicht, alles zu tun, sondern zu wissen, was nicht zu tun ist.
Routine als Wettbewerbsvorteil
Warum ist das wichtig? Weil die meisten auf halber Strecke aufgeben. Sie verlieren den Glauben, wenn der große Durchbruch und die Likes ausbleiben oder keine(r) klatscht. Doch genau in diesem Moment beginnt der Unterschied. Wer durchhält, wenn es langweilig wird, gewinnt.
Denn während andere auf der Suche nach dem nächsten Kick sind, baust du dein Fundament – stabil, verlässlich, tragfähig. Routine ist kein Rückschritt. Sie ist dein Wettbewerbsvorteil. Erfolg liebt Wiederholung. Die Frage ist: Liebst du sie auch genug, um täglich anzutreten?
Fazit: Der Weg der Disziplinierten
Es sind nicht diejenigen mit der größten Idee, die gewinnen. Es sind jene, die sie am beharrlichsten umsetzen. Nicht die Genies dominieren den Markt, sondern die Ausdauernden, die Geduldigen, die Sturen. Diejenigen, die auch an Tag 1000 noch das tun, was an Tag eins funktioniert hat.
Wenn du dich also das nächste Mal bei einer scheinbar langweiligen Aufgabe erwischst, erinnere dich: Genau jetzt wächst dein Unternehmen; nicht im Rausch des Erfolgs, sondern in der Stille der Wiederholung. Denn wahre Größe entsteht nicht durch Glanz, sondern durch Tiefe.
Der Autor Markus Czerner ist Motivationsredner, Mindset-Experte und Sparringspartner für Führungskräfte. Er unterstützt Menschen dabei, ihr volles Potenzial auf die Bühne und ins Leben zu bringen.
Arbeitskräfte aus Polen und Tschechien: Gefragt wie nie – mit Starke Jobs zur optimalen Besetzung
Qualifiziertes Personal zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Genau hier kommt der Blick über die Grenze ins Spiel.

Der Arbeitsmarkt steht nicht still – genau wie die Anforderungen an Unternehmen, flexibel und schnell auf Personalbedarf zu reagieren. Ob saisonale Auftragsspitzen, langfristige Vakanzen oder kurzfristige Ausfälle: Qualifiziertes Personal zu finden, wird zunehmend zur Herausforderung. Die Bewerberlage ist angespannt, viele Stellen bleiben unbesetzt.
Umso gefragter sind smarte Lösungen, die den Aufwand im Recruiting minimieren und zugleich zuverlässige Besetzungen ermöglichen. Genau hier kommt der Blick über die Grenze ins Spiel: Arbeitskräfte aus dem Ausland – insbesondere aus Polen und Tschechien – gewinnen an Bedeutung und bieten eine echte Alternative zur lokalen Suche.
Polen und Tschechien als Lösung: Nähe, Qualität, Verlässlichkeit
Wenn es um internationale Fach- und Hilfskräfte geht, stehen Polen und Tschechien ganz oben auf der Liste. Das hat gute Gründe: Die geografische Nähe ermöglicht schnelle Einsätze und unkomplizierte Anreisen. Hinzu kommt die hohe Qualifikation vieler Arbeitskräfte – von technischen Berufen bis hin zu gewerblichen Tätigkeiten.
In vielen Fällen sprechen die Bewerber bereits Deutsch oder Englisch, was die Zusammenarbeit deutlich erleichtert. Besonders gefragt sind Mitarbeitende aus diesen Ländern in Bereichen wie Logistik, Produktion, Pflege oder Bau – also überall dort, wo Anpacken gefragt ist.
Was viele schätzen: die Verlässlichkeit, Arbeitsmoral und Flexibilität, mit der diese Fach- und Hilfskräfte aus Osteuropa überzeugen. Kurz gesagt: Wer gute Leute sucht, findet sie oft direkt nebenan – jenseits der Grenze.
Klare Vorteile für Unternehmen: Flexibel bleiben, Aufwand sparen
Die Zusammenarbeit mit Arbeitskräften aus Polen und Tschechien bringt handfeste Vorteile mit sich. Unternehmen können schnell und gezielt auf Personalengpässe reagieren, ohne sich langfristig binden zu müssen. Besonders bei saisonalen Projekten oder schwankender Auftragslage zahlt sich diese Flexibilität aus. Auch der bürokratische Aufwand sinkt erheblich – vor allem, wenn eine erfahrene Vermittlungsagentur im Hintergrund agiert.
Die Personalsuche läuft deutlich effizienter, da Vorauswahl, Interviews und Dokumentenprüfung bereits erledigt sind. Gleichzeitig profitieren Betriebe von motivierten, qualifizierten Mitarbeitenden, die sich schnell einarbeiten und zuverlässig Leistung bringen.
Das spart Zeit, Nerven – und oft auch Kosten. Wer also flexibel bleiben will, ohne Qualität einzubüßen, fährt mit externer Unterstützung genau richtig.
Starke Jobs: Wenn Vermittlung mehr ist als nur ein Profilabgleich
Hinter einer erfolgreichen Personalbesetzung steckt mehr als ein gut klingender Lebenslauf. Starke Jobs weiß genau, worauf es ankommt – und begleitet den gesamten Prozess von Anfang bis Ende. Bereits bei der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten wird sorgfältig geprüft: Qualifikationen, Sprachkenntnisse, Motivation. Nur wer wirklich passt, kommt überhaupt in die engere Wahl.
Danach übernimmt das Team die gesamte Organisation – von der Anreise über die Anmeldung bei Behörden bis hin zur ersten Einarbeitung im Unternehmen. Auch nach der Vermittlung bleibt Starke Jobs dran und steht beiden Seiten beratend zur Seite. So entsteht nicht nur eine schnelle Lösung, sondern eine langfristige Win-win-Situation für Unternehmen und Mitarbeitende.
Mensch im Mittelpunkt: Was gute Zusammenarbeit ausmacht
Starke Jobs setzt nicht auf Masse, sondern auf Klasse – und auf echte Partnerschaft. Statt anonymer Prozesse gibt es persönliche Betreuung und offene Kommunikation. Das gilt sowohl für Unternehmen als auch für die vermittelten Arbeitskräfte. Ziel ist nicht der schnelle Abschluss, sondern eine nachhaltige Zusammenarbeit, bei der sich beide Seiten wohlfühlen.
Dazu gehören faire Arbeitsbedingungen, transparente Abläufe und ein respektvoller Umgang miteinander. Wer mit Starke Jobs zusammenarbeitet, bekommt keine Standardlösung, sondern ein individuell abgestimmtes Konzept. So entstehen echte Erfolgsbeziehungen, die auf Vertrauen basieren – und weit über eine einfache Vermittlung hinausgehen. Denn letztlich zählt nicht nur, dass eine Stelle besetzt wird, sondern dass es wirklich passt.
Praktisch denken, clever besetzen – mit Starke Jobs auf Kurs
Wer dem Fachkräftemangel gelassen begegnen will, findet in polnischen und tschechischen Arbeitskräften eine verlässliche Lösung. Mit Starke Jobs gelingt der Zugang zu qualifiziertem Personal einfach, schnell und rechtssicher – ganz ohne bürokratischen Ballast. Die Kombination aus Erfahrung, persönlicher Betreuung und klaren Werten macht den Unterschied.
So entstehen Besetzungen, die nicht nur kurzfristig helfen, sondern langfristig überzeugen. Wer heute flexibel bleiben will, baut auf Partnerschaften, die funktionieren – und auf Menschen, die mit anpacken.
Print mit Persönlichkeit: Warum Visitenkarten auch für Start-ups wichtig bleiben
Warum Printprodukte wie Visitenkarten auch 2025 im Gründer*innen-Alltag relevant bleiben – und worauf bei Gestaltung und Produktion zu achten ist.

In einer Welt, in der alles digitalisiert scheint – von Networking über Bewerbungsgespräche bis hin zum Vertragsabschluss –, wirkt das Thema Print fast altmodisch. Doch gerade bei Gründungen, beim Aufbau von Kund*innenbeziehungen oder beim Auftritt auf Messen zeigt sich: Printprodukte wie Visitenkarten, Flyer oder Briefpapier sind alles andere als aus der Zeit gefallen. Sie sind sichtbare Anker im digitalen Rauschen – und können den Unterschied machen zwischen Austausch und Eindruck.
Ob im ersten Kund*innengespräch oder beim Pitch vor Investor*innen – der Moment, in dem Sie eine Visitenkarte erstellen und überreichen, ist nicht nur ein Akt der Kontaktweitergabe. Er ist eine Geste. Eine Entscheidung für Substanz. Und ein Statement in Sachen Stil.
Der erste Eindruck zählt – und bleibt
Während LinkedIn-Profile, QR-Codes oder digitale Visitenkarten praktisch sind, fehlt ihnen oft eines: das Gefühl von Echtheit. Eine hochwertig gestaltete Visitenkarte vermittelt Wertschätzung, Professionalität und visuelle Identität auf den ersten Blick. Sie sagt: Ich nehme meine Idee ernst – und dich auch.
Gerade bei Netzwerkveranstaltungen, Gründungsmessen oder Co-Working-Pitches bleibt der erste physische Eindruck oft länger im Gedächtnis als eine E-Mail im Posteingang. Und wenn es hektisch wird, ist eine greifbare Karte oft schneller zur Hand als das Smartphone.
Visitenkarten als Markenbaustein
Für junge Unternehmen ist der Markenauftritt ein zentraler Bestandteil der Positionierung. Farbwahl, Logo, Typografie – alles trägt zur Identität bei. Die Visitenkarte ist dabei nicht nur ein Infomedium, sondern ein Träger dieser Identität. Sie ist Miniatur-Markenbotschaft, komprimiertes Designsystem und unterschätzter Imagefaktor zugleich.
Entsprechend wichtig ist es, sich bei der Gestaltung Zeit zu nehmen – oder professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Investition lohnt sich: Eine Visitenkarte, die durch Design, Haptik und Aussage überzeugt, bleibt nicht nur in der Tasche, sondern auch im Kopf.
Print 2025: Nachhaltig, individuell, hochwertig
Auch im Druckbereich hat sich viel getan: Umweltfreundliche Papiere, klimaneutrale Produktion und vegane Druckfarben sind längst keine Ausnahme mehr. Wer bei der Gründung auf Nachhaltigkeit achtet, sollte das auch bei Printprodukten tun – nicht nur aus Überzeugung, sondern auch, weil es bei Kund*innen, Partner*innen und Förderinstitutionen immer stärker wahrgenommen wird.
Neben der ökologischen Komponente ist Individualisierung ein wachsender Trend: Geprägte Logos, ungewöhnliche Formate, Softtouch-Oberflächen oder farbige Schnittkanten machen aus der klassischen Visitenkarte ein kreatives Statement. Auch QR-Codes mit direkter Verlinkung zum Online-Profil oder zur Projektseite lassen sich heute problemlos integrieren – und verbinden Print mit Digitalem.
Warum Start-ups nicht auf Print verzichten sollten
Auch wenn vieles online läuft: Persönlicher Kontakt ist und bleibt ein entscheidender Erfolgsfaktor im Business. Und genau hier entfaltet Print seine Stärken. Eine gedruckte Karte überbrückt Unsicherheit, schafft Verbindlichkeit und bleibt auch dann noch bestehen, wenn WLAN oder Akku versagen.
Gerade in der Frühphase, wenn Vertrauen aufgebaut werden muss, sind solche „analogen Markenberührungen“ wichtig. Sie zeigen: Wir sind präsent – nicht nur im Netz, sondern auch im echten Leben.
Tipps für die perfekte Visitenkarte
- Reduktion ist Trumpf: Name, Funktion, Logo, Website – mehr braucht es meist nicht. Klarheit vor Kreativität.
- Material bewusst wählen: Ob klassisch matt, strukturiert oder mit Effektlack – die Haptik beeinflusst die Wirkung.
- Gestaltung als Teil der Marke denken: Farben, Schriften und Bildsprache sollten zum gesamten Auftritt passen.
- QR-Codes sinnvoll integrieren: Für mehr Interaktion, aber ohne das Layout zu überladen.
- Format mit Bedacht wählen: Standardgrößen sind praktisch, Sonderformate fallen auf – aber passen nicht immer ins Portemonnaie.
Print ist kein Gegensatz zur Digitalisierung – sondern Ergänzung
Viele Gründer*innen glauben, Print sei ein Relikt vergangener Zeiten. In Wahrheit aber erleben hochwertige Druckprodukte derzeit eine Renaissance – gerade weil sie in einer überdigitalisierten Welt auffallen. Sie sind langsam, bewusst und wertig. Und damit genau das, was im schnellen Business-Alltag oft fehlt.
Start-ups, die Print gezielt einsetzen, können sich von der Masse abheben. Und zeigen gleichzeitig: Wir haben nicht nur digitale Skills, sondern auch Stilbewusstsein, Substanz und Haltung.
Kleine Karte, großer Auftritt
In der Gründungsphase zählt jedes Detail. Und manchmal ist es genau dieses eine Stück Papier, das den bleibenden Eindruck hinterlässt. Wer bewusst eine Visitenkarte erstellt, denkt nicht rückwärts – sondern weiter. Denn gute Gestaltung, persönliche Ansprache und nachhaltige Materialien sind keine Gegensätze zum Digitalen. Sie sind seine analoge Erweiterung.
Printprodukte sind mehr als Informationsträger. Sie sind Werkzeuge – für Kommunikation, Markenbildung und Beziehungspflege. Und deshalb auch 2025 ein fester Bestandteil jedes smarten Gründungskonzepts.
Die Zukunft des Sehens: Wege zur besseren visuellen Gesundheit
Die Augen leisten täglich Höchstarbeit. Sehtraining, Technik, Therapie: Was hilft wirklich, um langfristig wieder besser sehen zu können – jenseits der Brille?

Gutes Sehen ist eine zentrale Voraussetzung für Lebensqualität – beim Arbeiten, Lernen, Autofahren oder in der Freizeit. Doch der Alltag vieler Menschen stellt die Augen zunehmend vor Herausforderungen: Ständiges Starren auf Bildschirme, künstliches Licht, Stress und mangelnde Pausen führen dazu, dass die Sehkraft bei vielen nachlässt – oft schon in jungen Jahren.
Wer dauerhaft wieder besser sehen können möchte, sollte frühzeitig handeln: durch bewusste Sehgewohnheiten, präventive Maßnahmen und gegebenenfalls auch durch gezielte Unterstützung. Denn gutes Sehen ist kein Zufall – es ist das Ergebnis aus Pflege, Wissen und richtigen Entscheidungen im Alltag.
Wenn die Augen an ihre Grenzen stoßen
Die Anforderungen an unser visuelles System sind in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Digitale Arbeit, ständiges Fokussieren auf kurze Distanzen und geringe Erholungsphasen belasten die Augen dauerhaft. Hinzu kommen Umweltfaktoren wie trockene Luft, künstliches Licht oder unausgewogene Ernährung, die sich ebenfalls auf die Sehleistung auswirken können.
Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit über zwei Milliarden Menschen an einer Beeinträchtigung der Sehkraft – ein erheblicher Teil davon wäre vermeidbar oder behandelbar. Doch während Sehhilfen wie Brillen und Linsen gut verfügbar sind, bleibt die Frage: Wie können wir unsere Augen langfristig gesund halten – oder ihre Leistungsfähigkeit sogar wieder verbessern?
Sehtraining und Prävention: Mehr als nur Gymnastik für die Augen
Ein Ansatz, der in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, ist das Sehtraining. Dabei geht es um gezielte Übungen, die helfen sollen, bestimmte Sehfunktionen wie Fokussierung, Augenbeweglichkeit oder die Zusammenarbeit beider Augen zu verbessern.
Besonders bei Bildschirmarbeit oder funktionellen Sehproblemen – etwa durch Stress oder Verspannungen – kann Sehtraining helfen, Symptome wie Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen oder Konzentrationsprobleme zu lindern. Auch Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwächen oder Menschen mit latentem Schielen profitieren von dieser Methode.
Wichtig ist jedoch: Sehtraining ersetzt keine medizinische Diagnose. Es sollte gezielt eingesetzt und von qualifizierten Fachkräften begleitet werden. In vielen Fällen ist es als Ergänzung zu klassischen Sehhilfen oder therapeutischen Maßnahmen sinnvoll – aber kein Allheilmittel.
Technologische Innovationen: Sehverbesserung neu gedacht
Neben klassischen Methoden entstehen immer mehr digitale und technologische Lösungen, die den Weg zur besseren Sehleistung unterstützen sollen. Dazu zählen beispielsweise Apps für visuelle Übungen, smarte Brillensysteme oder individualisierte Screenfilter, die Augenbelastungen durch Blaulicht reduzieren.
Auch im medizinischen Bereich schreitet die Entwicklung rasant voran: Laserbehandlungen werden präziser, Linsenchirurgie bietet neue Optionen, und KI-basierte Diagnosetools ermöglichen frühzeitige Erkennung von Netzhautveränderungen. In der Kombination aus klassischer Optometrie, moderner Diagnostik und digitalen Anwendungen liegt ein großes Potenzial.
Digitale Plattformen begleiten diesen Wandel, indem sie umfassende Informationen, Beratungsangebote und moderne Ansätze rund ums Sehen bündeln. Dabei steht nicht nur die Korrektur, sondern die ganzheitliche Betrachtung der Sehgesundheit im Vordergrund.
Sehgewohnheiten im Alltag – und wie sie sich ändern lassen
Wer seine Augen langfristig entlasten möchte, sollte sich auch mit den eigenen Gewohnheiten auseinandersetzen. Viele Sehprobleme entstehen nicht über Nacht, sondern entwickeln sich schleichend – durch monotone Blickrichtungen, schlechte Lichtverhältnisse oder fehlende Bewegung im Sehalltag.
Ein paar einfache, aber wirkungsvolle Maßnahmen im Alltag können helfen:
- 20-20-20-Regel: Alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf etwas in 20 Fuß (ca. 6 Meter) Entfernung schauen – zur Entlastung der Augenmuskulatur.
- Natürliches Licht nutzen: Wann immer möglich, Tageslicht bevorzugen und direkte Blendung vermeiden.
- Regelmäßige Pausen einbauen: Bildschirmarbeit unterbrechen, in die Ferne blicken, die Augen schließen.
- Ergonomische Bildschirmhöhe: Der Monitor sollte leicht unter Augenhöhe positioniert sein.
- Ausreichend blinzeln: Um die Augenoberfläche feucht und geschützt zu halten.
Diese kleinen Veränderungen lassen sich oft leicht umsetzen – sie fördern nicht nur das Sehen, sondern auch die allgemeine Konzentration und das Wohlbefinden.
Zukunftsperspektiven: Wie wir morgen sehen werden
Die Augenmedizin und Sehforschung befinden sich im Umbruch. Neue Therapieformen, bessere Vorsorgestrukturen und interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Augenärzten, Optometristen und digitalen Gesundheitsanbietern eröffnen neue Chancen für Millionen Menschen weltweit.
Gleichzeitig wächst das Bewusstsein dafür, dass gutes Sehen nicht nur eine Frage der richtigen Brille ist – sondern eine ganzheitliche Aufgabe, die Körper, Geist und Technologie einbezieht. Wer frühzeitig Maßnahmen ergreift, achtsam mit den eigenen Sehgewohnheiten umgeht und sich bei Bedarf professionelle Unterstützung holt, kann oft mehr erreichen, als er denkt.
Sehgesundheit braucht Aufmerksamkeit, Wissen und passende Lösungen
„Wieder besser sehen können“ – das ist heute keine reine Vision mehr, sondern in vielen Fällen realistisch erreichbar. Die Kombination aus moderner Diagnostik, individueller Beratung und smarter Technologie schafft neue Möglichkeiten für alle, die ihre Sehkraft erhalten oder verbessern möchten.
Ob durch Prävention, Sehtraining, medizinische Behandlung oder bewusstere Nutzung digitaler Tools: Wer seine Gesundheit ernst nimmt, schafft sich eine bessere Lebensqualität – und bleibt in einer zunehmend visuellen Welt auf Augenhöhe.
Kein Wagnis ohne Risiko
Gefahren, mit denen Startups rechnen müssen, und wie man sie bestmöglich minimiert.

Ein eigenes Unternehmen zu gründen, ist natürlich immer und grundsätzlich ein Risiko. Der Erfolg ist keineswegs garantiert, davon zeugen auch die vielen gescheiterten Gründer*innen. Doch nicht alle Gefahren in der Startup-Welt drohen allein dem Betrieb – viele betreffen auch die Köpfe hinter den jungen Unternehmen. Deshalb gilt es, in alle Richtungen die Fühler auszustrecken, um mögliche Gefahrenherde rechtzeitig zu erkennen und wenigstens zu minimieren.
ALLE RISIKEN IM BLICK
Es ist naheliegend, sich als Gründer*in zuallererst Gedanken um das Wohlergehen der Firma zu machen. Immerhin bildet sie die Lebensgrundlage, nicht nur für einen selbst, sondern genauso für Partner und Mitarbeiter. Dabei sollte aber keinesfalls übersehen werden, dass auch die Gründer*innen selbst persönliche Risiken zu tragen haben.
Betriebliche Risiken
Ohne Frage ist nachvollziehbar, dass eine Firma gerade in ihren Kindertagen die volle Aufmerksamkeit braucht. Bevor sie konsolidiert ist, erscheinen selbst übliche Risiken umso größer – schlichtweg, weil die Folgen schwerwiegender sind. Dabei ist es erst einmal unerheblich, ob die Gefahren schon im Vorfeld abzusehen waren oder ob sie ohne jede Vorwarnung zugeschlagen haben.
Versicherungen helfen zwar, den finanziellen Schaden abzufangen, der etwa durch einen Einbruch, einen Brand oder auch Haftungsansprüche von Geschäftspartnern entstehen kann. Dennoch bleiben die empfindlichen Störungen des laufenden Betriebs, die ein frühes Aus für ein junges Unternehmen bedeuten können.
Schwebedialog statt Bubble-Denken
Wir leben in einer Welt voller abgeschotteter Blasen – seien sie politischer, ideologischer, kultureller oder technologischer Natur. Die Folge: Wir werten Andersdenkende ab und scheuen den Kontakt. Das Kommunikationsformat Schwebedialog bietet gezielt Auswege.

In einer Welt, in der die unterschiedlichen Wirklichkeiten immer weiter auseinanderdriften, bleibt vor allem eines auf der Strecke: Vertrauen und das Gefühl der Verbundenheit. Wenn alle Bemühungen, uns zu einigen, gescheitert sind, wir vor einer unüberwindbaren Mauer der Entfremdung stehen, tun wir in der Regel das, was uns zur Erhaltung unseres Wohlbefindens am naheliegendsten erscheint: Wir werten Andersdenkende ab und gehen aus dem Kontakt. Bei dem Kommunikationsformat Schwebedialog tun wir weder das eine noch das andere.
Beginnen wir gleich direkt mit ganz konkreten Beispielen: Was ist deine Haltung zur Abtreibung? Bist du für "My body, my choice" oder "Pro-Life"? Ist es wichtiger, dass jede Frau über ihren Körper selbst bestimmen kann oder sollte das Recht auf Leben - als Fundament aller Menschenrechte - absolut geschützt werden? Wer hat Recht?
Wenn du die Gesetze zu diesem Thema gestalten könntest, wie würden sie aussehen? Und wie positionierst du dich bei anderen Themen wie Sterbehilfe, LGBTQIA+, Gendern, Energiepolitik, künstliche Intelligenz, Religionsfreiheit oder Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken wie Telegram, X, Truth Social oder BlueSky? Woher stammen deine Informationen und welche Quellen erachtest du als verlässlich?
Unsere Bubbles, der Verlust an Vielfalt
Deine Perspektiven auf die Welt sind untrennbar mit dem verknüpft, was du täglich konsumierst – sei es durch Gespräche, Medien, soziale Netzwerke, Podcasts, Literatur oder Kunst. Viele von uns kehren dabei immer wieder zu denselben Quellen zurück, die unsere Sichtweisen stärken. Eine Frage: Wie oft suchst du gezielt nach Informationen, die deinem Weltbild widersprechen? Deine Bubble, dein geschützter Raum von Gleichgesinnten, beeinflusst dein Denken enorm.
Doch seit der Einführung des Internets haben räumliche Distanzen an Einfluss verloren und damit auch ein natürliches Regulativ. Du kannst dich nun ungebremst jederzeit und überall mit Millionen von Gleichgesinnten auf der ganzen Welt vernetzen. Dabei ist es unvermeidbar, dass sich deine Positionen und Wertehaltungen dort wie in einer Echokammer gegenseitig verstärken.
Die Folge: Betrachtet man das Phänomen aus der Vogelperspektive, wird deutlich, dass wir in einer Welt voller abgeschotteter Blasen leben – seien sie politischer, ideologischer, kultureller oder technologischer Natur.
Die Welt außerhalb der eigenen Blase
Was nur schwer zu ertragen ist: Die Welt außerhalb deiner Bubble ist aktiv und lebendig - schlimmer noch, fremde Bubbles sind genauso dynamisch und vernetzt wie deine eigenen! Nachrichten aus diesen fernen Gedankenwelten können dich fassungslos oder wütend machen. Solche Emotionen verbreiten sich schnell per Social Media und heizen die Polarisierung an. Wie reagierst du auf Meldungen, die aus deiner Sicht unfassbar sind?
Wenn wir nicht nachvollziehen können, wie andere so anders denken können, unterstellen wir gerne Manipulierbarkeit oder Dummheit. Und so wirft jede Seite der anderen vor, sich von Fake News manipulieren zu lassen, und keiner hört dem anderen zu. Wenn beide Seiten dasselbe über die jeweils andere denken, wer hat dann recht? Ein unlösbares Dilemma.
Isolation und ihre Folgen
Ohne den Kontakt zu Menschen mit anderen Ansichten zu pflegen, verlieren wir die Fähigkeit, Empathie zu entwickeln und unterschiedliche Perspektiven zu verstehen. Isolation in einer Bubble kann uns gegenüber den »anderen« gleichgültig oder sogar feindselig machen. Die Bereitschaft zu verbaler oder physischer Gewalt steigt auf allen Seiten.
Im Extremfall kann das Verharren in verschlossenen Gemeinschaften oder Echokammern zu Radikalisierung führen. Algorithmen helfen dabei, Menschen in ihrer Bubble zu halten, emotional aufgeladene Informationen weiter zu verbreiten und Hass zu schüren. Diese Dynamik fördert eine "Wir-gegen-die"-Mentalität und senkt die Toleranz für Gewalt als Mittel.
Kontakt wiederherstellen
In dieser verfahrenen Situation könnte ehrlicher Kontakt eine Möglichkeit sein, wieder Brücken zu bauen. Ohne der Absicht, die anderen zu bekehren, den vermeintlich »fehlgeleiteten« Menschen die eigenen Ansichten aufzuzwingen, sondern um uns ganz bewusst auf Menschen einzulassen, die anders denken, leben, handeln und fühlen als wir. Der Schlüssel wäre ein offener Austausch, bei dem wir uns gegenseitig wirklich zuhören, ohne zu bewerten, zu belehren oder zu moralisieren. Doch wie kann ein solcher Kontakt hergestellt werden?
Schwebedialoge: Ein Format für echten Kontakt
Ein vielversprechender Ansatz ist das Format des Schwebedialogs. Hier stehen nicht Lösungssuche, Überzeugung oder Einigung im Vordergrund, sondern das offene Aussprechen der eigenen Sicht auf die Dinge, während die anderen kommentarlos zuhören.
#1 Gedanken und Bedürfnisse ausdrücken: Im Schwebedialog wird ein Raum geschaffen, in dem alle Gedanken und Gefühle ihren Platz haben. Das gibt dir die Freiheit, deine Perspektiven und Bedürfnisse offen und ohne Druck zu äußern, während dir aufmerksam zugehört wird. Umgekehrt siehst und hörst du auch die Lebensrealitäten aller anderen.
#2 Nicht sofort reagieren: In einem Schwebedialog geht es weder um konkrete Lösungen noch um Einigung. Hier darf alles genau so sein, wie es ist. Lass die Worte des Gegenübers einfach auf dich wirken, ohne sie zu bewerten oder zu kommentieren.
#3 Plötzlich ist Kontakt da! Durch die offene und respektvolle Kommunikation im Schwebedialog entsteht wie von selbst eine tiefere Verbindung. Ohne den Zwang, Probleme zu lösen oder widersprüchliche Bedürfnisse unter einen Hut bringen zu müssen, begegnen sich die Menschen auf einer authentischen Ebene und bauen so Vertrauen zueinander auf. Das schafft echten Kontakt und hilft, Stereotype zu überwinden und Gewaltbereitschaft zu reduzieren.
Offenheit als Notwendigkeit
Es ist wichtig zu verstehen, dass jede Bubble dem Zweck dient, die Welt im Sinne unserer Bedürfnisse zu beeinflussen. Sie sorgt für Orientierung, Halt und eine verlässliche Bestätigung unserer Identität. Beim Verteidigen von dem, was wir als wichtig erachten, geht es nicht einfach nur um Meinungen, sondern um unser geistiges und physisches Überleben.
Es wird unumgänglich sein, dass wir beginnen, Andersdenkenden wirklich zuzuhören - ohne sie abzuwerten, ohne zu interpretieren und ohne sofort auf Abwehr zu schalten. Jeder Lösungsansatz wird scheitern, wenn dieser erste Schritt fehlt.
Kontakt allein mag zwar nicht alle gesellschaftlichen Herausforderungen wie Polarisierung oder Extremismus lösen, aber er ist eine elementare Komponente. Ohne den ehrlichen Versuch, einander zuzuhören, bleiben alle Lösungen oberflächlich und unvollständig. Zuhören ohne sofort zu urteilen ermöglicht echte Begegnungen und kann die Eskalation von Spannungen verhindern.
Lasst uns mutig sein, einander zuzuhören – befreit von dem inneren Druck, immer eine Antwort oder eine Lösung bieten zu müssen.
Nur mit dieser Offenheit kann echte Verständigung wachsen, und nur so können langfristige Verbindungen zwischen unseren unterschiedlichen Bubbles zustande kommen.
Zu Beginn haben wir einige Fragen in den Raum gestellt, die Gesellschaften spalten können:
- Wo erlebst du persönlich im Moment die tiefsten Gräben zwischen dir und anderen Menschen?
- Was beunruhigt dich am meisten?
- Wovor hast du die größte Angst?
- Und was macht dich einfach nur ratlos oder wütend?
Was auch immer es konkret ist, eines ist sicher: Es gibt keine allgemeingültigen Lösungen für solche Probleme. Tritt für deine Meinungen ein, egal welche sie sind, mit voller Leidenschaft und Hingabe! Und vielleicht, wenn du deine eigene Haltung auch ein wenig in der Schwebe lässt, wirst du – unabhängig von deinen Überzeugungen – auch die Bedürfnisse derer verstehen können, die ganz anders denken, leben und fühlen als du. Das Ergebnis? Ein tieferes Verständnis dafür, was andere Menschen wirklich bewegt und damit die Chance, kleine, aber feine Brücken zu bauen in einer vielfach getrennten Welt.
Tipp zum Weiterlesen: Britta Albegger und Geza Horvat, Schwebedialoge, Kommunizieren jenseits von Konsens und Lösung, 1. Auflage BusinessVillage 2024 ISBN: 978-3-86980-759-1, 26,95 Euro; ISBN-EPUB: 9783-8-6980-761-4, 25,95 Euro
Nächtliche Verspätungen: Was steht Ihnen zu?
Was Fluggäste bei nächtlichen Flugverspätungen beachten sollten und wie Sie Ihre Ansprüche im Falle des Falles rechtlich geltend machen.

Nächtliche Verspätungen sind für Fluggäste nicht nur ärgerlich, sondern oft auch mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden. Lange Wartezeiten, verpasste Anschlussflüge und die Herausforderung, nachts alternative Transport- oder Unterkunftsmöglichkeiten zu finden, machen solche Situationen besonders belastend. Doch wussten Sie, dass Sie in vielen Fällen Anspruch auf Entschädigung haben? Die Rechtsplattform flugrecht.de unterstützt Fluggäste dabei, ihre Rechte effizient durchzusetzen. In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie bei nächtlichen Flugverspätungen beachten sollten und wie Sie Ihre Ansprüche geltend machen.
Warum sind nächtliche Verspätungen besonders problematisch?
Verspätungen, die in die Nachtstunden fallen, haben oft größere Auswirkungen als solche tagsüber. Flughäfen und Verkehrsknotenpunkte sind nachts weniger frequentiert, was dazu führt, dass die Infrastruktur, wie öffentliche Verkehrsmittel, stark eingeschränkt ist. Hotels in Flughafennähe sind oft ausgebucht, und die Suche nach alternativen Unterkünften kann schwierig und zeitaufwändig sein. Hinzu kommt, dass viele Menschen nachts ihre Ruhezeit benötigen, um am nächsten Tag leistungsfähig zu sein – eine durch Verspätungen gestörte Nacht kann erhebliche persönliche und berufliche Folgen haben.
Die europäische Fluggastrechteverordnung EU Nr. 261/2004 bietet jedoch umfassenden Schutz, auch bei nächtlichen Flugverspätungen. Wer die eigenen Rechte kennt, kann besser reagieren und Ansprüche erfolgreich durchsetzen.
Ihre Rechte bei nächtlichen Verspätungen
Ab welchem Zeitpunkt wird eine Verspätung entschädigt?
Grundsätzlich hängt Ihr Entschädigungsanspruch von der Dauer der Verspätung und der zurückgelegten Flugstrecke ab:
- Dauer: Eine Verspätung von mindestens drei Stunden am Zielort ist Voraussetzung.
- Strecke: Die Entschädigung richtet sich nach der Flugdistanz:
- Bis 1.500 km: 250 €
- 1.500–3.500 km: 400 €
- Über 3.500 km: 600 €
Dabei spielt es keine Rolle, ob der Flug am Tag oder in der Nacht stattfindet. Entscheidend ist, wann das Flugzeug am Zielort ankommt. Wichtig: Bei außergewöhnlichen Umständen, wie extremem Wetter oder politischen Unruhen, können Airlines von ihrer Entschädigungspflicht entbunden sein.
Betreuungspflichten der Airline
Zusätzlich zur finanziellen Entschädigung haben Fluggesellschaften eine Betreuungspflicht. Diese umfasst insbesondere:
- Verpflegung: Kostenlose Mahlzeiten und Getränke während der Wartezeit.
- Kommunikationsmöglichkeiten: Zwei kostenlose Telefonate, E-Mails oder Faxe.
- Unterkunft und Transport: Sollte der Flug erst am nächsten Tag starten, muss die Airline eine Unterkunft und den Transfer dorthin organisieren.
Wichtige Voraussetzungen für Ihre Ansprüche
Um Ihre Rechte geltend zu machen, ist es wichtig, Beweise zu sichern:
- Bordkarten und Buchungsbestätigungen sollten sorgfältig aufbewahrt werden.
- Zeitstempel und Flugdetails, wie die tatsächliche Ankunftszeit, sind entscheidend.
- Dokumentieren Sie, wie die Airline auf die Situation reagiert hat. Falls Ihnen keine Betreuung angeboten wurde, bewahren Sie Quittungen für entstandene Kosten auf.
Häufige Fragen zu nächtlichen Verspätungen
Wie gehe ich vor, wenn mein Flug nachts verspätet ist?
- Sprechen Sie die Airline direkt an und erkundigen Sie sich nach Betreuung und Alternativen.
- Dokumentieren Sie alle relevanten Details.
- Prüfen Sie Entschädigungsansprüche mithilfe von Flugrecht.de.
Was passiert, wenn die Airline keinen Ersatzflug anbietet?
Falls die Airline keine adäquaten Alternativen stellt, können Sie sich selbst um Ersatzflüge oder Unterkünfte kümmern. Wichtig ist, die entstandenen Kosten zu dokumentieren und Quittungen aufzubewahren. Diese können Sie später als Teil Ihrer Ansprüche geltend machen.
Wie lange habe ich Zeit, meine Ansprüche geltend zu machen?
Die Verjährungsfrist für Fluggastrechte beträgt in Deutschland drei Jahre ab dem Ende des Jahres, in dem die Verspätung aufgetreten ist. Es ist jedoch ratsam, so früh wie möglich aktiv zu werden, um Verzögerungen zu vermeiden.
Charismatische Mitarbeitende: vier unliebsame Wahrheiten
Sich für charismatische Bewerber*innen zu entscheiden oder „beliebte“ Mitarbeitende zu befördern, mag logisch erscheinen, aber ist das stets auch die richtige Wahl?

Nur wenige von uns können der magnetischen Anziehungskraft von Charisma widerstehen. Charismatische Mitarbeitende werden oft als wertvolle Ergänzung für jedes Büro betrachtet, da sie einnehmend sind und einen starken Eindruck hinterlassen. Allerdings gibt es einige Kehrseiten von Charisma und dessen Auswirkungen, die Führungskräfte, HR-Mitarbeitende und alle in Büroumgebungen kennen sollten. Die Expert*innen von Hogan Assessments – einem globalen Anbieter im Bereich Persönlichkeitsbeurteilung am Arbeitsplatz und Führungsberatung – haben folgende vier unliebsame Wahrheiten im Zusammenhang mit Charisma herausgestellt.
1. Nachteil: Ein schneller Weg zum Burnout
Charisma kann zum Impression-Management, das heißt zur Selbstdarstellung, sowohl bei Vorstellungsgesprächen als auch am Arbeitsplatz genutzt werden. Impression-Management ist ein bewusster oder unterbewusster Prozess, bei dem Menschen versuchen, die Wahrnehmung anderer bezüglich ihrer Person zu beeinflussen. Mitarbeitende, die sich mehr darauf konzentrieren, eine starke und sympathische Rolle zu verkörpern, verbringen mehr Zeit damit als mit ihren Verantwortlichkeiten. Dies kann Produktivität und Leistung erheblich beeinträchtigen und einen großen Nachteil für die Belegschaft mit abträglichen Konsequenzen darstellen.
Das Streben nach sozialer Akzeptanz am Arbeitsplatz hatte schon immer eine eher unscharfe Grenze, und dies hat sich in einem stark von sozialen Medien beeinflussten Umfeld noch verstärkt. Ohne einen klaren Indikator können charismatische Mitarbeitende sich daher leicht einem höheren Risiko von Überanstrengung aussetzen und am Ende in ihrer Rolle schwächer werden.
„Dieses Szenario ist oft auf ein geringeres Selbstbewusstsein in Bezug auf die eigenen Fähigkeiten oder das Vermögen zur Ausführung der zugewiesenen Arbeit zurückzuführen. Daher haben solche Mitarbeitende das Gefühl, dass sie ihren Platz in einem Team rechtfertigen müssen, und vertrauen dabei möglicherweise zu sehr auf die sympathischen oder charismatischen Eigenschaften, für die sie vielleicht belohnt werden könnten“, erläutert Dr. Ryne Sherman, Chief Science Officer bei Hogan Assessments und Co-Host beim Science of Personality Podcast.
2. Nachteil: Scheitern bei betrieblichen Abläufen
Charisma zu haben ist kein Synonym für gutes Urteilsvermögen oder die moralischen Qualitäten, die nötig sind, um die Herausforderungen einer Rolle erfolgreich zu meistern. Charismatische Mitarbeitende können überzeugend sein, aber das ist bedeutungslos, wenn sie nichts Nennenswertes zu sagen haben. Ebenso können Bewerberinnen und Bewerber Recruiting- und Personalfachkräfte mit ihrem Charisma in den Bann ziehen, dann jedoch in ihrer Rolle versagen, da sie möglicherweise nicht die Leistung auf dem erwarteten Niveau erbringen.
„Charismatische Führungskräfte haben oft Probleme zuzugeben, dass sie nicht alle Antworten parat haben – eine Stärke, die jedoch jeder haben muss, der eine leitende Position in einem komplexen Unternehmen innehat. Daher sind solche Mitarbeitende in geringerem Maß bereit, Rat einzuholen und zu befolgen, was für jedes Unternehmen nachteilig sein kann, da kritisches Feedback oder Erkenntnisse ihres Teams leicht abgetan werden“, so Dr. Ryne Sherman.
3. Nachteil: Ungleichheiten am Arbeitsplatz und Unmut im Team
Beruflicher Erfolg ist von erheblichen Diskrepanzen gekennzeichnet. Nicht alle beginnen ihre Karriere mit den gleichen Voraussetzungen, und nicht alle Wege führen zum selben Ziel. Während einige die Karriereleiter emporsteigen und beträchtlichen Wohlstand erreichen, sehen sich andere mit der harten Realität konfrontiert, in Rollen festzustecken, in denen sie kaum das Existenzminimum verdienen. So gesehen kann die Persönlichkeit den Karriereerfolg erheblich beeinflussen, da charismatische Mitarbeitende oft als „bessere Führungskräfte“ betrachtet werden, obwohl es ihnen in Wirklichkeit vielleicht an Qualifikationen fehlt. Darüber hinaus kann es leicht zu Unmut führen, wenn charismatische Teammitglieder bei Beförderungen über Arbeitsmoral oder Leistung gestellt werden, da sich andere Mitarbeitende bei solchen Entscheidungen dann geringgeschätzt oder übergangen fühlen können.
„Charismatische Mitarbeitende mit ausgeprägten zwischenmenschlichen Fähigkeiten können zwar eine große Bereicherung sein. Jedoch müssen auch deren andere Fähigkeiten berücksichtigt werden, die nötig sind, um die Arbeit nach dem vom Unternehmen geforderten Standard auszuführen“, empfiehlt Dr. Ryne Sherman.
4. Nachteil: Sie versprechen viel und halten wenig
Im Bemühen, vor allem bei ihren Vorgesetzten Akzeptanz zu erlangen, neigen charismatische Personen dazu, unrealistische Ziele und Erwartungen zu setzen. Dies ist eine natürliche Tendenz bei Menschen, die in ihrem Unternehmen kurzfristig gut dastehen wollen, ohne sich mit den langfristigen Konsequenzen zu beschäftigen. Hin und wieder laufen die Dinge wie geplant, und sie sind die ersten, die sich dafür loben. Es ist jedoch viel wahrscheinlicher, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden, und diese Personen geben dann schnell den anderen die Schuld, ohne die Verantwortung für ihre eigenen Misserfolge zu übernehmen.
„Ob absichtlich oder nicht, charismatische Menschen können nicht anders, als mehr zu versprechen, als sie realistisch abliefern können. Das Problem ist, dass es sich um gewiefte Personen handelt, die sich immer wieder ihrer Verantwortung entziehen. Dieses Verhalten ist auf lange Sicht vielleicht nicht tragbar, aber Charismatiker*innen erkennen dies für gewöhnlich und setzen ihren Charme ein, um einen anderen Job zu finden, wo sie den Zyklus als unbeschriebenes Blatt von vorne beginnen können“, erklärt Dr. Ryne Sherman abschließend.




