Aktuelle Events
Metaverse für Start-ups: Die Chancen einer neuen Welt
Die Idee eines gemeinsamen virtuellen Raums wird auch für Start-ups immer interessanter. Metaverse gehört zu den aktuellen Trends, die allgemein in der Öffentlichkeit stark diskutiert und genutzt werden. Der virtuelle Raum bietet so viele verschiedene Möglichkeiten für kleine und neue Unternehmen, um immer populärer und bekannter zu werden.
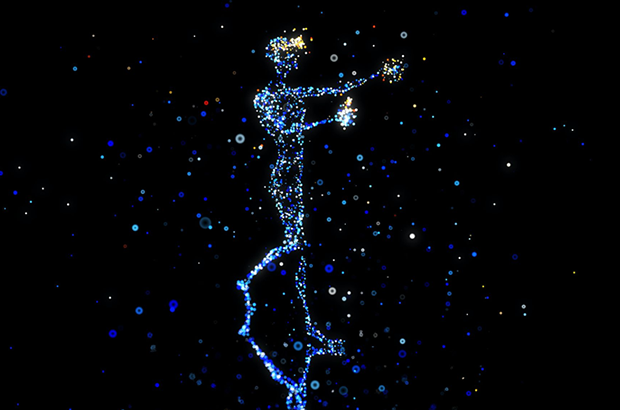
Der virtuelle Raum wird also nicht nur genutzt, um die Spielautomaten mit der besten Volatilität zu entdecken und viele verschiedene weitere Spiele zu spielen. Stattdessen ist es auch für die Arbeitsumgebungen immer spannender. Zu erwarten ist, dass das Metaverse einen starken Einfluss auf die Zukunft des Internets hat und diese in gewissen Maßen prägt.
Home-Office-Zeit hat Bewegung in die Sache gebracht
Allgemein ist die Zeit für ein größeres virtuelles Geschehen in allen Bereichen reif. Auch durch viele Home-Office-Aktivitäten aufgrund der aktuellen Situation wurden die Leute auf virtueller Ebene immer aktiver. Unter anderem fanden Konferenzen virtuell statt. Ebenfalls musste ein Weg gefunden werden, um mit den Kunden weiterhin kommunizieren zu können.
Durch die neuesten Technologien und das schnelle Internet ist es heutzutage kein Problem mehr, die verschiedenen Aktivitäten auf dem virtuellen Weg abzuhalten. Das bringt viele Vorteile für alle Beteiligten mit sich. Man spart sich viele Wege und kann flexibel vom Büro aus mit der Arbeit und den Kundenkontakten durchstarten.
Vielfältige Anwendungsgebiete für Start-ups
Zukünftig wird es möglicherweise so sein, dass noch viele weitere Technologiekonzerne sich mit dem Thema Metaverse beschäftigen und entsprechende Angebote offerieren. Immerhin bringt der virtuelle Raum Potenzial mit sich. Gerade Financial Services und Technologie- Start-ups werden im virtuellen Raum eine immer wichtigere Rolle spielen.
Die Start-ups können ihre Produkte, Dienstleistungen und Lösungen ganz bequem und komfortabel über den virtuellen Markt bekannt machen und sich noch besser positionieren. Langfristig gesehen kann sich das auf jeden Fall positiv auswirken und mehr Erfolg bringen. Man kann schon sagen, dass die nächste Phase der digitalen Revolution begonnen hat.
Ebenfalls denkbar ist es, dass sich diverse Spiel- und Service-Plattformen im Metaverse etablieren und immer weiterentwickeln. Diejenigen Start-ups, die ihren Fokus auf diesen Bereich legen, können von einem großen Potenzial profitieren. Möglich ist aber auch ein Aufstieg im Bereich der VR für Start-ups, was jedoch zugleich auch etwas schwieriger werden könnte, da es schon viele große Anbieter in diesem Bereich gibt.
Metaverse als Ergebnis von Facebooks Namensänderung
Facebook hat den Namen auf Meta geändert, weswegen es nicht lange auf sich warten lassen hat, dass der Begriff Metaverse seine Runde machte. Viele Unternehmen aus den 3D-Welten, Virtual Reality und Spiele haben dann auch direkt die Chance genutzt und sich auf der nächsten Plattform breitgemacht.
Immerhin geht es letztendlich auch darum, wer das Metaverse anführen wird. Die verschiedenen Hardware- und Softwarehersteller möchten sich natürlich die Chance nicht entgehen lassen, und am besten groß rauskommen. Im Prinzip kann letztendlich jedes große Unternehmen sowie auch kleinere Start-ups zu der Gestaltung und Entwicklung des Metaverse beitragen.
Schon viele Start-ups vertreten
Es sind mittlerweile schon einige Start-ups im Metaverse vertreten. Sie haben direkt die Chance genutzt, um sich zu positionieren. Zu erwähnen sind unter anderem Unternehmen wie Wikitude, TriLite und NXRT. Wikitude bietet beispielsweise eine Plattform an, mit der es möglich ist, einfach AR-Erlebnisse zu bauen. Mit einer digitalen AR Brille können die Entwickler direkt auch testen, wie die geschaffenen Werke funktionieren.
Bei TriLite handelt es sich um ein Start-up aus Wien. Das Unternehmen ist bekannt für kleine, leichte und helle Laser-Beam-Scanner auf der Welt. Diese Scanner können in AR-Brillen integriert werden. Falls die Entwicklung bei einem Hersteller für AR-Brillen untergebracht werden kann, könnte die Trixel Technologie schon bald ein ganz wichtiger Bestandteil des Metaverse werden.
Das Unternehmen NXRT hat sich auf industrielle Anwendungen spezialisiert. Möglich ist es beispielsweise, Fahrzeugcockpits kostengünstig nachzubauen und zu erstellen. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, einen vorhandenen 3D-Raum für Mitarbeiterschulungen zu verwenden.
Auch Shopping im Metaversum möglich
Ebenfalls könnte Metaversum für den Online-Handel in der Zukunft spannend werden. Bisher war es nur so, dass von Luxusmarken virtuelle Mode im schicken Design offeriert wurde. Doch das könnte möglicherweise bald schon anders werden. Sicherlich werden auch einige weitere Mode-Konzerne auf den Zug aufspringen.
Unter anderem hat beispielsweise H&M schon erwähnt, dass sie einen virtuellen Laden im Metaversum eröffnen wollen. 3D-Welten lassen sich dank der modernen Technik komfortabel umsetzen. Durch leistungsfähige Hardware und entsprechende Grafikkarten lässt sich ein entsprechender virtueller 3D-Shop eröffnen.
Metaverse mit guter Prognose
Da das Metaverse so viel Potenzial mit sich bringt, wird es sicherlich auch in Zukunft immer wichtiger für die Unternehmen, auf den Zug aufzuspringen. Gibt es schon einmal die Chance, bei solch einem großen Ding mitzumachen, sollten es auch Start-ups nutzen, um erfolgreicher und bekannter zu werden.
Wie es scheint, stellen auch immer mehr Firmen ihre Metaverse-Pläne vor. So scheint es wirklich, als wäre dies der Markt der Zukunft. Laut Marktforschungsunternehmen könnte er bis 2028 ein enormes Umsatzniveau mit sich bringen. Es wird sogar ein milliardenschweres jährliches Marktpotenzial erwähnt. Das könnte sogar das doppelte des deutschen Bruttoinlandsproduktes von 2020 betragen.
Deswegen ist es auch nicht wunderlich, dass es viele Start-ups und Unternehmen gibt, die an der Entwicklung und Umsetzung des Metaverse beteiligt sein wollen. Allerdings kann man davon ausgehen, dass die breite Nutzbarkeit noch einige Jahre dauern wird. Aber dennoch steigen die Firmen jetzt schon ein, um das mögliche Potenzial nutzen zu können.
Viele Jobs dank Metaverse möglich
Soll die virtuelle Welt neu ausgerichtet werden, kann es in Europa zahlreiche Jobs mit sich bringen. Das ist natürlich auch ein nennenswerter Punkt, der erwähnenswert ist. Es ist sogar von über 10.000 neuen Jobs von Facebook die Rede. Von daher kann sich Metaverse für alle Beteiligten richtig lohnen. Start-ups und große Unternehmen können immer stärker werden. Zudem können immer mehr Leute eine Anstellung in angesehenen Unternehmen finden.
Wie es letztendlich wird, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Auf jeden Fall bleibt es spannend, wenn es um das Thema Metaverse geht. Aber es steht jedenfalls schon fest, dass es viel Potenzial gibt. Nutzen jetzt Start-ups die Chance und steigen in Metaverse ein, können sie möglicherweise langfristig von einem hohen Gewinnpotenzial profitieren.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
KI-Modelle erfolgreich im Unternehmen einführen
Worauf es bei der Implementierung von KI wirklich ankommt.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sie kann Prozesse beschleunigen, große Datenmengen sinnvoll nutzbar machen und Entscheidungen unterstützen. Doch in der Praxis zeigt sich: Moderne Technologie allein führt noch nicht zum Erfolg. Entscheidend ist ein strukturiertes Vorgehen, bei dem Ziele klar definiert, Daten sorgfältig vorbereitet und organisatorische Rahmenbedingungen von Beginn an berücksichtigt werden. „Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass am Anfang die Orientierung fehlt“, sagt Benedikt Weber, Geschäftsführer der applord GmbH. „Struktur schafft Entscheidungsfähigkeit – noch bevor über konkrete KI-Modelle gesprochen wird.“
Organisatorischer Wandel und Einbindung der Mitarbeitenden
Der Einsatz von KI verändert Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Mitarbeitende arbeiten verstärkt mit automatisierten Systemen zusammen, Aufgaben verschieben sich, Rollen entwickeln sich weiter. Wird dieser Wandel nicht aktiv begleitet, entstehen Unsicherheiten oder Ablehnung gegenüber neuen Technologien. Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb auf transparente Kommunikation und frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden. Sie erklären, warum KI eingesetzt wird, welche Aufgaben sie übernimmt und wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt. Fehlt dieses gemeinsame Verständnis, werden neue Systeme häufig nur eingeschränkt genutzt. „KI-Projekte scheitern selten an der Technologie“, betont Weber. „Viel häufiger fehlt ein klares Bild davon, welchen konkreten Nutzen KI für Mitarbeitende und Organisation wirklich bringt.“
Auswahl der passenden KI-Lösung
Das Angebot an KI-Lösungen wächst rasant. Für Unternehmen besteht die Herausforderung darin, nicht der technischen Vielfalt zu folgen, sondern eine Lösung zu wählen, die zum eigenen Geschäftsprozess passt. Der Ausgangspunkt sollte immer ein klar definierter Anwendungsfall sein: Welche Aufgabe soll KI konkret unterstützen oder verbessern? Neben den Funktionen spielen auch Fragen der Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Systeme und regulatorische Anforderungen eine Rolle. Werden diese Aspekte zu spät berücksichtigt, entstehen Lösungen, die technisch leistungsfähig sind, im Alltag aber keinen Mehrwert liefern. „Viele Unternehmen wählen KI nach dem Funktionsumfang aus und stellen später fest, dass sie nicht zum eigenen Prozess passt“, erklärt Weber. „Erfolgreich ist KI dann, wenn sie Abläufe sinnvoll ergänzt und verständliche Ergebnisse liefert.“
Datenqualität als Grundlage für verlässliche Ergebnisse
KI-Modelle sind vollständig von der Qualität ihrer Daten abhängig. In vielen Unternehmen existieren relevante Informationen zwar, sie sind jedoch über verschiedene Systeme verteilt, unterschiedlich gepflegt oder historisch gewachsen. Diese Ausgangslage erschwert nicht nur den Einsatz von KI, sondern kann zu fehlerhaften oder schwer nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Datenmanagement ist daher keine einmalige Vorarbeit, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, regelmäßige Prüfungen und eine strukturierte Aufbereitung der Daten. „Der Aufwand für Datenqualität wird häufig unterschätzt“, sagt Weber. „Ohne geprüfte und konsistente Daten lassen sich keine stabilen und verlässlichen KI-Ergebnisse erzielen – unabhängig davon, wie gut das Modell ist.“
Schrittweise Einführung statt großer Umbruch
Statt KI sofort unternehmensweit einzusetzen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Unternehmen können so mit klar abgegrenzten Anwendungsfällen beginnen, Lösungen im Alltag testen und die Ergebnisse anhand messbarer Kriterien, wie Benutzerfreundlichkeit oder verständlicher Anleitungen, bewerten. So lassen sich Risiken reduzieren und Erkenntnisse gezielt nutzen. Pilotprojekte liefern nicht nur technische Erkenntnisse, sondern zeigen auch, wie gut KI im Arbeitsalltag akzeptiert wird. Auf dieser Basis lässt sich entscheiden, welche Lösungen ausgebaut werden sollten. „Unternehmen, die mit überschaubaren Anwendungsfällen starten, treffen langfristig fundiertere Entscheidungen“, so Weber. „Praxiserfahrungen sind dabei deutlich wertvoller als theoretische Annahmen.“
19 Start-up-Geschenkideen für Xmas
Die Teilnehmer*innen des Hessischen Gründerpreises haben pfiffige, nutzwertige und stylische Produkte im Angebot, die bestens unter den Weihnachtsbaum passen.

Socken oder ein Buch? Gutschein oder Bargeld? Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit auch stressig, denn sie müssen Geschenke für ihre Liebsten finden – und nicht immer nur für die. Für ein wenig Inspiration präsentieren wir geschenktaugliche Produkte und Dienstleistungen von jungen Unternehmen. Sie alle haben sich 2025 beim Hessischen Gründerpreis beworben, manche von ihnen sind ins Halbfinale gekommen, wurden als Preisträger*innen oder Sieger*innen ausgezeichnet.
19 Start-up-Inspirationen für Weihnachten
Häkelsets für Anfänger mit Video-Anleitungen hat Willy Wolle entworfen. Perfekt für gemütliche Nachmittage auf dem Sofa www.willywolle.com
Kurse rund um den Obstbaumschnitt und Erlebnisse auf der Streuobstwiese ermöglicht www.obstbaumglück.de
Musikgarten, Babymassage und Yoga für Kinder, liebevolle Kurse bietet www.mainglueckskind.de
An Weihnachten kommt gerne mal ein festlicher Hirsch- oder Rehbraten auf den Tisch. Das Fleisch dafür gibt es bei www.wildvonotto.de
Monatliche, von Montessori inspirierte Themenboxen mit liebevoll gestalteten Lern- und Bastelaktivitäten für Kinder von 3 bis 6 Jahren www.foxbox.kids
Ätherische Öle, Raumdüfte und Basisöle in Bio-Qualität liefert www.advanced-essentials.com
Sprechende Wanduhr erinnert Kinder automatisch per Sprachausgabe an Aufgaben und Termine und fördert Selbstständigkeit auf spielerische Weise www.routime.de
Tassen und andere 3D-gedruckte Keramik in herausragendem Design von www.additivum.de
Innovative Mundziehöle, basierend auf Phyto-Science und ayurvedischer Medizin, stellt www.maemaecare.com her
Professionelle Haarkosmetik mit hoher Hautverträglichkeit, produziert in Deutschland, von www.rndetail.com
www.schmunzelgeist.de ist eine Schokoladenmanufaktur, die außer leckeren Pralinen und Schokoladen auch Workshops und Tastings im Programm hat
Bio-Tees, ayurvedische Tees und Gewürze sowie Workshops und Tastings gibt es bei www.oktopus-tee.de
Weihnachten und der Winter sind die klassische Backsaison. Bio-Backmischungen ohne Industriezucker gibt es bei www.hasenzaehnchen.de
Komplette Nähprojekte in einer Box – das ideale Geschenk für kreative Köpfe von www.ankes-naehbox.de
Tagesplaner, Notizblöcke, Schreibtischunterlagen, Wochenplaner für Schüler, Studentinnen, und alle, die im Büro arbeiten: www.lemonplan.de
Maßgeschneiderte BHs, bei denen nichts mehr zwickt, zu erschwinglichen Preisen gibt es bei www.cupped.de
Brettspiel oder per App zocken? Off- und online verbindet www.playnconnect.de
Neon ist das neue Schwarz – auch bei Hundebekleidung www.lumiies.com
Handgefertigte Netztaschen & Lifestyle-Produkte gibt es bei www.netzeallerart.shop
Pflanzentheke: Vertical-Farming-Start-up erhält DBU-Förderung
Das 2022 gegründete Start-up Pflanzentheke ermöglicht vertikales Gemüsewachstum in nährstoffreichem Wasser statt in Erde und wird dafür mit 175.000 Euro durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.

Der Großteil des in Deutschland konsumierten Obsts und Gemüses wird importiert. Laut Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat (BMLEH) liegt die Selbstversorgungsrate – also der Anteil der im Land produzierten im Vergleich zu den insgesamt verbrauchten Gütern – für Gemüse bei 36 Prozent, für Obst lediglich bei 20 Prozent. Besonders große Städte sind auf die Versorgung durch Lebensmittellieferungen über weite Distanzen angewiesen. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde: „Nahrungsmittelanbau nah an urbanen Zentren mit hohem Bedarf spart teure und klimaschädliche Transportwege. Das geht jedoch nur mit einer effizienten Nutzung der knappen Flächen.“
Genau dieses Ziel verfolgt das 2022 von Dr. Michael Müller, Dr. Julia Dubowy, Lasse Olliges und Leon Welker gegründete Start-up Pflanzentheke aus dem hessischen Lorsch mit sogenannten Vertical-Farming-Systemen für den geschützten Anbau – also dem vertikalen Anbau von Lebensmitteln in geschlossenen Anlagen wie Gewächshäusern oder Folientunneln. Pflanzentheke-Mitgründer Leon Welker: „Das Gemüse wächst in A-förmigen Regalen in einem sogenannten hydroponischen System – Pflanzen gedeihen also in nährstoffhaltigem Wasser anstatt in Erde auf im Schnitt sieben Stufen pro Anlage.“ Nun nimmt das Unternehmen mit der DBU-Förderung in Höhe von 175.000 Euro die Automatisierung des Systems ins Visier – für einen effizienteren Einsatz von Zeit, Ressourcen und Energie.
Automatisiertes und datenbasiertes Pflanzenwachstum
Nach den Worten von Welker erfolgte die Bestückung mit Jungpflanzen der vertikalen Anlagen sowie die Ernte bislang manuell. Nun arbeitet das Start-up an einer vollständigen Automatisierung des Produktionsprozesses – bei minimalem Energieverbrauch und niedrigen Betriebskosten. „Wir setzen auf praxisnahe Automatisierungsschritte, die konkret dort ansetzen, wo kleine und mittlere Betriebe heute an ihre Grenzen stoßen: bei Ernte, Wiederbepflanzung und Systempflege“, so Welker. Das Ziel sei, die tägliche Arbeit „deutlich zu erleichtern – mit einem modularen System, das ressourcenschonend arbeitet, Wasser spart und Arbeitszeit reduziert“. Welker: „Damit machen wir effiziente Hydroponik auch für kleinere Betriebe wirtschaftlich zugänglich.“
Dazu werde das vorhandene A-förmige Anbaumodell in Bewegung versetzt und an eine intelligente Steuerung angeschlossen. „Mit Sensoren zur Überwachung werden die Pflanzenreihen mit den passenden Nährstoffen für die jeweilige Wachstumsphase versorgt – vollständig datenbasiert“, so der Mitgründer. Jede Reihe beherberge ein Gemüse in einem anderen Wachstumsstadium. Welker: „Durch die bewegliche Anlage optimieren wir auch den Zugang zum Sonnenlicht je nach Reifegrad.“ Schließlich könne eine Reihe geerntet und wiederbestückt werden, während die anderen Pflanzen durch die Umpositionierung ungestört wachsen.
Anlage soll Böden schonen sowie Wasser- und Düngerverbrauch reduzieren
Die von dem Start-up entwickelte Anlage ermöglicht Welker zufolge, Böden zu schonen, den Wasser- und Düngerverbrauch zu reduzieren und auf kleinen Flächen möglichst viele Lebensmittel anzubauen. „Das System kommt bei gleichem Ertrag mit rund 90 Prozent weniger Wasser und 85 Prozent weniger Dünger aus als die konventionelle Landwirtschaft,“ so der Pflanzentheke-Mitgründer. „Wir verbinden die Vorteile des Indoor-Vertical-Farmings – etwa bei Nährstoffnutzung und Wassereffizienz – mit einem entscheidenden Plus: Unsere Anlagen nutzen natürliches Sonnenlicht und kommen daher mit einem Bruchteil der Energiekosten aus“, sagt Welker. „Das macht den ressourcenschonenden Anbau wirtschaftlich tragfähig – auch ohne energieintensive Beleuchtungssysteme.“ Welker weiter: „Weite Transporte erzeugen hohe Mengen klimaschädlicher Treibhausgase. Der Anbau nah an Städten mithilfe solcher Vertical-Farming-Systeme reduziert die Lieferwege sowie die je nach Lebensmittel energieintensiven Kühlketten.“
DBU-Förderung ermöglicht klima- und umweltschonenden Lebensmittelanbau
Das Start-up war bereits bis Ende 2024 Teil der Green Startup-Förderung der DBU. Dadurch wurde nach Welkers Worten die Marktreife des Produkts erfolgreich erreicht. Die Entwicklung der Anlage sei zudem mit fachlicher Unterstützung durch die Hochschule Osnabrück erfolgt. „Die Automatisierung ist nun ein neues, zeitintensives Forschungsprojekt – eine Entwicklung, die wir im laufenden Betrieb nicht leisten könnten“, so Welker. Die erneute Förderung ermögliche mehr klima- und umweltschonenden Lebensmittelanbau mithilfe der automatisierten Pflanzentheke-Anlagen. Zielgruppen sind dem Unternehmen zufolge vor allem kleine und mittelgroße Betriebe. „Die Pflanzentheken sind schnell installierbar, da sie an bestehender Infrastruktur befestigt werden können“, so Welker. Neben den ökologischen Vorteilen des Systems solle die Automatisierung auch den steigenden Fachkräftemangel im Gartenbau in Teilen kompensieren.
Gründen mit dem Smartphone: 5 innovative Businessideen für Mobile-First
Innovative Businessideen rund ums Smartphone. Entdecke E-Commerce, Nischen-Apps und mobile Dienste als lukrative Geschäftsmodelle.

Das Smartphone hat unsere Welt in den letzten zwei Jahrzehnten grundlegend verändert. Was einst ein reines Kommunikationsmittel war, ist heute unsere digitale Schaltzentrale, das wichtigste Werkzeug für Konsum, Organisation und – vor allem – für das Unternehmertum.
Mehr als fünf Milliarden Menschen besitzen weltweit ein mobiles Endgerät. Diese beispiellose Marktdurchdringung hat eine „Mobile-First-Ära“ geschaffen, in der fast jeder Prozess und jede Dienstleistung über das kleine Display abgewickelt wird. Für Gründer bietet diese Allgegenwart des Smartphones ein enormes Potenzial.
Die besten Geschäftsideen entstehen dort, wo Technologie auf einen echten Bedarf trifft. Ob es darum geht, ein bestehendes Problem effizienter zu lösen oder eine völlig neue Nische zu erschließen – das Smartphone ist die zentrale Plattform dafür.
Dieser Artikel beleuchtet innovative Businessideen, die direkt aus der mobilen Revolution entstanden sind. Von cleveren Hardware-Ergänzungen über spezialisierte Apps bis hin zu neuen Dienstleistungen: Das Smartphone ist das Sprungbrett für Ihren nächsten erfolgreichen Start-up.
Produkte und Personalisierung im mobilen Umfeld
Obwohl das Smartphone selbst ein hochkomplexes Stück Technologie ist, bietet auch das unmittelbare Umfeld des Geräts zahlreiche lukrative Möglichkeiten für Gründer. Diese sogenannten Hardware-nahen Ideen drehen sich oft um Zubehör oder physische Dienste, die das mobile Nutzererlebnis verbessern.
Eine der erfolgreichsten Nischen der letzten Jahre ist die Personalisierung. Da fast jeder Mensch ein Smartphone besitzt, suchen Nutzer nach Wegen, ihr Gerät einzigartig zu machen. Ein klassisches, aber immer noch wachsendes Geschäftsfeld ist dabei, die Handyhülle selber zu gestalten. E-Commerce-Plattformen, die einen einfachen Online-Konfigurator anbieten, ermöglichen es Kunden, ihre Hüllen mit eigenen Fotos, Designs oder individuellen Texten zu versehen. Dieses Geschäftsmodell basiert auf geringen Stückkosten, einem einfachen Produktionsprozess (meist Druck) und dem starken Wunsch nach Individualität.
Neben der reinen Ästhetik gibt es weitere zukunftsorientierte Produktideen:
- Smarte Ergänzungen: Denken Sie an spezielles, kompaktes Zubehör für mobile Content-Creation (z.B. Mini-LED-Ringe, spezialisierte Mikrofone).
- Nachhaltigkeit und Schutz: Hochwertige, langlebige oder biologisch abbaubare Schutzfolien und Hüllen sprechen eine wachsende, umweltbewusste Zielgruppe an.
- Mobile-Payment-Lösungen: Innovative, physische Halterungen oder Adapter, die das Smartphone noch besser in den Alltag (wie Bezahlvorgänge oder Fahrzeugnutzung) integrieren.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt hier darin, ein Massenprodukt – das Smartphone – durch ein Nischenprodukt zu ergänzen, das entweder ein Problem löst oder einen emotionalen Mehrwert wie Einzigartigkeit bietet.
Digitale Dienste und Nischen-Apps
Die wahre Kraft des Smartphones liegt in seiner Software. Hier warten unzählige Möglichkeiten für Gründer, die bereit sind, mit einer App oder einem spezifischen digitalen Dienst eine Marktlücke zu füllen. Anstatt generische Anwendungen zu entwickeln, liegt der Fokus heute auf Nischen-Apps, die sehr spezifische Probleme einer klar definierten Zielgruppe lösen.
Ein vielversprechendes Feld sind Micro-Learning-Anwendungen. Nutzer können kurze, gamifizierte Lerneinheiten für hochspezialisierte Fähigkeiten (etwa Excel-Makros, Weinverkostung oder spezifische Programmiersprachen) direkt in der Hosentasche abrufen. Dieses Modell funktioniert hervorragend über ein Abo-System und nutzt die wenigen Minuten Wartezeit, die jeder im Alltag hat.
Weitere zukunftsweisende Businessideen sind:
- AR-gestützte Shopping-Helfer: Apps, die Augmented Reality nutzen, um dem Kunden zu zeigen, wie ein Möbelstück im eigenen Wohnzimmer aussieht oder wie eine neue Wandfarbe wirkt. Der Vorteil liegt in der direkten Kaufentscheidung.
- Lokale Service-Vermittler: Digitale Plattformen, die Kleinstaufträge im lokalen Umfeld vermitteln (z.B. Nachbarschaftshilfe, Hunde-Sitting oder kurzfristige Handwerksleistungen). Der mobile Aspekt ist hier die einfache, standortbasierte Koordination.
- Gesundheit und Wellness: Spezialisierte Anwendungen, die mithilfe der Smartphone-Sensoren Daten sammeln, analysieren und personalisierte Empfehlungen für Schlaf, Stressreduktion oder Ernährung liefern.
Der Schlüssel zum Erfolg in diesem Segment ist der Fokus auf ein sauberes, intuitives Design (UX/UI) und ein skalierbares Geschäftsmodell, das oft auf Abonnements oder In-App-Käufen basiert. Die Hürde ist hier oft geringer, da keine physischen Lagerbestände nötig sind.
Mobile Content-Kreation und Monetarisierung
Das moderne Smartphone ist nicht nur ein Konsumgerät, sondern auch ein hochentwickeltes Produktionswerkzeug. Die verbesserten Kamera- und Schnittfunktionen haben das Gerät zum primären Werkzeug für professionelle Content-Kreation gemacht. Dies eröffnet neue Geschäftsfelder für Gründer, die Dienstleistungen oder Nischeninhalte anbieten.
Ein zukunftsträchtiges Feld ist die spezialisierte mobile Videoproduktion. Anstatt teure Kamerateams zu buchen, können Unternehmen mobile Content-Creator beauftragen. Diese liefern hochwertiges Material schnell und flexibel, indem sie effiziente Workflows direkt über das Smartphone nutzen, um dynamische Videos für soziale Medien oder Marketingkampagnen zu erstellen.
Weitere lukrative Dienstleistungsmodelle, die auf dem Smartphone aufbauen:
- Mobile Fotografie für E-Commerce: Spezialisten erstellen und bearbeiten Produktfotos direkt mit dem Smartphone. Dies bietet kleinen Online-Shops einen schnellen und kostengünstigen Service.
- Nischen-Content: Mit hochwertigen mobilen Mikrofonen können Gründer spezialisierte Audioinhalte (wie Branchen-Insider-Podcasts) direkt über das Gerät erstellen und monetarisieren.
Das Smartphone senkt die Eintrittsbarriere für Gründer in der Medien- und Kreativbranche erheblich. Erfolg hat hier, wer sich auf eine Nische spezialisiert und die Flexibilität des mobilen Workflows als Wettbewerbsvorteil nutzt.
Schlussworte
Das Smartphone hat sich unwiderruflich als zentrales Werkzeug der digitalen Wirtschaft etabliert. Es ist nicht nur ein Kanal für den Konsum, sondern vor allem eine Plattform für innovative Geschäftsmodelle. Von der individualisierten Hardware wie der Möglichkeit zur Handyhülle selber gestalten bis hin zu hochspezialisierten Nischen-Apps – die Wachstumschancen sind enorm.
Für angehende Gründer gilt: Die besten Ideen nutzen die Stärken des mobilen Geräts – nämlich die ständige Verfügbarkeit, die eingebauten Sensoren und die einfache Bedienung.
Der Erfolg liegt nicht in der Entwicklung der nächsten "Super-App", sondern darin, ein spezifisches Problem einer klar definierten Zielgruppe effizient und mobil zu lösen. Wer die Mobile-First-Mentalität verinnerlicht, hat die Geschäftszentrale der Zukunft bereits in der Hosentasche.
Happy Homeoffice Club gestartet
Gründerin Caterina Hirt startet ein digitales Netzwerk als kollaborative Kommunikationsplattform für selbständige Mütter im Homeoffice.

Mit dem Start des Happy Homeoffice Clubs entsteht ein neues digitales Angebot für selbständige Mütter – mit Liveformaten, Co-Working, einer innovativen Softwareplattform und vielen nützlichen Business-Hacks. Die Gründerin Caterina Hirt bringt damit ein strukturiertes, unterstützendes Netzwerk an den Start, das den oft isolierten Homeoffice-Alltag in einen Ort der Verbindung, Motivation und echten Weiterentwicklung verwandelt. „Ich habe selbst erlebt, wie herausfordernd es ist, Beruf, Familie und Selbstverwirklichung unter einen Hut zu bringen – vor allem im Homeoffice. Mit dem Happy Homeoffice Club möchte ich Frauen zeigen, dass sie nicht alleine sind“, so die Gründerin. Caterina Hirt ist Unternehmerin, Autorin, systemische Coachin und Mutter von zwei Kindern. Mit ihrem Agenturbackground und über zehn Jahren Erfahrung im Homeoffice weiß die Marketingspezialistin aus erster Hand, welche Chancen – aber auch welche Herausforderungen – dieser Arbeitsalltag birgt.
Kern der Zusammenarbeit ist eine kollaborative Kommunikationsplattform, über die die Mütter dauerhaft in einem echten Netzwerk verbunden sind. Dazu setzt das Angebot auf Livecalls, Community-Austausch, Expertenvorträge und snackable Businesstipps, die den Workflow im Homeoffice effizienter machen. Das Angebot richtet sich explizit an selbständige Frauen oder Mütter im Homeoffice. „Bei uns fühlt sich keine Teilnehmerin mehr allein. Hier treffen sich Frauen, die genau wissen, wie es ist, mit Laptop, Kaffee, Kind und manchmal ein bisschen Chaos zu jonglieren. Sie arbeiten, lachen, tauschen sich aus und motivieren sich gegenseitig. So modern, vernetzt und unterstützend, wie man es sich als Selbstständige immer gewünscht hat “, sagt Caterina Hirt.
Die zugrundeliegende Softwarelösung bietet eine hochmoderne Nutzeroberfläche, Chats, Calls in einer geschützten Umgebung sowie Daten- und Wissensaustausch an. So gibt es zum Beispiel den Monday Motivation Call mit allen Teilnehmerinnen oder eine interaktive Kaffeeküche, in der man sich einfach mal über alle Themen abseits des Business interaktiv austauschen kann. Die Plattform wird jeder Teilnehmerin zur Verfügung gestellt, die Nutzung ist in der monatlichen Mitgliedsgebühr von 49 Euro (Einführungspreis) enthalten. Interessentinnen können die Community inklusive aller Angebote zwei Wochen kostenlos testen.
Vorsicht vor diesen KI-Versuchungen
Allzu großes Vertrauen in GenAI ist fahrlässig, dennoch prüfen nur rund ein Viertel der Menschen in Deutschland die Ergebnisse, die KI für sie generiert, auf Korrektheit. Das sind die größten Gefahren und effektivsten Gegenmaßnahmen.

Die Leistung und die Zuverlässigkeit von KI-Assistenten nehmen gefühlt weiter zu. Doch wer in den letzten Wochen intensives Prompting bei ChatGPT, Perplexity und Co. betrieben und die Ergebnisse eingehend analysiert hat, fühlte sich in diesem Gefühl nicht bestätigt. Im Gegenteil: Die Qualität der generierten Antworten lässt neuerdings öfter zu wünschen übrig. Auf YouTube gibt es zahlreiche Videos zu diesem Phänomen, das sich offenbar auch die Herstellenden nicht so ganz erklären können, aber auch klassische Medien berichten darüber. In Anbetracht der Tatsache, wie abhängig sich viele Menschen im Berufsleben schon heute von GenAI-Tools gemacht haben, ist dieser Trend erschreckend und ernüchternd. Ein blindes Vertrauen in die digitalen Helfer aus der Familie generativer KI birgt zudem großes Schadenspotenzial, etwa dann, wenn sich Ärzt*innen bei der Diagnose auf sie stützen oder Entwickler*innen von der KI vorgeschlagene Frameworks ohne Sicherheitscheck implementieren.
Völliges Vertrauen in GenAI ist also, zurückhaltend formuliert, mindestens gewagt. Die Situation ist ernst und erfordert von GenAI-Anbietenden ein Mindestmaß an Qualitätssicherung – offenbar kein einfaches Unterfangen. Bis dahin ist es wichtig, eigene Maßnahmen zu ergreifen, um nicht in die Falle der folgenden vier Qualitätskiller zu geraten.
1. Halluzinationen
KI-Assistenten wie ChatGPT und Co. wurde die Aufgabe erteilt, Antworten zu liefern – koste es, was es wolle. Wenn die Wissensbibliothek nicht ausreicht, um komplexe Sachverhalte zu beantworten, fängt generative KI an, sich etwas auszudenken. Die von solchen Halluzinationen ausgehende Gefahr ist bekannt. Umso bedrückender ist die Tatsache, dass laut einer aktuellen Studie nur rund ein Viertel (27 %) der Menschen in Deutschland die Ergebnisse, die KI für sie generiert, auf Korrektheit prüfen. Das sind zwar immerhin sieben Prozentpunkte mehr als bei gewöhnlichen Inhalten aus dem Internet, wie eine Studie des PR-COM Research Lab belegt, aber noch immer viel zu wenige.
Gegenmaßnahmen: Wer GenAI nutzt, sollte ausnahmslos alle von ihr produzierten Inhalte überprüfen. Dazu sollten User*innen insbesondere die von der KI verwendeten Primärquellen checken oder – wenn möglich – Expert*innen zur Prüfung der Korrektheit der Antworten zurate ziehen.
2. Bias
Die Anbieter*innen aktueller KI-Assistenten haben sehr viel Arbeit in ihre Produkte gesteckt, um den Bias, also die Voreingenommenheit ihrer Modelle auszumerzen und sie zur Vorurteilsfreiheit zu erziehen.
Verlassen sollten sich User*innen auf die moralische und ethische Unantastbarkeit ihrer Modelle dennoch nicht. Zwar ist es unwahrscheinlich, dass Produkte großer Hersteller*innen noch rassistische, sexistische oder sonstige ethisch fragwürdige Ansichten vertreten, aber komplett ausgeschlossen ist es eben nicht. Noch relativ hoch ist die Gefahr zudem bei der Nutzung von kostenlosen GenAI-Assistenten oder Nischen-Tools.
Gegenmaßnahmen: Auch im Zusammenhang mit Bias gilt es, die Ergebnisse einer KI-Befragung immer genauestens zu checken und mit geltenden Gesetzen und den vorherrschenden Wertevorstellungen unserer Gesellschaft abzugleichen. Wer dubiose KI-Tools meidet, kann sich zudem viel Ärger ersparen.
3. Content-Kannibalisierung
Immer mehr KI-generierter Content flutet das Internet – die logische Folge der zunehmenden Nutzung von GenAI-Assistenten. Leider trainieren KI-Entwickler*innen ihre Chatbots und deren zugrunde liegende Sprachmodelle unter anderem mit genau diesen Inhalten. Und schlimmer noch: Der exponentiell steigende KI-Inhalt ist darüber hinaus auch der Wissensschatz, auf den die KI für ihre Antworten zurückgreift. Dadurch entsteht ein Teufelskreis aus KI, die sich irgendwann nur noch mit von ihr selbst generierten Inhalten trainiert und auch nur noch von ihr produzierten Content als Basiswissen verwendet. Der Mensch wird aus dieser Gleichung immer weiter herausgekürzt. Die Qualität der Ergebnisse von Anfragen an die KI wird somit zunehmend abnehmen. Hinzu kommt, dass alle User*innen irgendwann die gleichen Ergebnisse abrufen, nutzen und veröffentlichen.
Gegenmaßnahmen: Es ergibt Sinn, hin und wieder auch ohne KI zu agieren und Content zu produzieren, der frei von KI-generierten Inhalten ist und das Qualitätsmerkmal „Made in a human brain“ trägt.
4. Wissensoligopol
Der KI-Markt ist derzeit auf einige wenige Big Player geschrumpft, die sich die enormen Rechenressourcen und Entwicklungskosten für generative KI leisten können. Dadurch entsteht zunehmend ein Wissensoligopol, in dem die großen Anbieter*innen wie OpenAI, Google, Microsoft und DeepSeek zukünftig die Art und Weise bestimmen, welche Informationen überhaupt noch zugänglich sind. Schon jetzt gehen Suchanfragen auf den traditionellen Suchmaschinen deutlich zurück, die Ergebnisse zwar nach Algorithmen ranken, aber selten Treffer komplett ausblenden. Viel restriktiver agieren GenAI-Tools, deren implementierte Filter die freiheitliche Verbreitung von Wissen einzuschränken drohen: Was nicht mit den politischen und moralischen Ideen der Hersteller übereinstimmt, wird automatisch unterdrückt. Das erinnert ein wenig an das Wahrheitsministerium aus Orwells „1984“.
Gegenmaßnahmen: Es ist wichtig, dass Unternehmen und offizielle Stellen auch unabhängige Projekte fördern und deren Nutzer*innen- sowie Supporter*innen-Basis wächst. Gleichzeitig sollten User*innen es dringend verinnerlichen, dass KI- Assistenten nicht der Wahrheit letzter Schluss sind. Das Nutzen möglichst vieler Quellen, um das eigene Wissen aufzubauen, ist immer besser als ein vermeintlicher „Single Point of Truth“.
Fazit
Wir sind noch lange nicht so weit, dass ein blindes Vertrauen in generative KI zu rechtfertigen ist. Es ist zwar logisch, dass wir eine vermeintlich arbeitserleichternde Technologie erst einmal ungern hinterfragen – doch dieser Bequemlichkeit wohnt, je nach Einsatzzweck, ein erhebliches Schadenspotenzial inne. Zum jetzigen Zeitpunkt lautet also die Maxime, restlos jede von GenAI generierte Antwort genauestens auf den Prüfstand zu stellen.
Der Autor Alain Blaes ist CEO der Münchner Kommunikationsagentur PR-COM (mit Fokus auf High-tech- und IT-Industrie im B2B-Umfeld).
Code für die künstliche Intelligenz: technische Optimierung für die Ära der KI-Suche
Code für die KI: So optimierst du deine Website technisch mit strukturierten Daten und Protokollen für die besten generativen Suchergebnisse.

Die Regeln der Online-Sichtbarkeit werden neu geschrieben. Es geht nicht mehr nur darum, von einem herkömmlichen Algorithmus indiziert zu werden. Stattdessen müssen Websites so aufbereitet werden, dass sie von künstlicher Intelligenz (KI) und großen Sprachmodellen (LLMs) fehlerfrei interpretiert und verarbeitet werden können.
KI erstellt ihre Antworten, indem sie Inhalte blitzschnell liest, deren Bedeutung versteht und die wichtigsten Fakten daraus extrahiert. Wenn der technische Unterbau einer Website unsauber ist, kann die KI die Informationen entweder nicht zuverlässig finden oder sie falsch interpretieren.
Das bedeutet, die technische Seite der Website – der Code – wird zum Fundament für eine gute Platzierung in den generativen Suchergebnissen. Wer hier Nachholbedarf hat, riskiert, als vertrauenswürdige Quelle für die KI unsichtbar zu werden.
Dieser Artikel beleuchtet die entscheidenden technischen Anpassungen, die notwendig sind, um deine Website optimal für die neue Ära der KI-Suche vorzubereiten.
Kontrolle und Zugang: Die Regeln für Sprachmodelle
Der erste technische Schritt zur Optimierung für KI-Ergebnisse ist die Steuerung des Zugriffs durch die großen Sprachmodelle (LLMs). Traditionell wird der Zugang durch die robots.txt Datei geregelt, die festlegt, welche Bereiche der Website von herkömmlichen Suchmaschinen-Crawlern besucht werden dürfen.
Mit dem Aufkommen verschiedener, spezialisierter KI-Crawler (die nicht immer identisch mit dem Googlebot oder Bingbot sind) entsteht jedoch die Notwendigkeit, diesen neuen Akteuren eigene Regeln zu geben. Es geht darum, Transparenz darüber zu schaffen, welche Daten zur Generierung von Antworten verwendet werden dürfen und welche nicht.
Neue Protokolle für neue Crawler
Experten diskutieren und entwickeln neue Protokolle, um diese Unterscheidung zu ermöglichen. Ein viel diskutierter Ansatz ist die Einführung von Protokollen, die spezifisch den Umgang mit generativer KI regeln. Dies könnte die Einführung von Protokollen wie einer llms.txt Datei beinhalten. Solche spezifischen Dateien könnten festlegen, ob ein KI-Modell Inhalte zur Schulung oder zur generativen Beantwortung von Nutzeranfragen nutzen darf.
Diese Kontrollmechanismen sind entscheidend. Sie geben den Website-Betreibern die Autorität darüber zurück, wie ihre Inhalte in der KI-Ära verwendet werden. Wer hier klare Regeln setzt, schafft die technische Grundlage für eine kontrollierte und damit vertrauenswürdige Sichtbarkeit in den KI-Ergebnissen.
Strukturierte Daten als universelle KI-Sprache
Nach der Regelung des Zugangs durch Protokolle ist die Strukturierung der Inhalte der wichtigste technische Schritt. Suchmaschinen nutzen strukturierte Daten schon lange, um Rich Snippets in den klassischen Ergebnissen anzuzeigen. Für die KI sind diese Daten jedoch absolut essenziell.
Strukturierte Daten, die auf dem Vokabular von Schema.org basieren, sind im Grunde eine Übersetzungshilfe im Code, die dem Sprachmodell den Kontext des Inhalts direkt mitteilt. Sie sind die "Sprache", die die KI am schnellsten und präzisesten versteht.
Die Bedeutung für die Generierung
Wenn ein Nutzer eine Frage stellt, sucht die KI nicht nur nach Stichwörtern, sondern nach definierten Informationstypen. Mit strukturierten Daten liefert man der KI diese Informationen als fertige, fehlerfreie Bausteine.
- Fehlerfreie Extraktion: Die KI muss keine Textpassagen interpretieren, um beispielsweise ein Rezept, die Bewertung eines Produkts oder einen FAQ-Abschnitt zu identifizieren. Die korrekte Auszeichnung macht die Daten sofort nutzbar.
- Vertrauensbildung: Fehlerhafte oder inkonsistente strukturierte Daten führen zu einer falschen Interpretation und können bewirken, dass die KI deine Seite als unzuverlässig einstuft.
Die Implementierung muss fehlerfrei sein und sollte alle relevanten Inhaltstypen der Website abdecken. Nur eine saubere Schema-Implementierung garantiert, dass deine Fakten korrekt in die generativen Antworten der KI einfließen.
Ladezeit und Interaktivität als Vertrauenssignal
Die Geschwindigkeit und die Nutzbarkeit einer Website sind in der Ära der KI-Suche nicht mehr nur ein Komfortfaktor, sondern ein entscheidendes technisches Vertrauenssignal. Wenn deine Seite langsam lädt oder schlecht bedienbar ist, wird das von der KI als Indikator für mangelnde Qualität und niedrige Autorität gewertet.
Die Basis dafür sind die sogenannten Core Web Vitals (CWVs). Diese Messwerte, die sich auf das Nutzererlebnis konzentrieren, sind feste Ranking-Faktoren und haben direkten Einfluss darauf, ob eine KI deine Seite als zitierwürdig einstuft:
- LCP (Largest Contentful Paint): Misst die Zeit, bis der größte sichtbare Inhalt geladen ist.
- FID/INP (First Input Delay / Interaction to Next Paint): Misst die Zeit bis zur ersten Interaktion und die allgemeine Reaktionsfähigkeit der Seite.
- CLS (Cumulative Layout Shift): Misst die visuelle Stabilität.
Mobile Performance ist der Schlüssel
Da ein Großteil der Online-Aktivität über mobile Geräte stattfindet, legt die KI höchsten Wert auf die Optimierung der Mobilversion. Eine schlechte mobile Performance kann das gesamte Ranking negativ beeinflussen.
Die technische Anpassung muss daher darauf abzielen, die CWVs zu perfektionieren. Dies beinhaltet die Optimierung von Bildern, das Bereinigen unnötiger Code-Lasten und das Priorisieren wichtiger Ressourcen. Eine schnell ladende und reaktionsfreudige Website signalisiert nicht nur dem Nutzer, sondern auch der KI, dass die Quelle professionell und damit vertrauenswürdig ist.
Redundanz vermeiden: kanonische Klarheit
Eines der größten technischen Probleme für KI-Modelle ist die Verwirrung durch doppelte Inhalte (Duplikate). Wenn die gleiche Information unter verschiedenen URLs verfügbar ist, weiß die KI nicht, welche die Originalquelle darstellt. Dies zersplittert deine Autorität.
Der technische Schlüssel zur Lösung ist der Canonical Tag (<link rel="canonical" ...>). Dieser Tag im Code muss auf jeder Seite korrekt auf die bevorzugte, indexierbare URL zeigen. Durch die Vermeidung von Duplikaten und die korrekte Nutzung dieses Tags stellst du technisch sicher, dass die KI deine Inhalte als eindeutig und autoritär wahrnimmt und dich als zuverlässigen Faktenlieferanten zitiert.
Schlussworte
Die Zukunft der Online-Sichtbarkeit wird durch künstliche Intelligenz neu definiert. Der Erfolg hängt von einer technisch sauberen Vorbereitung ab.
Die wichtigsten Schritte in der Generative Engine Optimization (GEO) sind:
1. Zugangskontrolle durch Protokolle wie die diskutierte llms.txt Datei.
2. Die Nutzung von strukturierten Daten als unverzichtbare KI-Sprache.
3. Die Perfektionierung der Core Web Vitals als Vertrauenssignal.
4. Die Vermeidung von Duplikaten durch kanonische Klarheit.
Investiere in diese technische Qualität, um Autorität und Sichtbarkeit in der Ära der KI-generierten Antworten zu sichern.
Coupon-Marketing – exklusive Einblicke von Golden-Shopping-Days
Im Interview geben die Golden-Shopping-Days-Gründer Jannik Westbomke und Wladimir Ruf Einblicke in die Entstehungsgeschichte ihres Unternehmens und die Herausforderungen, die mit dem Aufbau einer eigenen Marke im Coupon-Segment verbunden sind.

Rabattaktionen gibt es viele, doch nur wenige Kampagnen schaffen es, sich im dicht gedrängten Markt so klar zu positionieren wie die Golden-Shopping-Days. Was 2020 als Frühjahrsaktion startete, hat sich längst zu einem festen Termin im Kalender zahlreicher Onlineshops und Konsument*innen entwickelt. Hinter der Plattform stehen die Geschäftsführer Jannik und Wladie, die nicht nur eine Gutscheinseite betreiben, sondern eine Art kuratiertes Event geschaffen haben, das zweimal im Jahr zehntägig läuft. Dabei geht es nicht um wahllose Codes, die irgendwo zusammengetragen werden, sondern um exklusive Kooperationen mit inzwischen über 50 Partner*innen – darunter bekannte Marken aus Mode, Food, Gesundheit oder Wohnen.
Neben diesen großen Kampagnen bildet die Plattform inzwischen auch ganzjährig ein starkes Fundament: In der neu geschaffenen Deals-Kategorie finden sich dauerhaft ausgewählte Angebote, und zusätzlich stehen Gutscheine von über 100 Onlineshops bereit. Partner*innen wie Weinfürst, DeinDesign oder HAWESKO verdeutlichen die Vielfalt und den Anspruch, Shoppingvorteile nicht nur saisonal, sondern kontinuierlich zugänglich zu machen.
Das Besondere: Die Rabatte sind zeitlich gebündelt, bewusst inszeniert und für die teilnehmenden Shops ein kalkulierbares Marketinginstrument. Gleichzeitig profitieren die Kund*innen von teils beachtlichen Nachlässen, ohne sich registrieren zu müssen oder Umwege in Kauf zu nehmen. Auch außerhalb der großen Kampagnen finden sich auf der Plattform Gutscheine, doch das eigentliche Herzstück bilden die beiden Aktionszeiträume im Frühjahr und Herbst.
Für Gründer*innen ist Golden-Shopping-Days ein spannendes Beispiel dafür, wie sich ein etabliertes Geschäftsmodell – das Couponing – neu denken lässt. Anstatt in der Masse unterzugehen, setzen die Macher auf Exklusivität, Übersichtlichkeit und klare Kommunikation mit den beteiligten Shops.
Im Interview geben Jannik und Wladie Einblicke in die Entstehungsgeschichte, die Mechanismen hinter den Aktionen und die Herausforderungen, die mit dem Aufbau einer eigenen Marke im Coupon-Segment verbunden sind.
Das Interview
Golden-Shopping-Days gibt es seit 2020. Wie kam es zu der Idee, ausgerechnet eine solche Event-Plattform für Gutscheine aufzubauen?
Jannik: Die Idee ist während des Studiums entstanden. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, mein Studium zu finanzieren. Auf klassische Werkstudenten-Tätigkeiten hatte ich aber keine Lust und so bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, ein Print-Gutscheinheft zu vermarkten. Das erste Heft war schon sehr aufwändig, da ich keinerlei Kontakte zu Onlineshops hatte und so unzählige Telefonate führen musste, um die ersten Shops von meiner Idee zu begeistern. Ein befreundeter Unternehmer hat die erste Auflage für mich gedruckt und auch die Gestaltung des TItelblattes übernommen.
Zwei Kampagnen im Jahr, Frühling und Herbst – warum genau dieses Modell und nicht eine kontinuierliche Rabattflut wie man sie bei anderen Anbietern sieht?
Jannik: Wir haben uns bewusst dazu entschieden im Frühjahr- und Herbst jeweils eine 10-tägige Online-Shoppingkampagne zu veranstalten. Zum Einen ist dies in der Kommunikation für die Konsumenten deutlich einfacher und zum anderen können die teilnehmenden Onlineshops diese fest in ihrem Marktetingmix einplanen und teilweise auch etwas höhere Rabatte gewähren, als es unterjährig sonst der Fall ist.
Welche Kriterien spielen bei der Auswahl der inzwischen über 50 Partnershops eine Rolle? Gibt es klare Vorgaben oder wächst das Netzwerk eher organisch?
Wladie: Wir sind in der Vergangenheit sehr organisch gewachsen und konnten von Kampagne zu Kampagne mehr Onlineshops von der Teilnahme an unserem Konzept begeistern. Klare Vorgaben haben wir nicht. Die teilnehmenden Onlineshops müssen allerdings schon eine gewisse Wertigkeit haben.
Auffällig ist, dass viele Deals exklusiv verhandelt wirken. Wie läuft dieser Prozess im Detail ab – geht es eher um klassische Affiliate-Strukturen oder um direkte Partnerschaften?
Jannik: Mit allen Shops, die an unseren Shoppingevents im Frühjahr und Herbst teilnehmen pflegen wir direkte Partnerschaften. Wir sind darauf bedacht für alle Shoppingbegeisterten die besten Gutscheine und Angebote zu verhandeln.
2025 steht die nächste große Herbstkampagne an und auch die nächste Frühjahrskampagne ist bereits in Planung. Wie bereitet ihr euch auf solche zehn Tage konkret vor, und was bedeutet das organisatorisch im Hintergrund?
Wladie: In der Regel brauchen wir gut ein halbes Jahr Vorbereitungszeit je Kampagne. Wir überlegen uns stets neue Features, um sowohl den Onlineshops als auch den Konsument*innen immer wieder neue Features zu bieten, die einen echten Mehrwert darstellen.
Manche Branchen – etwa Food, Mode oder Gesundheit – sind stark vertreten. Gibt es Bereiche, die ihr bewusst ausklammert, oder ist die Plattform prinzipiell offen für alle Segmente?
Jannik: Wir sind für viele Segmente offen, aber längst nicht für alle. Einen Onlineshop für Waffen wird man bei uns beispielsweise nicht finden.
Couponing ist für Shops ein Marketinginstrument, das nicht nur Umsatz bringen, sondern auch Markenbindung schaffen kann. Wie stellt ihr sicher, dass Golden-Shopping-Days nicht als reine Rabattschleuder wahrgenommen wird?
Wladie: Wir distanzieren uns ganz bewusst und schaffen an vielen Stellen Mehrwerte. Die Veröffentlichung von Gutscheinen stellt nur einen kleinen Teil unseres Geschäftsmodells dar. Mittlerweile fungieren wir vielmehr als Contentplattform. In unserem digitalen Magazin veröffentlichen wir regelmäßig Testberichte und Experteninterviews, auf YouTube publizieren wir Unboxing- und Testvideos - kurz gesagt: Wir schaffen echte Mehrwerte.
Ihr betont, dass Gutscheine bei euch auch außerhalb der Aktionszeiträume verfügbar sind. Wie wichtig ist diese ganzjährige Präsenz für die Markenbildung?
Jannik: Wir wollen unserer Community rund um die Uhr die besten Gutscheine und Angebote bieten. Deshalb ist es natürlich sehr wichtig, dass wir dies auch an 365 Tagen im Jahr gewährleisten können. Wir sind stets im Kontakt mit den Onlineshops, die sich und ihre Angebote bei uns auf der Plattform präsentieren, um die besten Gutscheine und Deals zu verhandeln. Viele Gutscheine sind nur exklusiv bei uns erhältlich.
Ein Blick nach vorn: Welche Rolle soll Golden-Shopping-Days in den nächsten fünf Jahren im deutschen E-Commerce spielen?
Jannik: Eine führende. **lacht**
Vielen Dank, Jannik und Wladie, für die offenen Einblicke in eure Arbeit und die Hintergründe der Golden-Shopping-Days.
Indirekter Einkauf: Versteckter Kostenfresser oder unentdeckter Goldschatz?
Im Interview sprechen wir mit Bettina Fischer, Gründerin von Hivebuy, über die Chancen und Risiken des indirekten Einkaufs und darüber, wie Unternehmen mit der richtigen Software Kosten senken und Prozesse optimieren können.

In vielen Unternehmen wird der indirekte Einkauf häufig unterschätzt – dabei liegen hier oft erhebliche Einsparpotenziale verborgen. Durch die wachsende Digitalisierung und die zunehmende Verfügbarkeit von B2B eCommerce-Plattformen bestellen Mitarbeitende Waren und Dienstleistungen immer häufiger außerhalb klassischer Einkaufsprozesse. Diese Entwicklung bringt einerseits Flexibilität und Effizienz, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen: Wie lassen sich Ausgaben kontrollieren und Transparenz über die gesamte Einkaufskette sicherstellen?
Die beste Einkaufssoftware für den Mittelstand adressiert genau diese Herausforderungen. Hivebuy hat sich als moderne, benutzerfreundliche Lösung etabliert, die den indirekten Einkaufsprozess von der Bestellung bis zur Rechnungsprüfung digitalisiert und automatisiert. Die Software integriert sich nahtlos in bestehende ERP-, Buchhaltungs- und Kommunikationstools wie SAP, Microsoft Dynamics, Teams oder Slack – und das ohne aufwändige technische Implementierung.
Gegründet von erfahrenen Einkaufs- und Finanzexpert*innen aus Frustration über bisherige Lösungen, verfolgt Hivebuy die Mission, versteckte Kosten sichtbar zu machen, Budgets in Echtzeit zu kontrollieren und Einkaufsprozesse effizienter zu gestalten. Mit höchsten Sicherheitsstandards, inklusive ISO/IEC 27001-Zertifizierung und DSGVO-konformer Datenhaltung in Deutschland, schafft Hivebuy Transparenz und Vertrauen entlang der gesamten Einkaufskette.
Im Interview sprechen wir mit Bettina Fischer, Gründerin von Hivebuy, über die Chancen und Risiken des indirekten Einkaufs und darüber, wie Unternehmen mit der richtigen Software Kosten senken und Prozesse optimieren können.
StartingUp: Frau Fischer, viele Unternehmen sehen im indirekten Einkauf eher einen Kostenfaktor, der schwer zu kontrollieren ist. Was macht den indirekten Einkauf aus Ihrer Sicht zu einem versteckten Kostenfresser?
Bettina Fischer: Die große Herausforderung im indirekten Einkauf liegt darin, dass die einkaufenden Personen über das gesamte Unternehmen verteilt sind – anders als im direkten Einkauf, wo spezialisierte Einkaufsabteilungen tätig sind. Das bedeutet: Jede*r Mitarbeitende, der oder die einmal etwas bestellt, wird zum Einkäufer oder zur Einkäuferin – oft ohne die notwendige Erfahrung in Einkaufsprozessen.
Dadurch entstehen typische Muster: Es wird bei bekannten Lieferanten bestellt – oft aus dem privaten Umfeld, wie etwa Amazon Business – ohne Preisvergleiche, ohne Berücksichtigung von Lieferzeiten oder bereits verhandelten Konditionen. Das führt schnell zu ineffizienten und teuren Entscheidungen.
Hinzu kommt, dass im indirekten Einkauf eine hohe Produktvielfalt auf eine extrem heterogene Lieferantenlandschaft trifft. Das erschwert es, durch Bündelung bessere Konditionen zu erzielen. Es fehlt die klare, strategische Beziehung zu bestimmten Lieferanten – und genau dort entstehen die versteckten Kosten.
StartingUp: Wie hilft Hivebuy Mittelständlern konkret dabei, diese versteckten Kosten aufzudecken und zu reduzieren?
Bettina Fischer: Hivebuy verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um die Herausforderungen des indirekten Einkaufs zu lösen. Zum einen ermöglichen wir es Mitarbeitenden, direkt über integrierte Lieferanten zu bestellen. Das bedeutet: Die Bestellungen erfolgen zentral über Hivebuy – ohne Umwege über externe Plattformen oder individuelle Beschaffungswege. Die Bestellübermittlung ist automatisiert und erfolgt effizient über unser System.
Darüber hinaus bietet Hivebuy einen integrierten Preisvergleich für B2B-Webshops. So wird sichergestellt, dass stets der beste Preis und die optimalen Lieferzeiten berücksichtigt werden – ein entscheidender Hebel zur Kostensenkung.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Budgetkontrolle: Sobald eine Bestellanforderung erstellt wird, sehen Budgetverantwortliche sofort die Auswirkungen auf ihr Budget – in Echtzeit. Dadurch lassen sich Entscheidungen schnell, fundiert und transparent treffen.
Auch die Freigabeprozesse sind flexibel und konfigurierbar: Mitarbeitenden wird Freiheit für alltägliche Bestellungen gegeben, während bei kritischen oder kostenintensiven Vorgängen automatische Eskalationen und Genehmigungen greifen.
Nicht zuletzt ermöglicht Hivebuy dem Einkauf, sein Wissen an die Organisation weiterzugeben. Vorverhandelte Verträge, Katalogartikel oder bevorzugte Lieferanten sind direkt im System sichtbar – wie ein digitaler Einkaufsberater im Hintergrund. So treffen selbst unerfahrene Nutzer bessere Entscheidungen – ganz im Sinne von Kostenkontrolle und Prozesssicherheit.
StartingUp: Ihre Software ist bekannt für ihre Nutzerfreundlichkeit. Wie schaffen Sie es, auch nicht-einkaufserfahrene Mitarbeitende einzubinden?
Bettina Fischer: Benutzerfreundlichkeit steht bei Hivebuy an oberster Stelle. Wann immer wir eine neue Funktion entwickeln, testen wir diese gemeinsam mit unseren Nutzerinnen und Nutzern – direkt aus der Praxis. Unser Ziel ist es, dass Hivebuy genauso intuitiv bedienbar ist wie eine Online-Überweisung: Jeder soll auf Anhieb verstehen, was zu tun ist.
Mit Funktionen wie unserem B2B-Preisvergleich und dem sogenannten Guided Buying führen wir Mitarbeitende gezielt durch den Einkaufsprozess – Schritt für Schritt, ganz ohne Schulungsaufwand. So wird selbst komplexes Einkaufswissen einfach zugänglich gemacht.
Für Freigabeverantwortliche haben wir zusätzlich eine besonders komfortable Lösung geschaffen: Freigaben können direkt über Messenger-Apps wie Microsoft Teams erteilt werden – ohne sich ins System einloggen zu müssen. Die relevanten Informationen kommen automatisch dorthin, wo man ohnehin schon arbeitet – aufs Handy oder den Desktop. Das senkt die Einstiegshürden enorm und sorgt für eine breite Akzeptanz im gesamten Unternehmen.
StartingUp: Welche Rolle spielen Transparenz und Echtzeit-Reporting in der Budgetkontrolle?
Bettina Fischer: Wir sind überzeugt: Budgetkontrolle funktioniert nur in Echtzeit. Es bringt wenig, wenn Budgetübersichten nur monatlich, quartalsweise oder gar halbjährlich zur Verfügung stehen. Entscheidungen im Einkauf werden täglich getroffen – also muss auch die Budgettransparenz jederzeit aktuell sein.
Deshalb haben wir bei der Entwicklung von Hivebuy besonderen Fokus auf eine unmittelbare Budgeteinsicht gelegt. Sobald eine Bestellung angefragt wird, sieht der oder die Budgetverantwortliche sofort, wie sich diese auf das verfügbare Budget auswirkt. Diese Echtzeit-Transparenz ist ein zentrales Element unserer Software.
Gleichzeitig möchten wir Mitarbeitende befähigen, innerhalb ihrer Befugnisse selbstständig Entscheidungen zu treffen. Nicht jede Anfrage muss durch mehrere Instanzen laufen. Vielmehr setzen wir auf smarte, automatisierte Prozesse – kombiniert mit dem Vertrauen in die Souveränität der Nutzer. Das spart nicht nur Zeit, sondern steigert auch die Effizienz und Zufriedenheit im Unternehmen.
StartingUp: Die Einführung neuer Software bedeutet oft hohen Aufwand. Wie gestaltet sich die Implementierung von Hivebuy?
Bettina Fischer: Ich habe selbst über viele Jahre ERP- und Einkaufssoftwareprojekte geleitet – und ehrlich gesagt: Es war jedes Mal ein enormer Aufwand. Genau diese Erfahrungen haben mich dazu motiviert, Hivebuy so zu entwickeln, dass Implementierung eben nicht zur Belastung wird.
Unsere Lösung ist bewusst so aufgebaut, dass sie schnell, unkompliziert und ohne großen IT-Aufwand eingeführt werden kann. Neue Unternehmen können innerhalb kürzester Zeit starten – oft sogar innerhalb eines Tages mit einem eigenen Testsystem.
Die Einführung begleiten wir durch leicht verständliche Videotutorials und Onboarding-Materialien. Darüber hinaus gibt es persönliche Sessions, in denen die Nutzer befähigt werden, das System selbstständig für ihr Unternehmen zu konfigurieren. Schnittstellen zu ERP-Systemen wie SAP, Microsoft Dynamics oder DATEV richten wir in der Regel innerhalb weniger Stunden bis Tage ein.
Wenn beide Seiten fokussiert an das Projekt herangehen, können wir bei Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitenden innerhalb von acht Wochen vollständig live gehen – inklusive Integration, Schulung und Rollout.
StartingUp: Wie unterstützt Hivebuy IT-Teams und technische Entscheider bei der Integration?
Bettina Fischer: Unsere größte Stärke in der Zusammenarbeit mit IT-Teams ist unsere Schnelligkeit. Bereits im ersten Kick-Off mit der IT tauschen wir alle relevanten technischen Dokumentationen aus, klären die Rahmenbedingungen und ermöglichen in kürzester Zeit die Integration in ein Testsystem. Wir verzichten bewusst auf langwierige Business-Blueprint-Phasen und setzen stattdessen auf eine praxisnahe, direkte Umsetzung.
Hivebuy verfolgt eine klare Integration-First-Strategie. Das bedeutet: Unsere Lösung ist von Grund auf so konzipiert, dass sie sich schnell und flexibel in bestehende ERP-Systeme und IT-Landschaften integrieren lässt. Für alle gängigen Systeme – ob SAP, Microsoft Dynamics, DATEV oder NetSuite – stellen wir vollständige Schnittstellen-Dokumentationen zur Verfügung.
Mein Mitgründer Stefan Kiehne bringt aus seiner Zeit bei PwC tiefes technisches Know-how mit und hat zahlreiche ERP-Implementierungen verantwortet. Dieses Wissen fließt direkt in unsere Projekte ein. Inzwischen haben wir Hivebuy in so viele verschiedene Systeme integriert, dass kaum noch Überraschungen aufkommen. Für IT-Verantwortliche bedeutet das: minimale Unsicherheiten, schnelle Umsetzung und maximale Kompatibilität.
StartingUp: Wie sieht die Zukunft des indirekten Einkaufs aus? Welche Trends beobachten Sie?
Bettina Fischer: Ich sehe im indirekten Einkauf ganz klar einen Wandel hin zu intelligenter Automatisierung und echter Transparenz. Schon heute beobachten wir den Trend in Richtung „Agent AI“ – also digitale Einkaufsassistenten, die Nutzer durch Prozesse begleiten und Entscheidungen mit datenbasierten Empfehlungen unterstützen. Das wird sich in den nächsten Jahren deutlich verstärken.
Was mich persönlich schon lange wundert: Im B2C-Bereich haben wir mit Plattformen wie Idealo längst Preis- und Konditionsvergleiche. Im B2B gibt es das kaum. Deshalb war es uns wichtig, mit Hivebuy eine Lösung zu schaffen, die genau das möglich macht – inklusive der hinterlegten, unternehmensspezifischen Konditionen. Das ist ein echter Gamechanger.
In Zukunft wird der indirekte Einkauf zunehmend automatisiert ablaufen – von der Bedarfserkennung bis hin zur Bestellung. Vergleichbar mit einem intelligenten Kühlschrank, der automatisch Milch nachbestellt, wird auch im Unternehmen vieles automatisch geschehen: Bedarfe erkennen, Angebote vergleichen, Bestellungen auslösen – ganz ohne manuelles Zutun.
Strategische Beschaffung wird dabei zur Grundlage. Das Ziel ist nicht, jede Bestellung individuell zu behandeln, sondern Prozesse zu standardisieren, auf Unternehmensziele auszurichten und individuelle Bedarfe intelligent einzubinden.
Und auch die Rückseite des Einkaufs wird sich stark verändern: Rechnungsprüfung, Buchung und Zahlungsfreigabe werden zunehmend automatisiert ablaufen. In einer idealen Zukunft brauchen wir keine manuelle Rechnungserfassung mehr – weil alles systemgestützt, regelbasiert und transparent funktioniert.
StartingUp: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Fischer. Ihre Einblicke verdeutlichen, wie entscheidend es für Unternehmen ist, den indirekten Einkauf transparent und effizient zu gestalten. Mit Lösungen wie Hivebuy können Mittelständler versteckte Kosten sichtbar machen und ihre Beschaffungsprozesse nachhaltig optimieren. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Mission, Einkaufsteams bestmöglich zu unterstützen.
EU AI Act: Status quo
Recht für Gründer*innen: der EU AI Act. Wo stehen wir in Sachen Umsetzung? Was Gründer*innen und Start-ups jetzt wissen müssen.

Künstliche Intelligenz (KI) ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern prägt schon heute Geschäftsmodelle, Investitionsentscheidungen und die Arbeitswelt. Mit der europäischen KI-Verordnung (EU AI Act, im Folgenden AI Act) wurde im Frühjahr 2024 der weltweit erste umfassende Rechtsrahmen für den Einsatz von KI verabschiedet. Inzwischen sind die ersten Regelungen in Kraft getreten. Für Gründer*innen und Start-ups bedeutet das nicht nur zusätzliche Pflichten, sondern auch Chancen, sofern sie sich rechtzeitig vorbereiten.
Überblick: Der AI Act
Die Verordnung folgt einem risikobasierten Ansatz: Je höher das Risiko für Grundrechte oder Sicherheit, desto strenger die Anforderungen. Auf der untersten Stufe stehen KI-Systeme, die keinerlei Vorgaben erfüllen müssen, solange sie nicht in verbotene Anwendungsfälle fallen. An der Spitze der Regulierungspyramide befinden sich die sogenannten HochrisikoSysteme, also etwa Anwendungen in der medizinischen Diagnostik, in kritischer Infrastruktur oder bei biometrischen Verfahren. Viele Tools aus dem HR-Bereich fallen darunter.
Daneben bestehen besondere Pflichten für sogenannte Generative KI beziehungsweise General Purpose AI, eingeführt, also große Modelle, die viele Anwendungen treiben und „systemische Risiken“ entfalten können.
Wichtig ist zu wissen, dass die Vorgaben schrittweise gelten. Bereits seit dem 2. Februar 2025 sind bestimmte Praktiken ausdrücklich verboten – zum Beispiel das Social Scoring von Bürger*innen, die flächendeckende Emotionserkennung in Schulen oder am Arbeitsplatz sowie das unkontrollierte Sammeln biometrischer Daten. Wer damit noch experimentiert, bewegt sich schon jetzt im rechtswidrigen Raum.
Seit dem 2. August 2025 gelten außerdem die ersten Pflichten für Anbieter*innen von generativen Modellen. Sie müssen unter anderem Transparenzberichte veröffentlichen und Angaben zu den verwendeten Trainingsdaten machen. Für Modelle, die bereits vor Inkrafttreten am Markt waren, gibt es eine Übergangsfrist bis 2027. Für viele Unternehmen, die solche Modelle nutzen oder in Produkte einbetten, bedeutet das, genau hinzuschauen, welche Informationen von den Modellanbieter*innen zur Verfügung gestellt werden. Sonst können eigene Transparenzpflichten womöglich nicht erfüllt werden.
Noch weiter in der Zukunft liegen die Vorschriften für Hochrisiko-Systeme. Diese greifen ab 2. August 2026 und verlangen ein umfassendes Risikomanagement, eine strenge Qualität der Trainingsdaten, eine lückenlose Protokollierung und eine Konformitätsbewertung, bevor ein Produkt überhaupt in Verkehr gebracht werden darf. Für Hochrisiko-KI, die in ohnehin streng regulierten Produkten steckt, zum Beispiel in Medizinprodukten, gilt eine verlängerte Frist bis 2027.
Konformitätsbewertung heißt vor allem Risikobewertung, welche die Anbieter*innen oder Betreiber*innen selbst durchführen müssen. Eine solche „regulierte Selbstregulierung“ ist ein klassisches Merkmal einer solchen klassischen Produktregulierung und Marktüberwachung.
Was fehlt? Guidance und Governance
Noch herrscht allerdings an vielen Stellen Unsicherheit. Zwar hat die EU-Kommission schon erste Leitlinien veröffentlicht, etwa zur Definition von KI-Systemen oder zu den verbotenen Praktiken. Auch für Anbieter*innen generativer KI gibt es inzwischen ein detailliertes Dokumentationsmuster. Noch fehlen allerdings die angekündigten Handreichungen für die Einstufung und Risikobewertung von Hochrisiko-Systemen, die bis Februar 2026 folgen und praktische Beispiele enthalten sollen. Bis dahin bleibt nur, sich für die Bewertung an bestehenden internationalen Standards zu orientieren, zum Beispiel an den Normungsprojekten der Europäischen Komitees für Normung und für elektrotechnische Normung.
Auf Unionsebene entstehen parallel die neuen Governance-Strukturen. Das AI Office innerhalb der Kommission ist bereits aktiv und koordiniert die Umsetzung. Das AI Board, ein Gremium der Mitgliedstaaten, tagt regelmäßig und stimmt Vorgehensweisen ab. Ein wissenschaftliches Panel unabhängiger Expert*innen wurde im Frühjahr eingerichtet, und das Advisory Forum, das die Perspektive von Unternehmen und Zivilgesellschaft einbringen soll, befindet sich gerade in der Bewerbungsphase. Auch die geplante EU-Datenbank für Hochrisiko-Systeme existiert bisher nur auf dem Papier. Ab 2026 müssen Anbieter*innen ihre Systeme dort registrieren; die Plattform selbst wird jedoch gerade erst aufgebaut.
Und wo steht Deutschland?
Auch hierzulande hakt es noch etwas. Eigentlich hätten die Mitgliedstaaten bis 2. August 2025 ihre Marktüberwachungsbehörden benennen müssen. Ein Entwurf für das deutsche Umsetzungsgesetz sieht die Bundesnetzagentur als zentrale Aufsicht vor, doch die formale Benennung ist noch nicht erfolgt. Klar ist, dass die Bundesnetzagentur die Rolle der Notifizierungsbehörde übernimmt, also für die Anerkennung von Konformitätsbewertungsstellen zuständig ist. Zudem entsteht dort ein Kompetenzzentrum für KI, das die Arbeit von Bund und Ländern koordinieren soll.
Reallabore
Ein Bereich, der für KI-Entwickler*innen besonders interessant ist, sind KI-Reallabore, also sichere Testumgebungen, in denen neue Anwendungen unter Aufsicht erprobt und darauf geprüft werden können, ob sie den rechtlichen Rahmen einhalten. Bis zum Sommer 2026 müssen die Mitgliedstaaten mindestens ein solches Reallabor einrichten. Deutschland hat im Mai 2025 ein erstes Pilotprojekt in Hessen gestartet, gemeinsam mit der Bundesnetzagentur und der Bundesdatenschutzbeauftragten. Hier werden reale Unternehmensfälle durchgespielt, um Abläufe und Bedarfe besser zu verstehen. Solche Projekte können eine wertvolle Möglichkeit sein, mit den Aufsichtsbehörden auf Augenhöhe ins Gespräch zu kommen.
Reaktionen
Der AI Act wird zwar kritisch diskutiert, im Grundsatz aber breit akzeptiert. Gerichtliche Klagen direkt gegen die Verordnung gibt es bislang nicht. In der juristischen Literatur überwiegt die Zustimmung zur Zielrichtung. Kritisiert werden vor allem die Komplexität und die noch offenen Fragen bei der praktischen Umsetzung. Streitpunkte finden sich eher außerhalb der Verordnung bei der Frage, ob Trainingsdaten urheberrechtlich geschützt sind oder wie personenbezogene Daten für KI genutzt werden dürfen.
Die Industrie zeigt ein gemischtes Bild. Viele große Anbieter*innen – von Google über OpenAI bis Mistral – haben einen freiwilligen Verhaltenskodex unterzeichnet. Andere, wie etwa Meta, haben sich bewusst dagegen entschieden. Man muss sich also darauf einstellen, dass je nach Anbieter*in sehr unterschiedliche Informationen und Compliance-Nachweise verfügbar sind.
Andererseits wirkt der AI Act bereits am Markt. In öffentlichen Ausschreibungen tauchen Modellklauseln auf, die auf die KI-Verordnung Bezug nehmen. Investor*innen fragen verstärkt nach Compliance-Prozessen, und Unternehmen beginnen, interne Strukturen für Risikomanagement und Dokumentation aufzubauen.
Im Vergleich zu Europa gibt es in den USA bislang nur freiwillige Standards. Die dort bei der Entwicklung und Anwendung von KI (angeblich) vorherrschende größere Freiheit wird zwar viel gerühmt. Einzelne Bundesstaaten wie Colorado arbeiten allerdings an eigenen regulierenden Gesetzen, die ab 2026 greifen sollen. Vielleicht ist es also ein Vorteil, dass europäische Start-ups früh Erfahrungen in einem regulierten Markt sammeln können.
Fazit
Der AI Act entfaltet bereits jetzt Wirkung, auch wenn viele Details erst in den kommenden Monaten geklärt werden. Daher gilt es, nicht abzuwarten, sondern jetzt eine eigene Roadmap zu entwickeln. Wer früh Prozesse für Risikomanagement, Transparenz und Governance etabliert, wird nicht nur rechtlich auf der sicheren Seite sein, sondern auch Vertrauen bei Kund*innen und Investor*innen gewinnen.
Die EU hat ein klares Signal gesetzt: KI soll innovativ sein, aber auch sicher und vertrauenswürdig. Für Start-ups ist das eine Herausforderung – aber auch eine Chance, sich von Anfang an professionell aufzustellen und den Markt aktiv mitzugestalten.
Der Autor Dr. Daniel Michel, LL.M. ist als Rechtsanwalt im Bereich IT/IP/Technologie tätig und betreibt seit 2018 mit DATA LAW COUNSEL seine eigene Rechtsberatung im Raum München
Warum KI bei Förderanträgen versagt
Fünf Gründe, warum Unternehmen auf menschliche Intelligenz setzen sollten.

Ob steuerliche Forschungszulage, Investitionsförderung oder EU-Programme. Künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT liefert in Sekundenschnelle eine Vielzahl möglicher Förderprogramme. Doch zwischen der reinen Information und der tatsächlichen Erschließung von Fördermitteln liegt ein erheblicher Unterschied. Hier gilt es, Unternehmen zu sensibilisieren.
Fördermittel sind heute ein strategischer Bestandteil moderner Unternehmensfinanzierung. Es reicht daher nicht, die Programme zu kennen. Entscheidend ist, sie rechtssicher, vollständig und förderlogisch aufeinander abgestimmt umzusetzen, um die vollen Förderpotenziale zu heben. Genau hier beginnt die Arbeit von Fördermittelexpert*innen.
Fünf Gründe, warum KI-Tools nicht als Fördermittelberater funktionieren
1. KI erkennt die wahren Förderpotenziale nicht
ChatGPT kann erklären, was ein Förderprogramm leistet. Doch welche Kosten eines konkreten Vorhabens tatsächlich und wie hoch förderfähig sind, lässt sich so nicht beurteilen. Gerade bei komplexen Programmen wie der steuerlichen Forschungszulage sind Erfahrung, Struktur und rechtssichere Abgrenzung entscheidend. Eine gute Fördermittelberatung prüft jedes Vorhaben systematisch: von der Förderfähigkeit nach dem Forschungszulagengesetz (FZulG), AGVO oder De-minimis-Verordnung bis hin zur klaren Trennung förderfähiger und nicht förderfähiger Aufwände.
2. KI kann keine Förderstrategien entwickeln
Eine Liste von Förderprogrammen ersetzt keine Strategie. KI kann nur Optionen nennen, aber keine Strategien zur Umsetzung im Unternehmen entwickeln. Eine gute Fördermittelberatung integriert die Forschungszulage sinnvoll in laufende Projekte und strukturiert Innovations- sowie Investitionsprozesse auf Bundes-, Landes- und EU-Ebene. So entstehen nicht nur Optionen, sondern belastbare, wirtschaftlich wirksame Lösungen.
3. KI kann nicht mit Menschen kommunizieren
Ein Antrag ist mehr als ein Formular. Er muss Anforderungen erfüllen und überzeugen. KI liefert Textbausteine, aber führt keine Gespräche und reagiert nicht auf Rückfragen mit der notwendigen Erfahrung in der Verwaltungspraxis der verschiedenen Förderprogramme. Eine gute Fördermittelberatung übernimmt die gesamte Kommunikation mit Förderstellen, koordiniert mit Bescheinigungsstellen und entwickelt formal korrekte und überzeugende Argumentationen.
4. KI endet beim Prompt – Fördermittelberatung bei der erfolgreichen Projektprüfung
Nach dem Antrag geht die Arbeit oft erst richtig los. Rückfragen, Prüfungen, Nachweise. KI kann Unternehmen dabei nicht unterstützen und keine Verantwortung übernehmen. Eine gute Fördermittelberatung hingegen begleitet die Kund*innen durch den gesamten Förderzyklus mit sauberer Dokumentation, revisionssicherer Aufbereitung und Unterstützung bei Audits und Außenprüfungen.
5. KI zeigt nur den Dschungel – Förderexperten finden den Schatz
Datenbanken geben einen Überblick, aber keine Richtung. Eine gute Fördermittelberatung bewertet alle denkbar möglichen Förderprogramme im konkreten Unternehmenskontext und entwickelt daraus konkrete Maßnahmen, um das Maximum an Fördermöglichkeiten für die Kund*innen rauszuholen. Eine gute Fördermittelberatung schafft so echte wirtschaftliche Vorteile statt der bloßen Auflistung von Fördermöglichkeiten.
Der Autor Efe Duran Sarikaya ist CEO der Fördermittelberatung EPSA Deutschland.
Food-Innovation-Report
Wie Food-Start-up-Gründer*innen im herausfordernden Lebensmittelmarkt erfolgreich durchstarten und worauf Investor*innen besonders achten.

Food-Start-ups haben in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Der zunehmende Wunsch nach nachhaltiger, gesunder und funktionaler Ernährung, das wachsende Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz sowie der Trend zur Individualisierung der Ernährung haben eine neue Gründungswelle ausgelöst. Dennoch: Der Markteintritt im deutschen Lebensmittelmarkt zählt zu den anspruchsvollsten Herausforderungen, denen sich Gründer*innen stellen können. Wer als Start-up nicht durch außergewöhnliche Innovation oder gezielte Nischenstrategie punktet, hat kaum eine Chance, hier gelistet zu werden.
Ohne klare Zielgruppenfokussierung, glaubwürdiges Produktversprechen und professionelle Umsetzung funktionieren auch gute Ideen nicht – wie es u.a. die Frosta-Tochter elbdeli (trotz starker Marke keine Resonanz) und Bonaverde (Kaffeemaschine mit Röstfunktion, die trotz Kickstarter-Erfolg) scheiterte zeigen.
Da dieser Markt so groß ist, ist er auch stark reguliert, hochkonkurrenzfähig und von mächtigen Einzelhandelsstrukturen dominiert. Zu den größten Hürden zählen die komplexe Regulatorik, Logistik und Produktion, Finanzierung sowie die Konsument*innenakzeptanz.
Laut dem Deutschen Startup Monitor nennen 43 Prozent aller Start-ups die Finanzierung als größte Hürde. Kapitalbedarf entsteht früh – für Verpackungen, Lebensmittelsicherheit, Produktion, Mindestabnahmemengen und Vertrieb.
Ein typisches Seed-Investment liegt zwischen 250.000 und 1,5 Millionen Euro. In späteren Phasen steigen institutionelle VCs mit Ticketgrößen von bis zu fünf Millionen Euro ein. Erfolgreiche Exits wie der Verkauf von yfood an Nestlé (2023) zeigen: Der Markt ist in Bewegung, aber selektiv.
Functional Food als Innovationsmotor – aber nicht der einzige
Functional Food ist längst mehr als ein Trend: Es ist ein wachsendes Segment mit wissenschaftlicher Fundierung. Produkte wie funktionale Riegel, Drinks oder Functional Coffee verbinden Geschmack mit gesundheitlichem Mehrwert. Besonders gefragt sind derzeit Inhaltsstoffe wie Adaptogene, Pro- und Präbiotika, pflanzliche Proteine und weitere Mikronährstoffe.
Zugleich gewinnen auch alternative Proteinquellen (Pilze, Algen, Fermentation), klimapositive Lebensmittel und Zero-Waste-Konzepte an Bedeutung. Konsument*innen wollen Ernährung, die nachhaltig und leistungsfördernd ist.
Worauf Investor*innen achten – und was sie abschreckt
Aus Sicht eines/einer Investor*in zählen nicht nur Produktidee und Branding. Entscheidender ist:
- Ist das Team umsetzungsstark, resilient, multidisziplinär?
- Gibt es Traktion (z.B. Verkaufszahlen, Feedback, D2C-Erfolge)?
- Wie realistisch ist der Finanzplan? Sind Margen und Logistik durchdacht?
- Ist das Produkt skalierbar – auch international?
Abschreckend wirken hingegen: überschätzte Umsatzprognosen, fehlende Markteinblicke, instabile Lieferketten oder reine Marketingblasen ohne echte Substanz.
Es ist unschwer zu erkennen: Wer im Food-Bereich gründen will, braucht mehr als eine gute Idee. Der deutsche Markt ist selektiv, komplex und durch hohe Einstiegshürden geprägt. Gleichzeitig ist er enorm spannend für alle, die bereit sind, langfristig zu denken, regulatorisch sauber zu arbeiten und echten Mehrwert zu schaffen.
Food-Start-ups, die ihre Zielgruppe kennen, finanziell solide aufgestellt sind und wissenschaftlich fundierte Produkte entwickeln, haben reale Chancen auf Marktdurchdringung – besonders, wenn sie es schaffen, Handelspartner*innen und Konsument*innen gleichermaßen zu überzeugen.
Investor*innen sind bereit, in solche Konzepte zu investieren, aber sie erwarten mehr als Visionen: Sie erwarten belastbare, integrierte Geschäftsmodelle mit echtem Impact.
Internationaler Vergleich: Was Food-Start-ups in den USA anders machen
Die USA gelten als Vorreiter für Food-Innovation. Der Markt ist schneller, risikofreudiger und deutlich kapitalintensiver. Allein im Jahr 2023 flossen in den USA rund 30 Milliarden US-Dollar Wagniskapital in FoodTech und AgriFood-Start-ups – ein Vielfaches im Vergleich zu Deutschland. Start-ups wie Beyond Meat, Impossible Foods oder Perfect Day konnten in kurzer Zeit hunderte Millionen Dollar einsammeln, skalieren und international expandieren. Die wesentlichen Unterschiede zur deutschen Szene sind:
- Zugang zu Kapital: Amerikanische Gründer*innen profitieren von einer ausgeprägten Investor*innenlandschaft mit spezialisierten VCs, Family Offices und Corporate Funds. In Deutschland dominiert oft konservative Zurückhaltung.
- Marktzugang: Der US-Markt ist dezentraler organisiert. Start-ups können regional Fuß fassen und wachsen, ohne gleich auf landesweite Listungen angewiesen zu sein.
- Regulatorik: Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) ist in vielen Bereichen offener gegenüber neuen Inhaltsstoffen und Health Claims – das ermöglicht schnellere Markteinführungen.
- Kultur & Narrative: Amerikanische Konsument*innen sind innovationsfreudiger. Sie schätzen Storytelling, Vision und Purpose deutlich mehr als europäische Kund*innen.
Das bedeutet nicht, dass der US-Markt einfacher ist. Er ist aber zugänglicher für disruptive Ideen, insbesondere wenn sie skalierbar und investor*innentauglich aufgesetzt sind.
Operative Herausforderungen: vom Prototyp zur Produktion
Die operative Skalierung ist einer der größten Stolpersteine für Food-Start-ups. Eine Rezeptur im Labormaßstab oder im Handwerk zu entwickeln, ist vergleichsweise einfach. Sie jedoch für den industriellen Maßstab zu adaptieren, bringt komplexe Fragestellungen mit sich:
- Wo finde ich einen Co-Packer mit Kapazitäten für Kleinserien?
- Wie skaliert mein Produkt ohne Qualitätsverlust?
- Wie optimiere ich Haltbarkeit ohne künstliche Zusätze?
- Welche Verpackung schützt das Produkt, erfüllt die Nachhaltigkeitsansprüche und passt zu den Preisvorgaben des Handels?
In Deutschland ist die Infrastruktur für Food-Start-ups im Vergleich zu den USA oder den Niederlanden unterentwickelt. Während es in den USA Inkubatoren mit angeschlossenen Produktionsstätten (z.B. The Hatchery in Chicago oder Pilotworks in New York) gibt, fehlt es hierzulande oft an bezahlbaren, flexiblen Produktionslösungen.
Gerade nachhaltige Verpackungen stellen viele Gründer*innen vor Probleme: Biologisch abbaubare Alternativen sind teuer, nicht immer kompatibel mit Logistikprozessen und oft nicht lagerstabil genug. Ein Spagat, der Investitionen und viel Know-how erfordert.
Erfolgsfaktor Vertrieb: Wie Produkte wirklich in den Handel kommen
Viele unterschätzen den Aufwand, der hinter einem erfolgreichen Listungsgespräch steht. Händler*innen erwarten nicht nur ein gutes Produkt – sie wollen einen Business Case:
- Wie hoch ist die Spanne für den Handel?
- Wie ist die Wiederkaufsquote?
- Wie sieht das Launch-Marketing aus?
- Gibt es POS-Materialien oder begleitende Werbekampagnen?
Ein Listungsgespräch ist kein Pitch – es ist ein Verhandlungstermin auf Basis knallharter Zahlen. Ohne überzeugende Umsatzplanung, Distributionserfahrung und schnelle Liefer- fähigkeit hat ein Start-up kaum Chancen auf eine langfristige Platzierung im Regal. Viele Gründer*innen lernen das schmerzhaft erst nach dem Launch.
Zukunftstechnologien im Food-Bereich
Die Food-Branche steht am Beginn einer technologischen Revolution. Neue Verfahren wie Präzisionsfermentation, Zellkultivierung, 3D-Food-Printing oder molekulare Funktionalisierung eröffnen völlig neue Produktkategorien. Beispiele sind:
- Perfect Day (USA) stellt Milchprotein via Mikroorganismen her – völlig ohne Kuh.
- Formo (Deutschland) produziert Käseproteine durch Fermentation.
- Revo Foods (Österreich) bringt 3D-gedruckten Fisch auf pflanzlicher Basis in die Gastronomie und Handel.
Diese Technologien sind kapitalintensiv, regulatorisch komplex, aber langfristig zukunftsweisend. Wer heute die Brücke zwischen Wissenschaft, Verbraucher*innenbedürfnis und industrieller Machbarkeit schlägt, wird zu den Innovationsführer*innen von morgen zählen.
Neben dem klassischen Lebensmitteleinzelhandel gewinnen alternative Vertriebskanäle zunehmend an Bedeutung. Insbesondere spezialisierte Bio- und Reformhäuser wie Alnatura, Denns oder basic bieten innovativen Start-ups einen niedrigschwelligen Einstieg, da sie auf trendaffine Sortimente, nachhaltige Werte und kleinere Produzent*innen setzen. Hier zählen Authentizität, Zertifizierungen und persönliche Beziehungen mehr als reine Umsatzversprechen.
Auch der Onlinehandel wächst rasant: Der Anteil von E-Commerce im deutschen Lebensmitteleinzelhandel liegt zwar erst bei etwa drei bis vier Prozent, doch Plattformen wie Amazon Fresh, Picnic, Knuspr oder Getir bieten zunehmend Raum für neue Marken. Gerade Quick-Commerce-Anbietende ermöglichen kurzfristige Testmärkte und agile Vertriebspiloten in urbanen Zielgruppen.
Der Blick in die USA zeigt, was in Europa bevorsteht: Dort erzielt TikTok bereits über seinen eigenen TikTok Shop mehr als 20 Milliarden US-Dollar Umsatz – Tendenz stark steigend. Immer mehr Food-Start-ups nutzen die Plattform direkt als Verkaufs- und Marketingkanal. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ähnliche Social-Commerce-Strukturen auch in Europa an Relevanz gewinnen – sei es über TikTok, Instagram oder neue, native D2C-Plattformen.
Weitere Trendfelder, die aktuell in den Fokus rücken, sind unter anderem:
- Regeneratives Essen: Lebensmittel, die nicht nur neutral, sondern positiv auf Umwelt und Biodiversität wirken. Beispiele: Produkte mit Zutaten aus regenerativer Landwirtschaft oder CO₂-bindende Algen.
- Blutzuckerfreundliche Ernährung: Start-ups wie Levels (USA) oder NEOH (Österreich) zeigen, wie personalisierte Ernährung über Glukose-Monitoring neue Märkte erschließen kann.
- „Food as Medicine“: Produkte, die gezielt auf chronische Beschwerden oder Prävention ausgelegt sind – beispielsweise bei Menstruationsbeschwerden, Wechseljahren oder Verdauungsstörungen.
- Zero-Waste-Produkte: Verwertung von Nebenströmen (z.B. aus Brauereien oder Obstpressen) zur Herstellung von Lebensmitteln mit Nachhaltigkeitsanspruch.
- Biohacking-Produkte: hochfunktionale Lebensmittel für kognitive Leistung, Schlaf, Erholung oder hormonelle Balance wie zum Beispiel der Marke Moments – by Biogena.
Die Zukunft von Food liegt in der Synthese aus Wissenschaft, Individualisierung und Nachhaltigkeit. Start-ups, die diese Megatrends frühzeitig besetzen, positionieren sich als Pioniere für eine neue Esskultur. Besonders wichtig in der Investor*innenansprache sind:
- Fundierte Zahlenkenntnis: Gründer*innen sollten Unit Economics, Break-Even-Szenarien und Roherträge detailliert erklären können. Vage Aussagen über Marktpotenzial reichen nicht – es braucht belastbare Szenarien.
- Proof of Concept: Idealerweise liegt bereits ein MVP (Minimum Viable Product) mit echter Kund*innenvalidierung vor. Pilotprojekte mit Handelspartner*innen oder Online-Abverkäufe liefern harte Daten.
- Storytelling mit Substanz: Purpose ist gut – aber er muss betriebswirtschaftlich verankert sein. Was motiviert das Team? Wo liegt der USP? Wie stark ist der Wettbewerb?
- Team-Komplementarität: Ein starkes Gründer*innen-Team vereint Produkt- und Marktwissen, betriebswirtschaftliches Denken und Leadership-Kompetenz.
- Exit-Szenario: Investor*innen wollen eine Perspektive: Wird es ein strategischer Verkauf, ein Buy- & Build-Modell oder ein langfristiger Wachstums-Case?
Wer Investor*innen mit klarer Struktur, realistischen Annahmen und ehrlicher Kommunikation begegnet, hat bessere Chancen auf Kapital – inbesondere in einem Markt, der aktuell selektiver denn je agiert. Genau hier liegt die Kernkompetenz von Food-Start-up-Helfer*innen wie der Alimentastic Food Innovation GmbH, die nicht nur in innovative Unternehmen investiert, sondern ihnen aktiv dabei hilft, die oben genannte operative Komplexität zu überwinden und den Time to Market signifikant zu verkürzen – von der Produktidee bis hin zur Umsetzung im Handel.
Fazit
Der deutsche Food-Start-up-Markt ist herausfordernd, aber voller Chancen. Wer heute erfolgreich gründen will, braucht nicht nur eine starke Produktidee, sondern ein tiefes Verständnis für Produktion, Vertrieb, Kapitalstruktur und Markenaufbau. Functional Food, nachhaltige Innovationen und technologiegetriebene Konzepte bieten enorme Wachstumsmöglichkeiten – vorausgesetzt, sie werden professionell umgesetzt und skalierbar gedacht.
Der Autor Laurenz Hoffmann ist CEO & Shareholder der Alimentastic Food Innovation GmbH und bringt langjährige Erfahrung aus dem Lebensmitteleinzelhandel mit.
Zeit für ein neues Leistungsnarrativ
Warum wir Ambitionen neu denken müssen. Ein Kommentar von Benedikt Sons, Co-Founder und CEO der Cansativa Group.

In Deutschland ist Leistung ein stilles Versprechen. Man bringt sie, spricht aber selten darüber. Wer es doch tut, wird schnell als selbstverliebt, unsolidarisch oder toxisch abgestempelt. Ambition? Gilt bei uns oft als Ego-Trip.
Dabei trifft genau das Gegenteil zu: Ambitionen sind der Motor des Fortschritts. Will heißen – ohne Ambitionen treten wir auf der Stelle. Können wir uns das, können wir uns ein Denken, dass Leistung ein Ego-Trip ist, heute noch erlauben? In einer Zeit, die von multiplen geopolitischen Spannungen geprägt ist?
Wir diskutieren über die Vier-Tage-Woche. Obwohl wir international an Boden verlieren und andere Länder Tempo machen, Innovation finanzieren und mutig skalieren. Deutschland? Spricht über „Entschleunigung“ und über Work-Life-Balance als übergeordnetes Ziel. Dabei geht es meiner Meinung nach nicht um weniger Arbeit, sondern um die Frage: Wofür lohnt es sich, Leistung zu bringen – und wie schaffen wir es, das Beste aus Menschen herauszuholen, ohne sie zu verheizen?
Also: Wie kommen wir da hin, dass sich Leistung wieder gut anfühlt?
Leistung: Zwischen Burnout-Mythos und Selbstoptimierungswahn
Das gegenwärtige Leistungsbild pendelt zwischen zwei Polen: Auf der einen Seite der ausgebrannte Consultant, der sein Leben für ein Projekt opfert. Auf der anderen Seite die Influencer-Ästhetik, in der jeder Tag „High Performance“ verspricht, solange die richtige Morgenroutine stimmt.
Beides ist Unsinn. Beides ist egozentriert. Beides ignoriert, worum es wirklich geht: Leistung als kollektives Ziel, als Ausdruck von Sinn, von Teamgeist, von etwas, das größer ist als man selbst. Wenn wir es schaffen, Leistung als etwas Verbindendes zu begreifen, als Teamgedanken – nicht als Konkurrenz –, dann entsteht neben Erfolg auch Identifikation.
Ambitionen sind kein Makel – sie sind Orientierung
Wir müssen wieder lernen, uns mit ambitioniertem Handeln zu identifizieren. Deutschland ist ein Land voller Talente – aber oft auch voller Zweifel. Was fehlt, ist ein klarer Rahmen: Wo wollen wir hin? Wer sind unsere Vorbilder? Und warum lohnt es sich überhaupt, den Sprint aufzunehmen?
Diese Fragen betreffen unser gesamtes Wirtschaftsverständnis. Wir brauchen mehr Mut, klare Ziele zu formulieren. Und wir brauchen den Willen, sie offen zu verfolgen.
Start-up-Kultur: Hardcore oder Heilsbringer?
Start-ups sind Meister darin, ein klares, übergeordnetes Ziel zu formulieren – und mit dem unerschütterlichen Antrieb einer Rakete arbeiten sie gerade zu Beginn mit vollem Schub darauf hin. Gleichzeitig sind Start-ups der Inbegriff von Überforderung: lange Tage, kurze Nächte, wenig Absicherung. Manche glorifizieren diesen Zustand, andere verdammen ihn. Die Wahrheit ist: Start-up ist ein Überlebenskampf, aber auch eine Schule für Fokus, Disziplin und Priorisierung. Mein alter Physiklehrer sagte: „Leistung ist Arbeit pro Zeit.“ Und genau darum geht es. Nicht um den Dauer-Hustle, sondern um kluge, fokussierte Arbeit.
Daher braucht die deutsche Wirtschaft ein Ökosystem, das Hochleistung fördert – ohne Burnout zu belohnen. In dem man mit hoher Schlagzahl arbeitet, aber nicht daran zerbricht. Studien zeigen: Ja, die Belastung im Start-up-Sektor ist hoch – längere Arbeitszeiten, geringere Gehälter, weniger Sicherheit. Besonders Frauen sind oft benachteiligt.
Aber: Die Offenheit für neue Arbeitsmodelle ist ebenfalls höher. Viele Start-ups bieten flexiblere Strukturen, Homeoffice, Fokus-Zeiten, Purpose-getriebenes Arbeiten – also eine Umgebung, die mehr bietet als den klassischen „9-to-5“-Job. Damit machen sie einen entscheidenden Unterschied gegenüber Traditionsunternehmen, die eher auf feste Arbeitszeiten und Bürokultur setzen.
Innovation braucht Raum, kein Sicherheitsdenken
Apropos Traditionsunternehmen: Ich glaube, dass in einem überregulierten Ökosystem die Innovation auf der Strecke bleibt. Wer bei jedem Schritt Angst vor Fehlern hat, wird keine Risiken eingehen. Doch Innovation ohne Risiko gibt es nicht. Unternehmen, die keine Fehler machen wollen, machen auch keine Fortschritte.
Hier ist ein Umdenken gefragt – auch politisch. Wer heute in Deutschland ein Unternehmen gründet, sieht sich mit einer Bürokratie konfrontiert, die oft mehr lähmt als schützt. Gleichzeitig verlieren wir im internationalen Wettbewerb – weil andere Länder schneller, pragmatischer und technologieoffener agieren. Innovation verlangt Raum, Geschwindigkeit – und eine Kultur für Gründer*innen und Investor*innen, in der sie schnell skalieren können.
Europas Chance: Der Weg der Qualität
Der Inbegriff für schnelles Skalieren sind China und die USA. Während China auf Masse setzt und die USA auf Kommerzialisierung, hat Europa die Chance, einen eigenen Weg zu gehen: mit Qualität und gesellschaftlicher Einheit als Alleinstellungsmerkmal. Europa ist eine der wenigen Regionen, in der wirtschaftlicher Erfolg mit sozialer Verantwortung verbunden wird. Wir haben Zugang zu Spitzenforschung, zu klugen Köpfen, zu funktionierenden Institutionen. Was uns fehlt, ist der Mut zur schnellen Umsetzung.
Wir brauchen mehr Kommerzialisierung, ohne unsere Werte zu verlieren. Wir brauchen mehr Tempo, ohne Menschen zu überfordern. Und wir benötigen ein neues Narrativ, das Leistung nicht als toxisch, sondern als Teil einer starken Gesellschaft begreift.
Warum der Leistungsanspruch tief im Unternehmen verankert sein muss
Mehr Tempo, kluge Köpfe, ein Team: Wie gut dieser Dreiklang für mehr Leistung funktioniert, zeigt die Geschichte von Cansativa selbst. 2017 mit wenig Kapital gegründet, haben mein Bruder Jakob und ich früh auf Geschwindigkeit und Umsetzung gesetzt. Während andere noch in Businessplänen dachten, organisierten wir die ersten Importe von Medizinalcannabis, navigierten durch eine regulatorisch hochkomplexe Landschaft und bauten eine Plattform auf, die heute Marktführer in Deutschland ist.
Dass wir vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) den Zuschlag für die Distribution von in Deutschland angebautem Cannabis erhielten, war kein Zufall, sondern Ergebnis von Expertise, strategischer Schärfe und kompromissloser Arbeit. Inzwischen haben wir über 2500 B2B-Kund*innen, ein eigenes Produktportfolio, ein starkes Partnerschaftsnetzwerk und wachsen mit jeder regulatorischen Veränderung weiter. Nicht weil wir Glück hatten, sondern weil wir Leistung als Haltung verstehen.
Ambition braucht Anerkennung
Deshalb fordere ich: Deutschland muss lernen, Ambitionen nicht zu fürchten, sondern zu fördern. Denn wer Leistung immer nur mit Egoismus, Selbstausbeutung oder Ellenbogenmentalität gleichsetzt, nimmt sich die Chance auf echten Fortschritt. Leistung ist kein Selbstzweck – sie ist ein Beitrag zum Wirtschaftswachstum Europas. Sie ist Ausdruck von Haltung, Verantwortung und dem Willen, Dinge besser zu machen. Gefragt ist ein gesellschaftliches Klima, in dem es willkommen ist, Großes zu wollen. Und in dem diejenigen, die sich anstrengen, auch Rückenwind bekommen – nicht Gegenwind.
Unser Unternehmen ist nur ein Beispiel dafür, was möglich ist, wenn Menschen Verantwortung übernehmen und mit einem klaren Ziel handeln. Der Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer gelebten Leistungskultur, die nicht auf Kontrolle, sondern auf Klarheit basiert. Und auf dem Mut weiterzumachen, gerade wenn der Weg steinig ist.
Es ist Zeit, dass wir in Deutschland – und in Europa – ein neues Kapitel aufschlagen. Eines, in dem Ambition der Antrieb ist, in dem Leistung nicht verdächtig, sondern wertvoll ist. Und in dem wir verstehen: Zukunft entsteht dort, wo Menschen nicht fragen, was gerade bequem, sondern was möglich ist.
Was Unternehmen über KI-Agenten wissen müssen
Künstliche Intelligenz in Form autonomer Agenten gewinnt rasant an Bedeutung. Doch wie arbeiten diese KI-Agenten? Was ist bei der Umsetzung zu beachten? Hier gibt's die Antworten.

Die Idee, dass autonome Systeme eng mit Menschen zusammenarbeiten und sie gezielt unterstützen, ist keine Vision mehr, sondern Realität. Während bisher eine umfassende Problemlösungskompetenz im Hintergrund fehlte, bringen KI-Agenten genau diese Fähigkeit mit und übernehmen zunehmend vielfältige Aufgaben in der Arbeitswelt. Wir erklären, was Unternehmen über KI-Agenten wissen müssen.
Was sind KI-Agenten und auf welcher Technologie basieren sie?
KI-Agenten sind Softwaresysteme, die eigenständig Aufgaben ausführen, aus Erfahrungen lernen und dynamisch mit ihrer Umgebung interagieren. Ihr Ziel ist es, Aufgaben autonom zu lösen, ohne dass ein kontinuierliches menschliches Eingreifen notwendig ist. Im Unterschied zu herkömmlichen Automatisierungslösungen bewältigen KI-Agenten selbst komplexe Anforderungen, indem sie sich an neue Bedingungen anpassen. Auch werden sie im Gegensatz zu universellen LLMs in der Regel fein abgestimmt, um Relevanz und Datenschutz zu gewährleisten. Sinnvoll ist eine kontextbezogene Architektur, die kausale KI, Document AI und multimodale Logik kombiniert und damit optimal auf geschäftliche Anwendungsfälle zugeschnitten ist.
In welchen Bereichen der Arbeitswelt entfalten KI-Agenten ihr Potenzial?
KI-Agenten finden in nahezu allen Unternehmensbereichen Einsatzmöglichkeiten – von der Beantwortung einfacher Anfragen bis hin zur Steuerung komplexer Prozesse. Eingebettet in CRM-Plattformen analysieren sie riesige Datenmengen, die Unternehmen manuell nicht mehr auswerten können. Anstatt die Ergebnisse lediglich zu präsentieren oder Kontakte nach Prioritäten zu sortieren, qualifizieren KI-Agenten auch noch automatisch Leads, schlagen passende Angebote vor und beantworten Kundenanfragen. Oder anders formuliert: Während herkömmliche Tools in der Regel auf statischen Wenn-dann-Regeln basieren, führt die neue Generation hyperpersonalisierte Aktionen nahezu in Echtzeit aus. Diese Entwicklung entlastet Mitarbeiter von Routineaufgaben und gibt ihnen Raum, sich auf strategisch wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Unternehmen wiederum können ohne großen Aufwand Tausende von Kunden individuell betreuen.
Werden KI-Agenten den Arbeitsmarkt verändern?
Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Es entstehen durch den verstärkten Einsatz von KI-Lösungen neue Berufsfelder – insbesondere bei der Entwicklung, Integration und Wartung solcher Agentensysteme werden qualifizierte Fachkräfte benötigt. Gleichzeitig stellt sich die Herausforderung, bestehende Mitarbeitende gezielt im Umgang mit diesen Technologien weiterzubilden und deren digitale Kompetenzen auszubauen. Eines muss klar sein: Das Ziel von KI-Agenten ist es nicht, menschliche Arbeitskraft zu ersetzen, sondern deren Fähigkeiten zu erweitern. Mitarbeitende können sich somit stärker auf komplexe Kundeninteraktionen oder die Entwicklung innovativer Kampagnen konzentrieren, während ihnen die KI zur Hand geht.
Worauf müssen Unternehmen bei der Auswahl von KI-Agenten-Lösungen achten?
In erster Linie benötigen sie eine digital ausgereifte Umgebung mit einheitlichen Datenformaten, optimierten Prozessen und regelbasierten Automatisierungen, um den ROI steigern zu können. Anschließend müssen sie sicherstellen, dass ihre KI-Systeme den geltenden Datenschutzbestimmungen entsprechen und sensible Kund*innendaten optimal geschützt sind. Transparenz und Nachvollziehbarkeit der KI-Entscheidungen sind ebenfalls essenziell, um das Vertrauen von Kunden und Mitarbeitenden nicht zu gefährden. Auf technischer Seite ist eine interoperable Lösung notwendig, die sich so nahtlos wie möglich in die bestehende IT-Umgebung integrieren lässt. Zu den weiteren Aspekten zählen die Priorisierung der kontextuellen Abstimmung, da Agenten geschäftsspezifische Arbeitsabläufe und Datenformate verstehen müssen, sowie die Nutzung eines Federated-Model-Ansatzes statt einheitlicher LLM-Frameworks, um Effizienz, Erklärbarkeit und Kosten zu optimieren.
Wie binden Unternehmen ihre Mitarbeitenden am besten ein?
Zunächst einmal ist ein grundlegendes Change Management erforderlich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen verstehen, dass die KI ihnen nicht die Arbeit wegnimmt, sondern sie unterstützen soll. Sinnvoll ist auch ein Low-Code-Ansatz: Maßgeschneiderte KI-Applikationen und automatisierte Workflows steigern die Arbeitseffizienz in Abteilungen um ein Vielfaches – sogar Mini-Anwendungen, die lediglich einfache Aufgaben übernehmen. Jedoch können zentrale IT-Abteilungen, die mit Entwicklungsanfragen aus verschiedenen Abteilungen überhäuft werden, diese kaum bewältigen. Mit einer Low-Code-Application-Plattform (LCAP) können auch Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse einfache KI-Anwendungen selbst erstellen. Möglich machen das einfache Drag-and-Drop-Optionen und vorgebaute Module, die je nach Wunsch kombinierbar sind.
Fazit
KI-Agenten sind als kollaborative Partner zu verstehen, nicht als Ersatz für den Menschen. Künftig werden wir eine Multi-Agent Collaboration sehen. Hierbei übernehmen verschiedene KI-Agenten jeweils Spezialaufgaben und koordinieren sich untereinander, um selbst die komplexesten Herausforderungen effizient zu lösen.
Der Autor Sridhar Iyengar ist Managing Director von Zoho Europe.


