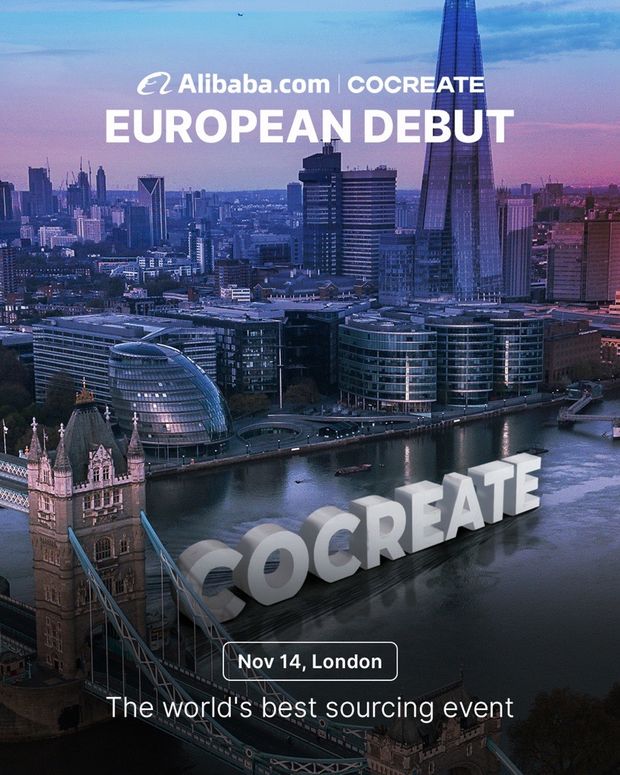Aktuelle Events
Positionspapier zur Zukunftsfähigkeit der europäischen Gründungsszene
Gründer*innen und Investor*innen sind der Schlüssel zur Zukunft Europas – was sich vor diesem Hintergrund ändern muss, zeigt das Positionspapier des Investor*innen- und Gründer*innen-Netzwerks Encourage Ventures.
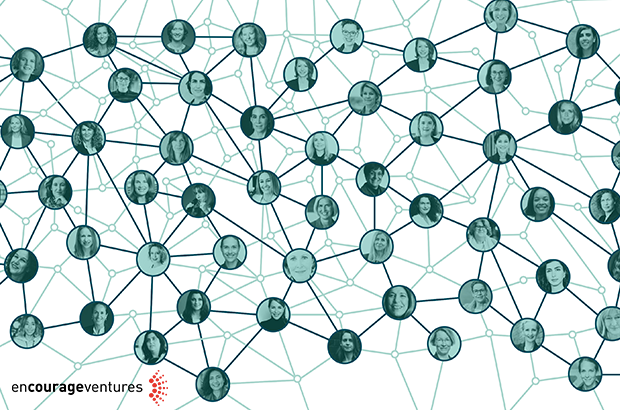
Das Positionspapier von Encourage Ventures stellt konkrete Maßnahmen vor, um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Kraft von Gründer*innen, Investor*innen und die des gesamten Start-up- und Investment Ecosystems zu stärken. Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen wurden bereits fundiert diskutiert und an anderer Stelle vorgeschlagen. Ziel dieses Papiers ist es, bestehende und bewährte Ansätze aufzugreifen, in den Vordergrund zu rücken und deren Umsetzung weiter zu fördern.
Der Status quo
Deutschland verfügt über enormes Innovationspotenzial, das sich in der Höhe des Forschungs- und Entwicklungsaufwands (3,1 % des BIP im Jahr 2023), einer im internationalen Vergleich hohen Anzahl an Patentanmeldungen und exzellent ausgebildeten Fachkräften widerspiegelt.
Doch die bestehenden Rahmenbedingungen verhindern, dass dieses Potenzial vollständig ausgeschöpft wird* Kaum Gründungslehre an Schulen und Hochschulen, langwierige und nicht-digitalisierte Gründungsprozesse, unzureichende Kapitalverfügbarkeit, Fachkräftemangel und eine insgesamt überbordende Bürokratie hemmen das Gründungsgeschehen in Deutschland. Während der Marktwert des deutschen Start-up-Ökosystems lediglich 4,7 % des BIP ausmacht, liegt dieser Wert in den USA bei 16 % (Startup-Verband und McKinsey 2023). In diesem Umfeld nimmt der Wunsch nach Unternehmertum und Selbständigkeit weiter ab* Nur 3,6 % der 18- bis 64-Jährigen planten 2023 eine Gründung – ein Rückgang gegenüber 4,5 % im Jahr 2022 und 6,0 % im Jahr 2010 (KfW Gründungsmonitor 2024).
Auch die Diversität im deutschen Start-up-Ökosystem ist begrenzt. Die Gründungsquote stagniert, und der Anteil an Gründerinnen liegt bei nur 18,8 % (Deutscher Startup Monitor 2024). Gleichzeitig bleibt das Potenzial privater Investor*innen weitgehend ungenutzt* Deutschland zählt fast 16.000 aktive Business Angels (BAND 2024), von denen lediglich 15 % – rund 2.400 – weiblich sind. Dies reduziert unter anderem die Perspektivenvielfalt und Diversität bei Investmententscheidungen. Darüber hinaus fehlen steuerliche Anreize, Wissen und ein adäquates Risikobewusstsein, um das Interesse an Angel Investing als Assetklasse zu steigern. 2023 wurden lediglich 14,5 % der Wachstumsfinanzierungen in Deutschland von inländischen Investoren getragen, während US-Investor*innen 46,1 % dieser Investments stemmten (Deutscher Startup Monitor 2023).
Was ist an welcher Stelle zu leisten?
Viele dieser Herausforderungen und Potenziale lassen sich jedoch nicht allein auf nationaler Ebene lösen. Eine verstärkte europäische Perspektive ist notwendig, um grenzüberschreitende Investitionen zu fördern, einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten zu stärken. Dies gilt besonders für den Aufbau eines europäischen Start-up-Ökosystems, das Synergien zwischen den Ländern nutzt und ein wettbewerbsfähiges Umfeld schafft, um das Innovationspotenzial Europas voll auszuschöpfen.
Dieses Positionspapier stellt konkrete Maßnahmen vor, um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Kraft von Gründer*innen und Investor*innen, des gesamten Start-up- und Investment Ecosystems zu stärken. Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen wurden bereits fundiert diskutiert und an anderer Stelle vorgeschlagen. Ziel dieses Papiers ist es, bestehende und bewährte Ansätze aufzugreifen, in den Vordergrund zu rücken und deren Umsetzung weiter zu fördern. Dabei geht es nicht nur darum, bestehende Hürden abzubauen, sondern auch das enorme Innovationspotenzial Europas zu nutzen. Bis 2030 könnte Europa durch DeepTech-Innovationen bis zu 8 Billionen Euro an Wertschöpfung realisieren, wenn der Transfer von Forschung in die Praxis effizient gestaltet wird (BCG 2024). Das Ziel ist ein dynamisches, inklusives und global wettbewerbsfähiges Start-up-Ökosystem.
1. Gründung vereinfachen und Bürokratie abbauen
Der zeit- und kostenintensive Prozess der Unternehmensgründung sowie die überbordende Bürokratie stellen erhebliche Hürden für Entrepreneur*innen in Deutschland dar. Im internationalen Vergleich schneidet das Land in Bezug auf die Einfachheit und Geschwindigkeit von Gründungen schlecht ab (Global Entrepreneurship Monitor 2024). Langsame Genehmigungsprozesse und komplexe Regulierungen schrecken potenzielle Gründer*innen ab, behindern die Entstehung neuer Unternehmen und bremsen das Wachstum bestehender Start-ups.
Handlungsempfehlungen
Ein zentraler Ansatz zur Erleichterung von Gründungen ist die vollständige Digitalisierung der Gründungsprozesse. In Estland etwa ermöglicht eine zentrale Plattform die Gründung innerhalb von 24 Stunden – ein Modell, das auch in Deutschland umgesetzt werden sollte. Die Vision einer europaweiten Plattform wurde bereits mit „Europe’s Choice“ diskutiert. Durch eine solche Harmonisierung könnten Start-ups EU-weit einheitlich registriert werden, was nicht nur die Bürokratie abbauen, sondern auch die Sichtbarkeit und Attraktivität für Investoren erhöhen würde (EC 2024).
Ein weiterer wichtiger Schritt ist der gezielte Regulierungsabbau. Die Vereinfachung steuerlicher und rechtlicher Vorgaben sowie die Einführung einer standardisierten EU- weiten Rechtsform könnten die Mobilität und Wettbewerbsfähigkeit von Start-ups stärken und den Time-to-Market erheblich beschleunigen. Dies würde grenzüberschreitende Geschäftsmodelle und internationale Expansionen erleichtern (Innovationsagenda 2030).
Die Digitalisierung der Verwaltung ist dabei eine Grundvoraussetzung. Einheitliche digitale Plattformen für Verwaltungsprozesse – einschließlich Steuer- und Handelsregisterverfahren – könnten die Dauer und Komplexität von Genehmigungen deutlich reduzieren (Innovationsagenda 2030).
Darüber hinaus sollte ein zentralisiertes und standardisiertes IP-Transfer-System etabliert werden. Ergänzt durch eine IP-Deal-Datenbank würde dies den Innovationsschutz verbessern und Start-ups bei der Sicherung ihrer geistigen Eigentumsrechte unterstützen (BVK 2024).
Durch diese Maßnahmen könnten die Hürden für Gründer*innen signifikant gesenkt und die Rahmenbedingungen für neue und wachsende Unternehmen deutlich verbessert werden. Dies würde nicht nur die Zahl der Unternehmensgründungen steigern, sondern auch die Innovationskraft und Wirtschaftsdynamik Deutschlands und Europas insgesamt nachhaltig fördern.
2. Mehr Wagniskapital mobilisieren
Der deutsche Venture-Capital-Markt bleibt gemessen an der Wirtschaftskraft des Landes hinter seinen Möglichkeiten zurück. Nur 0,17 % des deutschen BIP fließt in Wagniskapital, verglichen mit 0,34 % in Frankreich und signifikant höheren Werten in den USA. Wir müssen also zunächst mehr privates Kapital mobilisieren. Dazu ist es essenziell, die Wahrnehmung des Chancen-Risiko-Verhältnisses von Wachstumsinvestitionen zu verbessern. Diese Assetklasse wird derzeit oft unterschätzt, obwohl ihre Performance besser ist, als ihr Ruf vermuten lässt.
Auch kulturell besteht in Deutschland hohe Skepsis gegenüber Wagniskapital. Es wird viel zu häufig noch mit kurzfristiger Gewinnorientierung, aggressiven Geschäftspraktiken und wenig Transparenz in Bezug auf Entscheidungsprozesse und Investitionskriterien assoziiert. Dabei geht es nicht um das kurzfristige Spekulieren auf schnelle Gewinne, sondern um langfristige Investitionen in innovative Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial. Der Nutzen dieser Investitionen für die Gesellschaft ist im Durchschnitt 3 bis 4-mal größer als für die Investor*innen selbst. Ein Phänomen, das als Spillover-Effekt bekannt ist.
Handlungsempfehlungen
Ein erster Schritt hin zu einer stärkeren Akzeptanz von Venture Capital als Anlageklasse wäre die Schaffung von Transparenz. Durch die systematische Analyse und Veröffentlichung von Rendite-, Verlust- und Ausfallquoten könnten realistische Erwartungen an die Performance von VC-Investitionen etabliert werden. Der Vergleich mit Performancedaten aus den USA oder anderen erfolgreichen VC-Märkten könnte helfen, Stärken und Schwächen des deutschen Markts besser zu verstehen und zu kommunizieren. Institutionelle und private Investoren könnten durch transparente Informationen von der Attraktivität dieser Anlageklasse überzeugt werden. Eine sinnvolle erste Maßnahme wäre also beispielsweise die Etablierung einer unabhängigen Forschungsinitiative zwischen wissenschaftlichen Institutionen, politischen Akteur*innen und Marktakteur*innen sein.
Der wohl größte Hebel besteht im Abbau steuerlicher Hürden bzw. der Lenkungswirkung von Steuern. Dazu gehört es, einen steuerlichen Sofortabzug für Investitionen in förderfähige Start-ups zu ermöglichen. Bei positiven Entwicklungen des Investments sollen entsprechende Veräußerungsgewinne besteuert werden, um den vorherigen Steuervorteil auszugleichen. Unternehmen sollten ihre Corporate-Venture-Capital-Investitionen in Start-ups als Forschungs- und Entwicklungsausgaben steuerlich geltend machen und Verluste entsprechend verrechnen können. Dies würde Unternehmen als Kapitalquelle für Start-up-Finanzierungen attraktiver machen.
Eine Umsatzsteuerbefreiung für Fondsverwaltungsleistungen, wie in anderen EU-Mitgliedsstaaten üblich, würde die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Fonds erhöhen und insbesondere kleineren Fonds den Markteintritt erleichtern (BVK 2024).
Durch die Anpassung der Schwellenwerte für semiprofessionelle Anleger von derzeit 200.000 Euro auf 100.000 Euro, würde zudem mehr Privatinvestor*innen der Zugang zu VC-Investments ermöglicht und die Akzeptanz gesteigert. Gleichzeitig könnten Maßnahmen wie der Aufbau neuer Business-Angel-Netzwerke, eine gesteigerte Sichtbarkeit von Investmentmöglichkeiten über Club-Deal- und Pooling-Strukturen, gezielte steuerliche Erleichterungen sowie die Ausweitung des BAFA INVEST-Zuschusses einen entscheidenden Beitrag leisten.
Eine der zentralen Maßnahmen ist die Einbindung institutioneller Investor*innen in den Wagniskapitalmarkt. Aktuell tragen Pensionsfonds und Versicherungen weniger als 13 % bei. Damit auch diese Primärinvestor*innen verstärkt in die Assetklasse investieren, sind verschiedene Maßnahmen denkbar. Das Hauptproblem liegt in den Vorschriften der EU-Richtlinie Solvency II, die institutionelle Investor*innen dazu verpflichten, risikoreiche Investitionen wie VC mit hohem Eigenkapital abzusichern. Dies macht solche Investitionen im Vergleich zu Alternativen wie Staatsanleihen unattraktiv. Eine kurzfristig umsetzbare Lösung wäre, dass der Staat Ausfallbürgschaft für weitgehend ausfallsichere Wachstumsfonds oder Dachfonds übernehmen könnte. Dies hätte mehrere Vorteile: Für den Staat bedeutet dies zusätzliche Einnahmen durch die Differenz zwischen der Renditeerwartung und der für private Investor*innen benötigten Rendite. Für institutionelle Investor*innen wird so der Zugang zu einer attraktiven Anlageklasse ohne hohe Eigenkapitalanforderungen ermöglicht und für die Wirtschaft würde dies erhebliche Steigerung der Investitionen in Wachstumsunternehmen bedeutet (Brandis 2024).
Eine weitere Maßnahme ist die Schaffung der bereits genannten Dachfonds (auch als „Fund of Funds“). Dabei handelt es sich um Investmentfonds, die nicht direkt in Start-ups oder Unternehmen investieren, sondern ihr Kapital in eine Vielzahl anderer VC-Fonds streuen. Somit tragen sie zur Risikodiversifikation bei und ermöglichen es auch konservativen institutionellen Anleger*innen in Venture Capital zu investieren. Erste richtige Schritte wurden im Rahmen der WIN-Initiative, einem breiten Bündnis von Wirtschaft, Verbänden, Politik und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bereits gegangen. Hieran muss die neue Regierung zwingend anknüpfen und diese weiter ausbauen.
3. Zugang zu Wagniskapital erleichtern
Start-ups erhalten in der Wachstumsphase im internationalen Vergleich deutlich weniger Kapital, insbesondere im Vergleich zu ihren Pendants in den USA (BVK 2024). Besonders schwierig ist die Situation für von Frauen oder diversen Teams geführte Start-ups, die unverhältnismäßig weniger Wagniskapital erhalten (Pitchbook Data 2025). Diese strukturellen Defizite erschweren nicht nur das Wachstum innovativer Unternehmen, sondern hemmen auch die Entwicklung eines diverseren und wettbewerbsfähigeren Innovationsökosystems.
Handlungsempfehlungen
Ein Ansatzpunkt liegt in der gezielten Förderung strategischer Innovationsbereiche. Der seit 2023 bestehende DeepTech & Climate Fonds zeigt bereits, wie Investitionen in künstliche Intelligenz und Biotechnologie zukunftsweisende Entwicklungen unterstützen können (BMWK 2024). Diese Initiativen bieten wichtige Impulse, um nicht nur den Zugang zu Kapital zu verbessern, sondern auch die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Start-up-Ökosystems zu stärken.
Um den Zugang zu Wagniskapital zu erleichtern, sollten Investitionsprozesse datenbasiert und standardisiert gestaltet werden. Insbesondere staatliche Fonds können durch objektive Kriterien wie Verkaufszahlen oder Teamkompetenzen existierende Bias reduzieren und faire Bedingungen für alle schaffen (Hassan et al. 2020). Eine europäische Lösung in Form eines Dachfonds könnte zudem institutionelle Investoren grenzüberschreitend mobilisieren und so die Finanzierung von Wachstumsunternehmen verbessern (Innovationsagenda 2030).
4. Entrepreneurial Mindset und Hochschul-Ausgründungen stärken
Trotz der hohen allgemeinen Bildungsqualität liegt die Zahl der Unternehmensgründungen in Deutschland bei lediglich 12,8 pro 10.000 Studierende (Gründungsradar 2022). Ein möglicher Grund dafür ist, dass Gründungslehre in Schulen und Hochschulen noch immer nur eine untergeordnete Rolle spielt. Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland hierbei unterdurchschnittlich ab (Global Entrepreneurship Monitor 2024).
Da die Unternehmensgründung als berufliche Option dadurch wenig sichtbar ist und sowohl geeignete Strukturen als auch gezielte Unterstützung für die Überführung von Forschungsergebnissen in marktfähige Unternehmen fehlen, bleibt das wirtschaftliche Potenzial wissenschaftlicher Innovationen und interdisziplinärer Zusammenarbeit weitgehend ungenutzt.
Handlungsempfehlungen
Um das unternehmerische Denken zu fördern und Hochschulausgründungen zu stär- ken, sollten Entrepreneurship und Digitalisierung in Schulen und Hochschulen als Querschnittsthemen etabliert werden (Innovationsagenda 2030). Formate wie ein „Start-up-Semester“ könnten Studierenden praxisnahe Gründungserfahrungen bieten und interdisziplinäre Netzwerke stärken (BVK 2024). Ergänzend sollten verpflichtende oder freiwillige Entrepreneurshipkurse in allen Studiengängen eingeführt werden, um Studierende frühzeitig auf die Chancen und Herausforderungen einer Gründung vorzu- bereiten (BMWK, EXIST 2024).
Unterstützend und gleichzeitig qualitätssichernd könnte wirken, wenn den Bildungsträgern zeitgemäßer, digitaler Content für die Lehre zur Verfügung gestellt wird. Wir fordern daher eine Initiative „EdTech for Entrepreneurship Education“ ins Leben zu rufen. Unter der Leitung des Bundesbildungsministeriums (BMBF) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sollte ein Wettbewerb organisiert werden, bei dem EdTech-Start-ups Lösungsvorschläge für unterschiedliche Bildungsstufen einreichen können. Pro Bildungsstufe wird die überzeugendste Lösung ausgewählt und finanziert. Die Finanzierung erfolgt über eine Public-Private-Partnership, bei der öffentliche Mittel mit Beiträgen von Stiftungen kombiniert werden. Bewertet werden die Einreichungen nach Kriterien wie Skalierbarkeit, didaktischem Mehrwert und Innovationsgehalt. Die ausgewählten Lösungen erhalten Unterstützung in Form von Finanzierung, fachlicher Begleitung und Netzwerkzugang, um eine flächendeckende Umsetzung zu ermöglichen. Ziel ist es, unternehmerische Kompetenzen breiter in das deutsche Bildungssystem zu integrieren und gleichzeitig digitale Innovationen im EdTech-Sektor zu fördern.
Zur Unterstützung konkreter Gründungsvorhaben sind eine bessere, langfristig stabile finanzielle Ausstattung und der Ausbau von Technologie-Transfer-Büros an Hochschulen notwendig, um Forschende bei der Kommerzialisierung ihrer Ideen zu unterstützen (BMBF 2024). Reallabore könnten zudem praktische Umgebungen schaffen, in denen interdisziplinäre Teams Zugang zu Infrastruktur und Expertise erhalten und innovative Ideen testen können (Innovationsagenda 2030).
Gleichzeitig müssen internationale Austauschprogramme wie „Erasmus for Start-ups“ den Wissenstransfer und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa fördern. Netzwerke wie „EXIST-Women“ sollten erweitert werden, um Frauen durch Mentoring, Stipendien und Coaching gezielt zu unterstützen (BMWK 2024). Die Sichtbarkeit erfolgreicher Gründerinnen und diverser Teams, auch in den oben genannten Lerninhalten, sollte erhöht werden, um mehr junge Menschen, insbesondere Frauen, für eine unternehmerische Laufbahn zu inspirieren (Innovationsagenda 2030).
Durch diese Maßnahmen kann ein nachhaltiges, interdisziplinäres und diversifiziertes Innovationsökosystem entstehen, das nicht nur die Zahl der Hochschul-Ausgründungen erhöht, sondern auch das Bewusstsein für Gründung als berufliche Option in der Gesellschaft stärkt. Der Wettbewerb um Startup-Factories setzt hier sicherlich neue Maßstäbe. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima spannt mit Wirtschaft und privaten Investoren eine Unterstützungslandschaft auf, die Ausgründungen aus der Wissenschaft einen neuen Schub geben werden (BMWK 2024).
5. Fachkräftemangel bekämpfen, Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen weiter verbessern und Forschungszulage ausbauen
Der Fachkräftemangel, insbesondere im Tech-Bereich, stellt eine erhebliche Wachstumsbremse für Start-ups in Deutschland dar. Besonders auffällig ist die Unterrepräsentation von Frauen in MINT-Berufen: Nur 22 % der Tech-Jobs in Europa werden von Frauen ausgeübt. Dies ist nicht nur eine Frage der Gleichstellung, sondern auch ein wirtschaftliches Problem, da diverse Teams nachweislich kreativer und innovativer arbeiten. Studien zeigen, dass ein höherer Frauenanteil Europas BIP bis 2027 um bis zu 600 Milliarden Euro steigern könnte (McKinsey 2023).
Gleichzeitig bleibt der Transfer von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte bzw. Services eine Herausforderung. Während Länder wie Singapur gezielt in Innovationsförderung investieren, sind die bestehenden Programme in Deutschland, wie etwa EXIST oder die Forschungszulage, zwar ein guter Anfang, aber international weniger wettbewerbsfähig. Länder wie Frankreich, Österreich oder Spanien bieten deutlich attraktivere steuerliche Vorteile für Forschung und Entwicklung.
Die klare Trennung der beiden Themen zeigt: Der Fachkräftemangel erfordert eine verstärkte Förderung von Frauen in MINT-Berufen und attraktivere Bedingungen für Talente, die auch die Lebensbedingungen berücksichtigen. Gleichzeitig braucht es innovative, international konkurrenzfähige Förderprogramme, die Forschungsergebnisse effektiv in marktfähige Produkte umsetzen. Nur durch diese doppelte Strategie können Start-ups langfristig gestärkt werden.
Handlungsempfehlungen
Um den Fachkräftemangel zu adressieren, sollten Bildungsinitiativen und Stipendienprogramme ausgebaut werden, die Frauen und Mädchen gezielt für MINT-Fächer begeistern (Innovationsagenda 2030). Initiativen wie z.B. MINTvernetzt, Girls‘ Day, CyberMentor oder Femtec könnten dabei gezielt gefördert und ausgebaut werden. Ergänzend dazu sollte die Gewinnung internationaler Fachkräfte erleichtert werden. Eine Digitalisierung der Visa-Verfahren und die Einführung eines Bundesministeriums für Migration sowie Relocation Services könnten entsprechende Rahmenbedingungen setzen (Innovationsagenda 2030). Zudem könnten steuerliche Anreize nach dänischem Modell Deutschland für internationale Talente attraktiver machen. In Dänemark erhalten Expatriates über einen Zeitraum von bis zu 7 Jahren von einem vergünstigten Steuersatz von 32,84 % auf Arbeitsentgelt und bestimmte Sondervergütungen (27 % Steuern zzgl. Arbeitsmarktbeitrag). Flankierend wäre eine verbesserte Anerkennung ausländischer Abschlüsse wünschenswert (BMWK 2024).
Eine weitere wichtige Maßnahme ist die Verbesserung der Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Eine Erhöhung der steuerlichen Freibeträge auf mindestens 10.000 Euro pro Jahr (bisher 2.000 Euro) würde die Attraktivität von Start-ups als Arbeitgeber*innen deutlich steigern. Zudem sollte die bestehende Regelung, die die Besteuerung von „trockenen Einkünften“ aufschiebt, auch auf ehemalige Mitarbeitende aus- geweitet werden, die das Unternehmen unter guten Bedingungen als sogenannte Good Leaver verlassen haben. Einheitliche europäische Standards für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme könnten zusätzlich die grenzüberschreitende Mobilität und Rekrutierung fördern (EU-Kommission 2024).
Im Bereich Innovationsförderung sollte die Forschungszulage für Start-ups signifikant erhöht werden. Fördermodelle, bei denen 50 % bis 70 % der förderfähigen Personalkosten übernommen werden, könnten die Skalierung von Unternehmen, wie in Singapur gezeigt, erheblich beschleunigen. Technologieübergreifende Reallabore für ClimateTech und DeepTech könnten helfen, Forschungsergebnisse schneller in marktfähige Produkte umzuwandeln (Innovationsagenda 2030). Europäische Innovationsnetzwerke und gemeinsame Initiativen für ClimateTech und DeepTech sollten gezielt ausgebaut werden, um den Technologietransfer zu fördern.
Partnerschaften mit dem Mittelstand und erweiterte Finanzierungsangebote könnten ebenfalls entscheidende Impulse setzen (EU Green Deal, BVK 2024). Diese Maßnahmen würden nicht nur den Fachkräftemangel und die Innovationsförderung adressieren, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit und Skalierungsfähigkeit deutscher Start-ups im internationalen Kontext stärken.
6. IPOs und Anschlussfinanzierungen stärken
Ein schwacher Kapitalmarkt und eingeschränkte Möglichkeiten für Börsengänge (IPOs) stellen erhebliche Wachstumshemmnisse für Start-ups in Deutschland dar. Während weltweit 2024 insgesamt 876 Börsengänge verzeichnet wurden, entfielen fast ein Viertel davon auf die USA (186) und lediglich 6 % auf Europa (57). In Deutschland wurden gerade einmal 5 IPOs umgesetzt (PwC 2024). In einem ohnehin gründungsfreundlichen Umfeld sind im Gegensatz dazu Börsengänge in den USA ein zentraler Bestandteil des Start-up-Ökosystems. In Deutschland fehlt es jedoch häufig an den notwendigen Anschlussfinanzierungen, um den Übergang von der Wachstums- in die Skalierungsphase erfolgreich zu bewältigen. Dies führt nicht nur zu einer Schwächung der Innovationskraft, sondern auch dazu, dass vielversprechende Unternehmen zunehmend ins Ausland abwandern.
Handlungsempfehlungen
Ein verbesserter Zugang zum Kapitalmarkt ist essenziell, um Start-ups in Deutschland bessere Wachstums- und Skalierungsmöglichkeiten zu bieten. Die regulatorischen Hürden für IPOs sollten gesenkt werden, sodass Unternehmen frühzeitiger und einfacher eine Börsennotierung erreichen können. Als Vorbild könnten spezielle Börsensegmente für Wachstumsunternehmen dienen, wie sie etwa in Großbritannien mit dem „Alternative Investment Market“ (AIM) etabliert wurden. Diese Plattform bietet Start-ups die Möglichkeit, Kapital zu beschaffen, ohne die umfassenden Auflagen regulärer Börsensegmente erfüllen zu müssen.
Ein weiterer wichtiger Schritt wäre die Schaffung eines europäischen Aktienmarktes für Wachstumsunternehmen. Ein solcher Markt könnte nicht nur Finanzierungsoptionen über Ländergrenzen hinweg verbessern, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas als Innovationsstandort stärken. Dafür ist es entscheidend, regulatorische Hürden EU-weit zu senken und gleichzeitig rechtliche sowie steuerliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die Exits durch private Verkäufe oder Übernahmen erleichtern.
Darüber hinaus sollten gezielte Anschlussfinanzierungsprogramme für wachstums- starke Start-ups in kapitalintensiven Bereichen wie DeepTech und ClimateTech entwickelt werden. Solche Programme könnten öffentliche-private Partnerschaften umfassen und die Einbindung institutioneller Investor*innen fördern. Größere Kapitalvolumina und private Investitionen würden durch diese Maßnahmen mobilisiert, wodurch der deutsche Kapitalmarkt als zentraler Anlaufpunkt für Innovation und Wachstum etabliert werden könnte.
Diese Reformen würden nicht nur den Zugang zu Kapital für Start-ups erleichtern, sondern auch die internationale Attraktivität des deutschen Marktes für Investor*innen erhöhen. Gleichzeitig könnte Deutschland seine Position im globalen Wettbewerb stärken und als führender Standort für Innovationen und Wachstum etabliert werden.
7. Innovationspotenzial voll ausschöpfen: Reformen für eine starke Zukunft
Um das Innovationspotenzial Deutschlands und Europas voll auszuschöpfen, sind tiefgreifende Reformen notwendig. Der Zugang zu Kapital muss gestärkt und staatliche Initiativen enger mit privatem Engagement verzahnt werden. Eine ganzheitliche Gründungsförderung, die Bildung, Diversität und den Transfer wissenschaftlicher Innovationen einbezieht, ist ebenso wichtig wie die gezielte Bekämpfung des Fachkräftemangels und der Abbau überbordender Bürokratie.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen – von der Förderung eines unternehmerischen Mindsets über die Verbesserung steuerlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen bis hin zur Stärkung des Wagniskapitalmarkts – bieten konkrete Ansätze, um das europäische Start-up-Ökosystem auf ein neues Level zu heben. Diese Schritte sollen nicht nur den Marktzugang erleichtern, sondern auch die Innovationskraft in zentralen Zukunftsbereichen wie ClimateTech und DeepTech fördern.
Es bleibt jedoch klar, dass die Möglichkeiten des Staates begrenzt sind, auch wenn sie noch nicht vollständig ausgeschöpft wurden. Die Verantwortung, in Innovationen zu investieren, liegt in erster Linie bei der Privatwirtschaft. Die Zeiten, in denen Deutschland auf den Errungenschaften seiner industriellen Vergangenheit ausruhen konnte, sind vorbei. Stattdessen erfordert die Zukunft aktives Handeln und Investitionen in Technologie, Bildung und unternehmerische Netzwerke.
Deutschland und Europa stehen vor großen Herausforderungen, aber auch vor einer einzigartigen Chance. Durch eine enge Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft können die Innovationskraft und wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit der EU langfristig gesichert werden. Diese Schritte würden Europa als führenden Standort für Unternehmertum und Technologie positionieren und die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Kontext erheblich steigern.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Marble Imaging erhält 5,3 Mio. Euro, um Europas Zugang zu hochauflösenden Erdbeobachtungsdaten voranzutreiben
Das 2023 von Robert Hook, Dr. Gopika Suresh und Alexander Epp gegründete Marble Imaging ist ein Erdbeobachtungsunternehmen aus Bremen, das eine Konstellation von sehr hochauflösenden Satelliten betreiben wird.

Neben dem High-Tech Gründerfonds (HTGF) hat Marble Imaging zudem eine starke Gruppe weiterer Investor*innen gewonnen, die die Mission teilt. Dazu gehören BAB Beteiligungs- und Managementgesellschaft Bremen, Lightfield Equity, Oslo Venture Company, nwk | nwu Beteiligungsgesellschaften der Sparkasse Bremen, Sentris Capital, Auxxo Female Catalyst Fund und SpaceFounders.
Die Investition soll es Marble ermöglichen, das Entwicklungsteam deutlich auszubauen und die Fertigstellung seiner Intelligence-, Maritime- und Befahrbarkeits-Tools voranzutreiben – Lösungen, die bereits erste Kund*innen bedienen und nun für den breiten kommerziellen Rollout vorbereitet werden. Zudem unterstützt die Investition den Aufbau der End-to-End-Datenverarbeitungskette sowie des Kund*innenportals, um eine nahtlose Nutzer*innenerfahrung sicherzustellen.
Die Finanzierung soll Marble zudem in die Lage versetzen, die schnell wachsende Pipeline an Datenkund*innen zu bedienen und zum Start des ersten Satelliten vollständig kommerziell einsatzbereit zu sein. Darüber hinaus soll sie den Ausbau der operativen Expertise und die Einrichtung eines dedizierten Operationszentrums für die geplante Satellitenkonstellation ermöglichen.
„Wir freuen uns sehr, ein starkes europäisches Investorenkonsortium an Bord zu haben, das das Wachstum unserer Dual-Use-Erdbeobachtungslösungen vorantreibt“, sagt Robert Hook, CEO und Mitgründer von Marble. „Mit dieser Finanzierungsrunde können wir unsere Fähigkeiten deutlich ausbauen, um der rasant steigenden Nachfrage gerecht zu werden.“
Der erste Marble-Satellit, der sehr hochauflösende multispektrale Daten liefern wird, soll im vierten Quartal 2026 starten. Bis Ende 2028 plant Marble Imaging, die eigene Konstellation schrittweise auf bis zu 20 Satelliten auszubauen. Die Nachfrage nach starken und innovativen souveränen Lösungen aus Europa zieht sich inzwischen durch nahezu alle großen Institutionen. Besonders deutlich wird dies in den Bereichen Sicherheit und Climate Tech, wo der Bedarf an schnell verfügbaren, sehr hochauflösenden Erdbeobachtungsdaten und fortschrittlichen KI-gestützten Analysen immer größer wird.
Das Unternehmen, angeführt von den Mitgründer*innen Robert Hook, Dr. Gopika Suresh und Alexander Epp, hat mit dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Marble konnte dabei nicht nur namhafte Business Angels und institutionelle Investor*innen gewinnen, sondern auch großes Interesse führender Venture-Capital-Gesellschaften wecken.
Bereits zuvor hatte das Team für Aufmerksamkeit gesorgt, indem es mehr als 10 Millionen Euro an non-dilutive Funding für die Entwicklung und den Start des ersten Satelliten sicherte – unter anderem durch den DLR Kleinsatelliten Nutzlastwettbewerb und ESA InCubed. Zudem unterstrich das Marble die starke Nachfrage nach hochwertigen europäischen Daten und Analysen mit seinem ersten Ankervertrag im Wert von 3 Millionen Euro im Rahmen des ESA-Programms „Copernicus Contributing Missions“.
Precision Labs: Münchner FoodTech-Start-up sichert sich über 4 Mio. Euro
Das 2023 von Dr. Fabio Labriola, Malte Zeeck und Philipp von Plato gegründete Start-up steht mit seiner Marke Precision für eine neue Generation von Milchprodukten, die hochwertiges Milchprotein und wertvolle pflanzliche Inhaltsstoffe kombiniert.
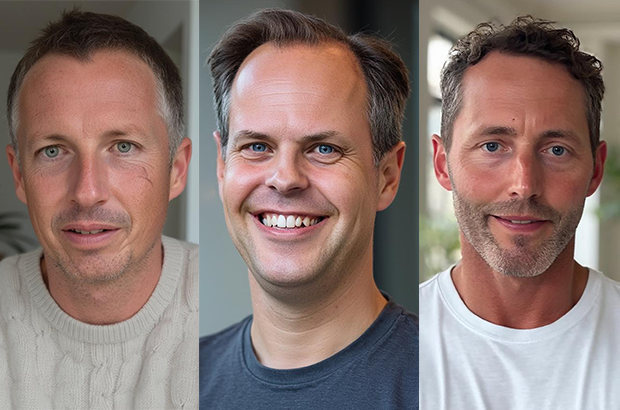
Das Münchner Food-Tech-Startup Precision Labs, Entwickler der nächsten Generation von Milchprodukten, hat seine Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt fließen im Rahmen der Investitionsrunde über vier Millionen Euro in das junge Unternehmen – eine überzeichnete Runde in einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld für Frühphasenfinanzierungen. Zu den Investor*innen zählen die Venture-Capital-Gesellschaft Elemental, Unternehmerpersönlichkeiten wie Stefan Tewes (Gründer Coffee Fellows), Marc-Aurel Boersch (ehemaliger CEO von Nestlé Deutschland) und Mic Weigl (Gründer von More Nutrition) sowie mehrere bekannte Spitzensportler*innen wie Joshua Kimmich und İlkay Gündoğan.
Das frische Kapital will Precision Labs in die Markterschließung in Deutschland und Österreich, die Forschung und Entwicklung weiterer Produkte sowie den Ausbau seiner Marke Precision investieren. „Es ist ein starkes Signal, dass wir unsere Runde in diesem Marktumfeld überzeichnet abschließen konnten“, sagt Dr. Fabio Labriola, Mitgründer von Precision Labs. „Es zeigt, dass Investor*innen und Konsument*innen bereit sind, Milch neu zu denken – indem sie traditionelle Kategorien hinterfragen und innovative Lösungen annehmen.“
Precision Labs steht mit seiner Marke Precision für eine neue Generation von Milchprodukten, die hochwertiges Milchprotein und wertvolle pflanzliche Inhaltsstoffe kombiniert, ganz ohne Konservierungsstoffe. Das erste Produkt, eine Milchalternative, vereint Geschmack, eine cremige Textur und Schäumfähigkeit mit einem überlegenen Nährstoffprofil. Parallel arbeitet das Team an der Entwicklung von vollständig kuhfreien Milchprodukten auf Basis eines naturidentischen Milchproteins das durch Präzisionsfermentation hergestellt wird – einer Technologie, die in den USA, Israel und Singapur bereits zugelassen ist. Die EU-Zulassung wird für 2027 erwartet. „Precision hat das Potenzial, eine neue Kategorie im Milchmarkt zu etablieren“, sagt Marc-Aurel Boersch, Investor und ehemaliger Nestlé Deutschland CEO. „Das Team verbindet unternehmerische Erfahrung mit einer klaren Vision für gesündere und nachhaltigere Ernährung.“
Das Gründer-Trios konnte gleich mehrere Spitzensportler*innen überzeugen, in Precision Labs zu investieren. Zu ihnen zählen die Top-Fußballer İlkay Gündoğan (ehemaliger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft), Serge Gnabry (Mitglied der deutschen Nationalmannschaft) und Joshua Kimmich (Kapitän der deutschen Nationalmannschaft), die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, der Grand Slam Sieger und Impact-Unternehmer Dominic Thiem sowie die Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp. „Wenn ich an meine Sprünge denke, will ich so sauber und kraftvoll wie möglich sein. Und das gilt auch für das, was ich esse und trinke. Precision zeigt, dass man Milch neu denken kann – mit wertvollen Proteinen, einem verbesserten Nährstoffprofil und einer deutlich geringeren Umweltbelastung. Für mich ist das die Ernährung, die zu meinen Werten passt", so Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo über ihre Motivation zu investieren.
Der bundesweite Roll-out der ersten Produkte ist für 2026 geplant, die Expansion nach Österreich soll im selben Jahr folgen.
Gründer*in der Woche: experial – KI-Zwillinge auf Knopfdruck
Klassische Marktforschung ist zeit- und kostenintensiv, bringt aber oft nur unzuverlässige Resultate. Die experial-Gründer wollen das grundlegend ändern.

Wer schon einmal an einer Marktforschungsumfrage teilgenommen hat, weiß: Das ist eine zähe Angelegenheit. Man klickt sich durch Fragebögen, nimmt an Diskussionsrunden teil und erhält zum Schluss (bestenfalls) eine magere Entlohnung.
Für Unternehmen, die solche Befragungen durchführen, besteht genau darin ein Problem: „Es ist schwer, an die gewünschten Zielgruppen heranzukommen, weil keiner mitmachen will“, sagt Tobias Klinke, Co-Gründer des Start-ups experial. „Und wenn doch, dann sind es die falschen.“
Klassische Marktforschung ist ineffektiv
Der promovierte Konsumforscher weiß, wovon er spricht. Für seine wissenschaftliche Arbeit hat er sich jahrelang mit Marktforschungsmethoden beschäftigt und selbst unter der unzureichenden Datenlage aus Zielgruppenbefragungen gelitten. „Man darf sich nichts vormachen: Da sitzen Leute, die Geld verdienen wollen und den Fragebogen so schnell wie möglich abhaken. Relevante Daten lassen sich so nur schwer erheben.“ Denn ob die Antworten tatsächlich das Konsumverhalten widerspiegeln oder die Befragten einfach nur schnell fertig werden oder sich ins rechte Licht rücken wollen, ist kaum auszumachen.
Hinzu kommt: Für die Auftraggebenden sind solche Marktforschungen extrem aufwändig, teuer und langwierig – vom Erstellen des Fragenkatalogs über das Organisieren der Befragung bis hin zur Auswertung der Ergebnisse.
Genau hier setzt experial an: Es möchte Unternehmen besser, schneller und günstiger wissen lassen, was bestimmte Kund*innenprofile zu konkreten Fragestellungen denken, zum Beispiel über ein neues Produktfeature. „Jeder Produkt- oder Marketingmanager hat täglich Entscheidungen zu treffen, für die authentisches Kundenfeedback absolut relevant ist“, so Klinke. Dafür stellt experial in einem klassischen Software-as-a-Service-Modell sogenannte Digital Twins zur Verfügung – digitale Simulationen realtypischer Personen aus der gewünschten Zielgruppe.
Über eine Chat-Funktion können diese digitalen Zwillinge nach Belieben befragt oder interviewt werden. Neben der Darstellung der Umfrageergebnisse in Diagrammen, Tabellen oder Kurztexten ermöglicht das Tool, mit Kund*innenprofilen in Echtzeit zu interagieren, Nachfragen zu stellen, zu diskutieren.
Zielgruppe abbilden statt Persona erfinden
Das Besondere: Statt klassische Personas abzubilden – also ein stereotypisches Bedürfnisbündel einer fiktiven Persönlichkeit –, simuliert experial zum Beispiel 1000 Personen eines bestimmten Adressat*innenkreises, die dann an einer Befragung teilnehmen. So wird eine spezifische Gruppe in ihrer ganzen Meinungsvielfalt abgebildet. „Es geht nicht darum, eine idealtypische Kunstfigur, sondern eben 1000 konkrete Personen zu simulieren. So können wir die ganze Bandbreite an Meinungen innerhalb einer Zielgruppe abbilden“, erläutert Klinke.
Von der Forschung zur Geschäftsidee
Am Anfang stand ein konkretes Problem für die eigene Arbeit. Alle drei Gründer haben ihre Wurzeln in der Forschung. Tobias Klinke und Nader Fadl haben gemeinsam studiert, für Klausuren gebüffelt und später beide promoviert – Klinke in Consumer Research, Fadl in Gamification. Drei Jahre arbeiteten sie bereits zusammen, bevor 2022 die Idee für das gemeinsame Start-up entstand. Als die technische Umsetzung immer komplexer wurde, kam Nils Rethmeier – er hat in Machine Learning promoviert – als dritter Gründer hinzu.
Während sich die drei als Wissenschaftler noch mit der geringen Datenqualität klassischer Marktforschung herumschlugen, wuchsen zeitgleich die Anwendungspotenziale künstlicher Intelligenz (KI). Immer mehr beschäftigte sie die Frage, ob nicht beides kombinierbar wäre. Erste Lösungen suchten Klinke und Fadl zunächst, indem sie große Sprachmodelle (LLMs) mit demografischen Standarddaten aus der Marktforschung fütterten – mit ernüchterndem Ergebnis. „ChatGPT allein eignete sich kaum. Um Zielgruppen in ihrer Vielschichtigkeit zu simulieren, müssen wir viel mehr wissen als Alter, Beruf und Postleitzahl“, so Klinke. So lernten sie, welche Daten für eine realitätsnahe Simulation hilfreich sind und welche nicht. „Relevante Inputs sind eher Persönlichkeitsmerkmale, Werte, Lebensgeschichten. Echte Daten von echten Personen“, so Klinke weiter. Durch den Abgleich mit bestehenden Daten konnten die synthetischen KI-Modelle sukzessive verbessert werden. Die Verwendung von AI Agent Memory brachte dann den ersten Durchbruch: eine Übereinstimmung von 85 Prozent.
Seitdem geht der technologische Fortschritt rasant voran. Heute laufen bei experial verschiedene LLMs im Hintergrund. Das LLM-Ensembling hat den Vorteil, dass je nach Fragestellung die geeignetsten Modelle zum Einsatz kommen, etwa mit oder ohne Reasoning. „Die rationale Begründbarkeit von Antworten ist für unsere Simulationen nicht immer relevant. Menschen entscheiden oft aus dem Bauch heraus“, fügt Fadl hinzu.
Von Wissenschaftlern zu Unternehmern
Klinke und Fadl wussten: Sie sind an etwas dran. Verlässlich simulierte Datensätze würden nicht nur ihrer Forschung zugutekommen, sondern auch vielen Unternehmen. Die zündende (Geschäfts-)Idee kam mitten im Arbeitsalltag. Nach ihrer Zeit an der Uni arbeiteten die beiden in einer Digitalagentur und begleiteten erste Online-Marktforschungsprojekte für größere Kund*innen. Dabei erlebten sie hautnah, wie klassische Marktforschung in der Praxis funktioniert: Ein Marketing- oder Innovationsmanager formuliert eine Fragestellung, schickt sie per E-Mail an die interne Insights-Abteilung und wartet.
Wochen später, oft nach externem Agenturbriefing und einem fünfstelligen Budget, kommen die Ergebnisse zurück – viel zu spät und viel zu teuer für den heutigen Innovationsdruck. „Das war für uns der Moment, an dem wir dachten: Das muss doch anders gehen“, erinnert sich Klinke. Genau zu dieser Zeit erschien ChatGPT. Die Idee war plötzlich greifbar: Warum nicht Zielgruppen simulieren, in Echtzeit, mit KI? Damit war der Grundstein für das Start-up gelegt.
Danach ging es schneller als gedacht. Mit dem steigenden technischen Anspruch war das Projekt nicht mehr eigenständig finanzierbar. „Als wir die ersten Machine-Learning-Researcher brauchten, war klar: Wir müssen Kapital aufnehmen“, so Fadl. Ein Professor, mit dem die Gründer bereits inhaltlich zusammengearbeitet hatten, stieg als erster Business Angel ein. „Durch die persönliche inhaltliche Verbindung zum Thema hat das einfach sehr gut gepasst“, erinnert sich Klinke. „Noch heute treffen wir uns alle vier Monate, um viele Fragestellungen miteinander zu diskutieren.“ Es folgten zwei weitere Angel Investoren und ein halbes Jahr später zwei Venture-Capital-Unternehmen.
Die nächste Generation Digital Twins im Visier
Heute arbeitet das Start-up mit zehn Mitarbeitenden und betreut Teams von Unternehmen wie Fressnapf, Ergo und der Versicherungskammer Bayern. „Der Marktforschungsmarkt ist gigantisch“, so Fadl. „Global liegt der Umsatz bei zirka 150 Milliarden US-Dollar, wovon gut ein Drittel in den USA anfällt. Wir wollen uns in Zukunft verstärkt auf den amerikanischen Raum konzentrieren.“
Die Ziele sind ambitioniert, aber alles andere als unrealistisch. Das Geschäftsmodell von experial hat das Potenzial, die Branche zu verändern. „Studien zeigen eindeutig: Je kundenorientierter Unternehmen handeln, desto profitabler werden sie. Wir wollen Kundenfeedback in die tägliche Arbeit von Entscheider*innen integrieren. Mit klassischer Marktforschung ist das nicht möglich“, so Klinke.
Und noch einen Vorteil sehen die Gründer in ihrem Modell: Bisherige Versuche, neue Technologien für die Branche zu nutzen, zielten darauf ab, die Marktforscher*innen zu ersetzen. Experial denkt anders: Nicht die Forschenden sollen ersetzt werden, sondern die Befragten, die ohnehin keine Lust darauf haben.
Künftig wird es zudem entscheidend sein, mit den technischen Entwicklungen Schritt zu halten. Dementsprechend will experial die eigenen Digital Twins weiterentwickeln. Die neue Generation soll „sehen“ und „hören“ können, um etwa Websitedesigns und Videos zu bewerten – ein weiterer Schritt mit immensem Potenzial. Ende des Jahres startet dafür eine weitere Finanzierungsrunde. Man darf also gespannt sein, wo die unternehmerische Reise von Tobias Klinke, Nader Fadl und Nils Rethmeier noch hinführen wird.
Donnerstag.ai erhält 4,3 Mio. Euro Seed-Finanzierung
Donnerstag.ai bietet eine KI-gestützte Plattform für Forderungsmanagement, die speziell für Lieferant*innen konzipiert ist. Ziel ist es, Zahlungsausfälle zu vermeiden und volle Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.

Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai – 2025 in Frankfurt am Main von Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan gegründet – verbindet Leistungs-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten aus bestehenden Systemen, erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit und automatisiert die Abstimmung von Transaktionen über einen positionsgenauen Abgleich (Line-by-Line Reconciliation). Auf Basis künstlicher Intelligenz und autonomer KI-Agenten schafft Donnerstag.ai volle Transparenz über offene Posten, ermöglicht präzises KPI-Reporting und unterstützt ein aktives Forderungsmanagement zur Steuerung von Liquidität und Risiko.
Die Software verbindet Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen, erkennt Abweichungen in Echtzeit und gleicht Tausende von Transaktionen automatisch ab. Ihr intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziert fehlende Positionen und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen. Durch kontinuierliches Lernen aus den Datenmustern jedes Kunden wird das System zunehmend präziser und verwandelt Abstimmungsprozesse in eine proaktive, intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens.
„Jedes Jahr gehen Lieferanten Milliarden verloren, weil sie keinen klaren Überblick darüber haben, was geliefert, abgerechnet und bezahlt wurde“, sagt Barbaros Özbugutu, Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai. „Mit unserer KI-Plattform aus Deutschland schaffen wir Transparenz in einer Branche, die für Europas Wettbewerbsfähigkeit zentral ist.“
Erfahrenes FinTech-Team trifft auf starke Investor*innen
Hinter Donnerstag.ai stehen die Gründer Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan, die beide langjährige Erfahrung im europäischen FinTech-Sektor mitbringen. Özbugutu war zuvor als Deutschlandchef bei Klarna tätig und war Mitgründer sowie CEO des Zahlungsdienstleisters iyzico. Dieser wurde 2019 von Prosus/Naspers übernommen. Der erfolgreiche Exit zählt zu den größten Fintech-Akquisitionen in der Türkei.
„In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz ERP- und Finanzsysteme grundlegend neu definiert, schafft Donnerstag.ai eine völlig neue Kategorie, die bislang technisch nicht adressiert werden konnte”, sagt Stefan Klestil, General Partner bei Speedinvest. „Barbaros und Volkan verbinden Produktkompetenz, strategisches Denken und Umsetzungsstärke auf einzigartige Weise. Wir sind stolz, als Lead-Investor Teil dieser Runde zu sein und gemeinsam mit Donnerstag.ai die Zukunft der europäischen Finanztechnologie zu gestalten.“
Donnerstag.ai will auch mithilfe des frischen Kapitals seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen mit dem Ziel, sicheres Forderungsmanagement europaweit anzubieten.
Kölner EdTech-Start-up skulio sichert sich sechsstelliges Funding
Das EdTech-Start-up skulio hat sich ein sechsstelliges Funding im Rahmen des exist Programms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) und der Europäischen Union gesichert.

Die skulio-Gründer Elias Perez und Teoman Köse möchten mithilfe von künstlicher Intelligenz Lehrkräfte bei der Unterrichtsvorbereitung entlasten und Schüler*innen individuell fördern.
Mit der Finanzierung wird das Start-up aus Köln nun bei der Weiterentwicklung seiner KI-Lösung für Schulen unterstützt. Das Ziel der Gründer ist es, jede Lehrkraft dabei zu unterstützen, das Beste aus sich herauszuholen, Schüler*innen individuell und inklusiv zu fördern und die Bildung zu verbessern.
„Die Heterogenität in Schulklassen ist enorm groß und dennoch wird kaum individuell gefördert. Mit unserer Lösung ermöglichen wir es Lehrkräften viel Zeit zu sparen und ihre Schüler*innen gezielt auf ihre Bedürfnisse zu fördern. Das ist ohne unsere KI in der Praxis momentan gar nicht umsetzbar”, sagt Elias Perez, Mitgründer von skulio.
Der offizielle Launch von skulio ist für das Frühjahr 2026 geplant. Schulen haben die Möglichkeit, eine Schullizenz für ihr Kollegium zu erwerben, während Lehrkräfte auch Einzellizenzen nutzen können. Bereits jetzt führt Elias Perez Gespräche mit interessierten Schulen aus ganz Deutschland, die ihre innovative KI-Lösung künftig einsetzen möchten. Schulen aus jedem Bundesland können sich bei Interesse direkt an Elias Perez wenden.
Das exist Programm fördert innovative, technologieorientierte und wissensbasierte Gründungsvorhaben aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Ziel des Programms ist es, die Gründungskultur in Deutschland zu stärken und den Transfer von Forschung in marktfähige Produkte zu beschleunigen.
KI-Plattform Cellbyte sammelt 2,75 Mio. US-Dollar ein
Das 2024 von Felix Steinbrenner, Daniel Vidal Moreira und Samuel Moreira gegründete KI-Start-up unterstützt Pharmaunternehmen dabei, neue Medikamente weltweit effizienter und schneller auf den Markt zu bringen.

Die unübersichtliche Datenlandschaft und viele zeitintensive manuelle Prozesse in der Pharmaindustrie führen dazu, dass es nach der Zulassung über ein Jahr dauern kann, bis neu entwickelte, lebensrettende Medikamente zu den Patientinnen und Patienten gelangen, die sie benötigen. Market Access-, Pricing-, HTA- und HEOR-Teams haben die mühsame Aufgabe, Unterlagen für die behördliche Zulassung sowie Strategien für die Preisgestaltung und Erstattung von Medikamenten zu erstellen. Vor diesem Hintergrund geben Pharmaunternehmen oft ein Vermögen aus, um Zugang zu wichtigen Preis- und Marktdaten zu erhalten, oder beauftragen Dritte mit der Vervollständigung dieser Daten.
Cellbyte hat eine KI-Plattform für Teams entwickelt, die an der Markteinführung von Medikamenten beteiligt sind. Diese ermöglicht es ihnen, mühelos Millionen von Datenpunkten aus klinischen Studien, der Preisgestaltung, HTA (Health Technology Assessments) und regulatorischen Vorgaben sowie aus internen Unternehmensquellen in Echtzeit zu analysieren. Durch die Bereitstellung schneller, zuverlässiger und qualitativ hochwertiger Erkenntnisse hilft Cellbyte dabei, Dokumente zu erstellen, Abläufe für die Markteinführung effizienter zu gestalten und Go-to-Market-Strategien in deutlich kürzerer Zeit zu entwickeln.
Felix Steinbrenner, Co-CEO und Mitgründer von Cellbyte, erklärt: „Der Erfolg des gesamten Lebenszyklus eines Medikaments entscheidet sich in der Einführungsphase. Um die besten Entscheidungen für die Markteinführung zu treffen, sind Erkenntnisse aus Gigabytes an genauen, aktuellen Informationen erforderlich. Die Aufmerksamkeit, die Cellbyte seit seiner Einführung bei einigen der weltweit größten Pharmaunternehmen erlangt hat, zeigt, dass die Branche bereit ist, die Workflows für die Markteinführung von Medikamenten neu zu denken und schnellere, kostengünstigere sowie qualitativ hochwertige Prozesse einzuführen.“
Daniel Moreira, Co-CEO und Mitgründer von Cellbyte, ergänzt: „Während meiner langjährigen Tätigkeit in der Life-Science-Beratung habe ich unzählige Innovationen erlebt, die die klinische Entwicklung verändert haben. Im Bereich Preisgestaltung und Marktzugang basieren Entscheidungen jedoch immer noch zu oft auf manuellen Tätigkeiten und anekdotischer Evidenz, obwohl Informationen im Überfluss vorhanden sind. Generative KI verändert dies nun, und wir sind stolz darauf, diesen Wandel voranzutreiben.“
Das Unternehmen verzeichnet ein rasantes Wachstum. Bereits wenige Wochen nach der Gründung erreichte es einen sechsstelligen Jahresumsatz (ARR) und expandierte in wichtige globale Märkte. Das Team hat bereits einige Verträge mit globalen Pharmaunternehmen wie Bayer abgeschlossen und gewinnt kontinuierlich neue Kund*innen hinzu.
Mit den zusätzlichen finanziellen Mitteln plant Cellbyte, die Anzahl seiner Mitarbeitenden zu verdreifachen und seine Plattform weiter auszubauen, um der wachsenden Kundennachfrage gerecht zu werden. Die Investition soll es ermöglichen, das beachtliche Umsatzwachstum fortzusetzen und das Ziel voranzutreiben, das bevorzugte System für die Einführung neuer Medikamente weltweit zu werden.
EY Startup Academy Award 2025 – the winner is …
Bereits zum neunten Mal hat EY seine EY Startup Academy erfolgreich durchgeführt und beim großen Finale am im TechQuartier Frankfurt das vielversprechendste Start-up gekürt.

Der 9. Jahrgang der EY Startup Academy ist erfolgreich zu Ende gegangen. Gesucht waren Tech-Start-ups und FinTechs, welche die Alpha-Phase durchlaufen haben, bereits ein Minimum Viable Product oder einen Proof of Concept vorweisen können und innerhalb der nächsten 12 Monate eine Finanzierung anstreben.
Die EY Startup Academy ist ein sechswöchiges Programm, bei dem Start-ups die einmalige Chance bekommen, ihr Geschäftsmodell und dessen Hauptkomponenten durch strukturierte Hilfe und Beratung von EY-Expert*innen verbessern zu können. Das Programm findet einmal jährlich von September bis November statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Beim großen Finale am 13.11. im TechQuartier Frankfurt traten die besten Start-ups mit ihren Pitches gegeneinander an – eines davon wurde von der Jury mit dem EY Academy Award ausgezeichnet und darf sich neben einem Preisgeld auch über ein kostenfreies Beratungskontingent freuen.
Den EY Startup Academy Award 2025 gewonnen hat ...
Herita Technologies
Herita Technologies ist ein Fintech-Unternehmen, gegründet von Finanzexperten, Branchenkennern und führenden Industriepartnern. Die gemeinsame Mission: Trade Finance vereinfachen, Abhängigkeiten reduzieren und nachhaltiges Wachstum in allen Branchen fördern. Durch die Verbindung bewährter Handelsinstrumente mit modernster Technologie gestaltet Herita Technologies die globale Handelsfinanzierung neu – digital, effizient und zukunftsorientiert.
Mentcape (zweiter Platz)
Jedes Jahr suchen Millionen von Menschen psychologische Hilfe. Dabei liegt die durchschnittliche Wartezeit für eine Therapie aktuell bei über fünf Monaten. Dies führt zu großem Leid unter den Betroffenen und ist ein echtes gesellschaftliches und ökonomisches Problem. Mentcape ist eine umfassende Psychotherapie-Plattform, die Patient*innen und Therapeut*innen über ein intelligentes, landesweites Ökosystem miteinander verbindet. Die Mission von Mentcape ist es, die psychische Gesundheitsversorgung für alle schneller, smarter und einfacher zugänglich zu machen – und gleichzeitig Therapeut*innen mit innovativen digitalen Tools zu unterstützen, damit sie ihre Arbeit effizienter gestalten können.
Confora Labs (dritter Platz)
Confora Labs entwickelt eine cloudbasierte SaaS-Plattform und erbringt Dienstleistungen für das systematische Testen und Compliance-Assessment von KI-Systemen (zum Beispiel hinsichtlich des EU AI Acts). Die Vision von Confora Labs ist eine Zukunft, in der Unternehmen KI-Systeme sicher, transparent und gewinnbringend einsetzen können – und in der neue Regulierung die aktuelle KI-Transformation nicht behindern, sondern auf ein vertrauenswürdiges Fundament stellen. Confora Labs bietet modulare, cloudbasierte Lösungen zur Bewertung der rechtlichen Konformität, Performance und Sicherheit sowie des tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzens von KI-Systemen.
Das waren die übrigen Finalist*innen
CeraSleeve
CeraSleeve ist ein patentiertes Papieradditiv, das Abfall reduziert, Materialrückgewinnung maximiert und Ressourcen schont. Gleichzeitig unterstützt die preisgekrönte Technologie Partner in der Papierindustrie dabei, Kosten zu senken und Effizienzpotenziale optimal zu nutzen. CeraSleeve wird durch den exist-Forschungstransfer gefördert, ein Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das vom Europäischen Sozialfonds mitfinanziert wird.
DataNXT
DataNXT verwandelt Informationsfluten in quellengeprüfte, auditierbare Finanzreports. Mit Multi-Agenten-KI, (zeitbewusstem) Wissensgraph und deterministischen Checks liefert DataNXT Ergebnisse ohne jegliche Halluzinationen. Auf Wunsch ist die Lösung auch im On-Premises- oder VPC-Betrieb für volle Datenhoheit einrichtbar. In Minuten entstehen interne Themenrecherchen, Kreditrisiko-Berichte und M&A- Analysen mit jeweils vollständigem Quellen- & Audit-Trail.
RagStore AI
RagStore ist ein Generative AI Insights Engine, welcher Wissensarbeiter*innen dabei unterstützt, KI zuverlässig zu nutzen – mit drastisch reduzierten Halluzinationen. Während die meisten KI-Piloten dabei scheitern, messbare Auswirkungen durch ungenaue Antworten zu liefern, stellt RagStore hoch qualitative Antworten durch die Verankerung der Ergebnisse in verifizierte Daten sicher. RagStores geschützte Technologie kombiniert Multi-AI-Faktenprüfung, Integration des Nutzer*innenkontextes und menschliche Überprüfung, um vertrauenswürdige Insights zu gewährleisten. Gegründet von einem Team mit über 25 Jahren Erfahrung in KI, Consulting und Venture Scaling, ist das Tool bereits im Einsatz; das Start-up bereitet derzeit seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde vor.
RedGet.io
RedGet.io ist eine kollaborative Plattform zur Überwachung von Treibhausgasemissionen für Häfen und Terminals aller Größen. Sie automatisiert die Emissionsverfolgung über die Scopes 1, 2 und 3 mithilfe von KI-Agenten – und verwandelt fragmentierte Daten in umsetzbare Erkenntnisse.
R&B Brückenassistant
Das in Heilbronn ansässige AI-FinTech-Start-up unterstützt CFOs öffentlicher Organisationen – insbesondere Museen – bei datenbasiertem Finanzmanagement. Die Webanwendung automatisiert Budgetierung, Planung und Reporting anhand branchenspezifischer Kennzahlen und ermöglicht sektorweites Benchmarking. Durch sichere, anonymisierte Vergleiche zwischen Institutionen identifiziert sie Stärken, Risiken und Optimierungspotenziale – und fördert den Austausch bewährter Praktiken innerhalb des Kulturbereichs. Das Tool schafft Transparenz, erleichtert die Abstimmung mit Förderern und reduziert Verwaltungslasten. Das Gründungsteam vereint über 30 Jahre Erfahrung in Finanzanalyse, IT-Entwicklung und strategischem Kulturmanagement.
Talents2Germany
Die Talents2Germany GmbH möchte den IT-Fachkräftemangel in Deutschland lösen, indem es geprüfte Nicht-EU-Softwareingenieur*innen mit Start-ups und SMEs verbindet. Mit einer Datenbank von über 82.000 qualifizierten Ingenieur*innen kombinieren die Kernprodukte – die neunmonatige Vorbereitung und das Talents4Startups-Programm für Remote-Einstellungen – strukturiertes Training mit KI-gesteuerter Automatisierung, um eine echte Win-Win-Situation für Talente und Arbeitgebende zu schaffen. Ausgezeichnet mit dem BSFZ-Siegel für Innovation und einem BSFZ-Finanzierungsengagement von 1,2 Millionen Euro für die KI-Entwicklung, ist Talents2Germany in der Lage, die Monetarisierung für Arbeitgebende zu skalieren und die Integration globaler Talente in das Innovationsökosystem Deutschlands zu transformieren.
Zubs
Abonnemement-orientierte E-Commerce-Brands stehen weltweit vor einer Herausforderung: Die Abonnement-Technologie steckt in den Kinderschuhen, da bestehende Lösungen zu unflexibel, zu sehr auf den US-Markt ausgerichtet und zu sehr auf den Erstverkauf statt auf Kund*innenbindung fokussiert sind. Zubs bietet eine skalierbare, moderne Plattform für Abonnements und Kund*innenbindung, mit der E-Commerce-Händler*innen durch einzigartige, flexible und automatisierte ZUBScriptions (KI-gestützt, empathisch, nutzerzentriert) einen höheren Customer Lifetime Value erzielen und die Kund*innenabwanderung reduzieren können. Die Vision von Zubs ist es, Subscription-Programme und wiederkehrende Produktverkäufe auf Autopilot zu stellen, damit sich Händler*innen auf ihre Produkte konzentrieren können.
3BrainAI
3BrainAI ist eine AI-basierte Datenplattform und Marketplace Intelligence Suite für den Mittelstand, verwandelt fragmentierte Produktkataloge in konsistente, lokalisierte und prüfbare AI-bereite Daten und veröffentlichen sie sicher auf allen Kanälen über BridgeSync (diff-basiert, idempotent, rollback-fähig). Der Mehrwert entsteht in drei Phasen: Parameter & Kategorisierung, Bestseller & Merchandising sowie Virtuelle Lager & Buy-Box. Die Lösung wird lokal, herstellerneutral und auditierbar in EU-Rechenzentren betrieben. Ergebnis: schnellere und fehlerärmere Listungen, bessere Sichtbarkeit in Filtern, stabilere Margen – heute sichtbar auf Marktplätzen, morgen bereit für AI-Commerce.
Zu jedem Start-up findest du hier ein kurzes Vorstellungs-Video
Alle Infos zur EY Startup Academy findest du hier
Alibaba.com: CoCreate Europe - am 14. November 2025 in London
Auf der größten europäischen B2B-Veranstaltung von Alibaba.com – der CoCreate Europe – erhalten Start-ups und KMU am 14. November 2025 in London im Rahmen eines Wettbewerbs professionelle Unterstützung für die Konzeption innovativer Produkte und Geschäftsmodelle.
Alibaba.com ist ein engagierter Partner für den Mittelstand und setzt sich dafür ein, europäische Unternehmer*innen, Produktentwickler*innen und Entscheider*innen zu stärken. Das Unternehmen fördert das Zusammenspiel von Innovation, Technologie und globalem Handel, um KMU zukunftsfähig zu machen.
Um KMU in einer dynamischen Wirtschaft zu unterstützen, bietet Alibaba.com Zugang zu wertvollen Einblicken und leistungsstarken Tools. Dazu gehören die KI-gestützten Sourcing-Lösungen AI Mode und der Accio-Agent, die den Beschaffungsprozess automatisieren und optimieren. Das globale Lieferantennetzwerk verbindet Einkäufer*innen mit über 200.000 verifizierten Anbietern aus 76 Branchen und 200 Millionen Produkten. Mit Trade Assurance bietet Alibaba.com zudem mehr Sicherheit und Verlässlichkeit in der Lieferkette, was KMU ermöglicht, Zeit zu sparen und sich auf ihr Wachstum zu konzentrieren.
Alibaba.com setzt sich aktiv für die Förderung von KMU ein und stellt Ressourcen zu zentralen Themen wie Kostenoptimierung, dem Aufbau robuster Lieferketten, dem strategischen Einsatz von KI für nachhaltiges Wachstum, internationaler Skalierung sowie zukunftsweisenden Trends bereit. Es werden außerdem vielfältige Möglichkeiten geschaffen, die Verkäufer*innen mit Beschaffungsexpert*innen, Lieferant*innen, Investor*innen, KMU-Influencer*innen und weiteren Branchenakteuren verbinden.
Ein Beispiel für dieses Engagement ist die CoCreate Eventreihe. Nach der erfolgreichen US-Ausgabe in Las Vegas findet die europäische Premiere, das CoCreate Europe Event, am 14. November 2025 in London statt. Im Zuge dieser Initiative können KMU und Start-ups nicht nur von umfassenden Keynotes und Panels zu den genannten Themen profitieren, sondern auch ihre Innovationskraft unter Beweis stellen. Der CoCreate Pitch, der Teil des CoCreate Europe Events in London ist, bietet 30 Finalist*innen die Chance, ihre innovativsten Produktideen vor einer hochkarätigen Jury zu präsentieren und attraktive Preise zu gewinnen – ein klares Zeichen für die aktive Förderung von Innovationen im Mittelstand.
Alibaba.com bietet KMU:
- Exklusive Einblicke in die neuesten Trends – von Künstlicher Intelligenz über Lieferketten-Optimierung bis zu internationalen Skalierungschancen.
- Zugang zu einem globalen Netzwerk: Einkäufer*innen, Lieferant*innen, Investor*innen, Start-ups und Mittelständler – für wertvolle Verbindungen und Kooperationen.
- Bereitstellung von Tools und Services von Alibaba.com – wie dem globalen Lieferantennetzwerk, KI-gestützten Sourcing-Lösungen (z.B. AI Mode und der Accio-Agent) und einem umfassenden Beschaffungsökosystem für nachhaltiges Wachstum.
- Förderung von Innovationen, beispielsweise durch Initiativen wie den CoCreate Pitch, bei dem vielversprechende Ideen eine Plattform erhalten.
Alibaba.com positioniert sich als Partner für KMU auf dem Weg zu globalem Erfolg.
Kölner Start-up alangu sichert sich 400.000 Euro Investment
Das 2022 von Alexander Stricker, Elisabeth André, Norbert Helff und Patrick Gebhard gegründete Unternehmen bietet eine No-Code-Software, die geschriebene Sprache automatisiert in Gebärdensprache überträgt.

Das Kölner Start-up alangu entwickelt eine KI-Lösung, die digitale Inhalte automatisch in Gebärdensprache übersetzt – für echte Barrierefreiheit im Netz. Jetzt hat das Start-up über das Companisto Business Angel Netzwerk rund 400.000 Euro eingesammelt. Neben Companisto beteiligten sich mehrere Co-Investoren an der Finanzierungsrunde. Das Kapital dient der Weiterentwicklung der KI-basierten Übersetzungstechnologie für Gebärdensprache und der Skalierung auf dem europäischen Markt.
Alangu bietet eine No-Code-Software, die geschriebene Sprache automatisiert in Gebärdensprache überträgt. Digitale Avatare übersetzen Inhalte in Deutsche Gebärdensprache (DGS) und lassen sich als Videos direkt auf Websites einbinden. So werden digitale Informationen erstmals umfassend für gehörlose Menschen zugänglich. Bereits mehr als 175 Kommunen nutzen die Lösung. Seit der Gründung erzielte alangu nach eigenen Angaben rund eine Million Euro Umsatz.
Die gesellschaftliche Bedeutung ist groß, da für gehörlose Menschen die Gebärdensprache ihre Muttersprache ist, während die geschriebene Textsprache für sie eine Fremdsprache darstellt. Digitale Informationen sind für sie daher oft nur eingeschränkt zugänglich. Rund 80 Prozent der Gehörlosen können Texte gar nicht oder nur schwer verstehen, da Lesen in der Regel über Lautsprache vermittelt wird. Gleichzeitig verpflichtet die Europäische Union ihre Mitgliedstaaten, digitale Texte künftig auch in Gebärdensprache anzubieten – zunächst für öffentliche Institutionen, seit Juni 2025 auch für Unternehmen.
Mit dem Investment will alangu die Echtzeit-Übersetzung weiterentwickeln. Ziel ist eine automatisierte Gebärdensprach-Übersetzung ähnlich wie bei Text-Tools wie Google Translate oder DeepL. Langfristig sollen Avatare Dialoge in Echtzeit führen können. Zudem plant das Startup, seine Marktposition im öffentlichen Sektor und in der Privatwirtschaft weiter auszubauen.
Alangu hat sich bereits als Vorreiter für digitale Barrierefreiheit etabliert. Das Start-up überzeugte nicht nur in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“, wo es seine KI-gestützte Lösung einem breiten Publikum präsentierte, sondern wurde auch mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Corporate Digital Responsibility Award 2024 in der Kategorie Digitales Wohlbefinden und Inklusion sowie dem Digital Media Award 2024 in der Kategorie Digitale Innovation oder durch das „Seal of Excellence“, mit dem die Europäische Kommission herausragende Hightech-Unternehmen für ihre Innovationskraft auszeichnet. Erst vergangene Woche erhielt alangu außerdem den WiNa Tech-Award 2025 der Kölner Stadt-Anzeiger Medien für seine KI-basierte Gebärdensprach-Übersetzung – eine Auszeichnung für herausragende digitale Innovation und Inklusion.
„Der erfolgreiche Abschluss der ersten Runde auf Companisto zeigt das große Interesse an digitaler Inklusion. Wir sind begeistert vom Vertrauen und der Unterstützung der Companisto-Community. Hier entsteht nicht nur Finanzierung, sondern ein starkes Netzwerk, das unsere Vision einer barrierefreien digitalen Welt teilt und aktiv mitgestaltet“, so Alexander Stricker, alangu-CEO.
EY Academy Award 2025: Das sind die Finalisten
Der 9. Jahrgang der EY Startup Academy geht auf die Zielgerade. Auch diesmal wird beim großen Finale am 13. November im TechQuartier Frankfurt ein Start-up von einer Jury mit dem EY Academy Award ausgezeichnet. Das ausgezeichnete Start-up erhält neben einem Preisgeld auch ein kostenfreies Beratungskontingent.

Diese Start-up sind für den finalen Pitch Contest beim Closing der EY Startup Academy am 13. November 2025 in Frankfurt nominiert:
Zu jedem Start-up findet ihr hier ein kurzes Vorstellungs-Video
CeraSleeve
CeraSleeve ist ein patentiertes Papieradditiv, das Abfall reduziert, Materialrückgewinnung maximiert und Ressourcen schont. Gleichzeitig unterstützt die preisgekrönte Technologie Partner in der Papierindustrie dabei, Kosten zu senken und Effizienzpotenziale optimal zu nutzen. CeraSleeve wird durch den exist-Forschungstransfer gefördert, ein Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, das vom Europäischen Sozialfonds mitfinanziert wird.
Confora Labs
Confora Labs entwickelt eine cloudbasierte SaaS-Plattform und erbringt Dienstleistungen für das systematische Testen und Compliance-Assessment von KI-Systemen (zum Beispiel hinsichtlich des EU AI Acts). Die Vision von Confora Labs ist eine Zukunft, in der Unternehmen KI-Systeme sicher, transparent und gewinnbringend einsetzen können – und in der neue Regulierung die aktuelle KI-Transformation nicht behindern, sondern auf ein vertrauenswürdiges Fundament stellen. Confora Labs bietet modulare, cloudbasierte Lösungen zur Bewertung der rechtlichen Konformität, Performance und Sicherheit sowie des tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzens von KI-Systemen. Unternehmen arbeiten mit Confora Labs, weil das Start-up Technologie, Regulierung und KI-Ethik nicht nur verstehet, sondern optimal verbindet – und KI-Governance von einer regulatorischen Pflicht in einen echten Wettbewerbsvorteil verwandelt.
DataNXT
DataNXT verwandelt Informationsfluten in quellengeprüfte, auditierbare Finanzreports. Mit Multi-Agenten-KI, (zeitbewusstem) Wissensgraph und deterministischen Checks liefert DataNXT Ergebnisse ohne jegliche Halluzinationen. Auf Wunsch ist die Lösung auch im On-Premises- oder VPC-Betrieb für volle Datenhoheit einrichtbar. In Minuten entstehen interne Themenrecherchen, Kreditrisiko-Berichte und M&A-Analysen mit jeweils vollständigem Quellen- & Audit-Trail.
Herita Technologies
Herita Technologies ist ein Fintech-Unternehmen, gegründet von Finanzexperten, Branchenkennern und führenden Industriepartnern. Die gemeinsame Mission: Trade Finance vereinfachen, Abhängigkeiten reduzieren und nachhaltiges Wachstum in allen Branchen fördern. Durch die Verbindung bewährter Handelsinstrumente mit modernster Technologie gestaltet Herita Technologies die globale Handelsfinanzierung neu – digital, effizient und zukunftsorientiert.
Mentcape
Jedes Jahr suchen Millionen von Menschen psychologische Hilfe. Dabei liegt die durchschnittliche Wartezeit für eine Therapie aktuell bei über 5 Monaten. Dies führt zu großem Leid unter den Betroffenen und ist ein echtes gesellschaftliches und ökonomisches Problem. Mentcape ist eine umfassende Psychotherapie-Plattform, die Patient:innen und Therapeut:innen über ein intelligentes, landesweites Ökosystem miteinander verbindet. Die Mission von Mentcape ist es, die psychische Gesundheitsversorgung für alle schneller, smarter und einfacher zugänglich zu machen – und gleichzeitig Therapeuten mit innovativen digitalen Tools zu unterstützen, damit sie ihre Arbeit effizienter gestalten können.
RagStore AI
RagStore ist ein Generative AI Insights Engine, welcher Wissensarbeiter:innen dabei unterstützt, KI zuverlässig zu nutzen – mit drastisch reduzierten Halluzinationen. Während die meisten KI-Piloten dabei scheitern, messbare Auswirkungen durch ungenaue Antworten zu liefern, stellt RagStore hoch qualitative Antworten durch die Verankerung der Ergebnisse in verifizierte Daten sicher. Ragstores geschützte Technologie kombiniert Multi-AI-Faktenprüfung, Integration des Nutzerkontextes und menschliche Überprüfung, um vertrauenswürdige Insights zu gewährleisten. Gegründet von einem erfahrenen Team mit über 25 Jahren an Erfahrung in den Branchen KI, Consulting und Venture Scaling, ist RagStore bereits bei Kund:innen im Einsatz und bereitet derzeit seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde vor. Ragstone ist auf der Mission, KI-Antworten so zuverlässig wie die menschliche Expertise zu machen.
RedGet.io
RedGet.io ist eine kollaborative Plattform zur Überwachung von Treibhausgasemissionen für Häfen und Terminals aller Größen. Sie automatisiert die Emissionsverfolgung über die Scopes 1, 2 und 3 mithilfe von KI-Agenten — und verwandelt fragmentierte Daten in umsetzbare Erkenntnisse.
R&B Brückenassistant
R&B Brückenassistant ist ein in Heilbronn, Baden-Württemberg, ansässiges AI-Fintech-Startup, das CFOs öffentlicher Organisationen – insbesondere Museen – bei datenbasiertem Finanzmanagement unterstützt. Die Webanwendung von R&B Brückenassistant automatisiert Budgetierung, Planung und Reporting anhand branchenspezifischer Kennzahlen und ermöglicht sektorweites Benchmarking. Durch sichere, anonymisierte Vergleiche zwischen Institutionen identifiziert sie Stärken, Risiken und Optimierungspotenziale – und fördert den Austausch bewährter Praktiken innerhalb des Kulturbereichs. Das Tool schafft Transparenz, erleichtert die Abstimmung mit Förderern und reduziert Verwaltungslasten. Das Gründerteam vereint über 30 Jahre Erfahrung in Finanzanalyse, IT-Entwicklung und strategischem Kulturmanagement.
Talents2Germany
Die Talents2Germany GmbH ist ein in Frankfurt ansässiges HR-Tech-Unternehmen, welches den IT-Fachkräftemangel in Deutschland lösen möchte, indem es geprüfte Nicht-EU-Softwareingenieure mit Startups und SMEs verbindet. Mit einer Datenbank von über 82.000 qualifizierten Ingenieuren kombinieren die Kernprodukte — die 9-monatige Vorbereitung und das Talents4Startups-Programm für Remote-Einstellungen — strukturiertes Training mit KI-gesteuerter Automatisierung, um eine echte Win-Win-Situation für Talente und Arbeitgeber zu schaffen. Ausgezeichnet mit dem BSFZ-Siegel für Innovation und einem BSFZ-Finanzierungsengagement von 1,2 Millionen Euro für die KI-Entwicklung ist Talents2Germany in der Lage, die Monetarisierung für Arbeitgeber zu skalieren und die Integration globaler Talente in das Innovationsökosystem Deutschlands zu transformieren.
Zubs
Abonnemement-orientierte E-Commerce-Brands stehen weltweit vor einer Herausforderung: Die Abonnement-Technologie steckt in den Kinderschuhen, da bestehende Lösungen zu unflexibel, zu sehr auf den US-Markt ausgerichtet und zu sehr auf den Erstverkauf statt auf Kundenbindung fokussiert sind. Zubs bietet eine skalierbare, moderne Plattform für Abonnements und Kundenbindung, mit der E-Commerce-Händler durch einzigartige, flexible und automatisierte ZUBScriptions (KI-gestützt, empathisch, nutzerzentriert) einen höheren Customer Lifetime Value erzielen und die Kundenabwanderung reduzieren können. Die Vision von Zubs ist es, Subscription-Programme und wiederkehrende Produktverkäufe auf Autopilot zu stellen, damit sich Händler auf das konzentrieren können, was für sie wirklich wichtig ist: ihr eigentliches Produkt.
3BrainAI
3BrainAI ist eine AI-basierte Datenplattform und Marketplace Intelligence Suite für den Mittelstand in der DACH-Region sowie Mittel- und Osteuropa. 3BrainAIverwandelt fragmentierte Produktkataloge in konsistente, lokalisierte und prüfbare AI-bereite Daten – und veröffentlichen sie sicher aufallen Kanälen über BridgeSync (diff-basiert, idempotent, rollback-fähig). Der Mehrwert entsteht in drei Phasen: Parameter & Kategorisierung (Attribute, Einheiten, kanalspezifische Enums), Bestseller & Merchandising (Top-Produkte, Varianten, Bundles, Lokalisierung DE/PL/CZ/SK) sowie Virtuelle Lager & Buy-Box (Forecasting, Nachbestellpunkte, Preis-Leitplanken). 3BrainAI betreibt die Lösung lokal in EU-Rechenzentren, herstellerneutral und auditierbar. Ergebnis: schnellere und fehlerärmere Listungen, bessere Sichtbarkeit in Filtern, stabilere Margen – heute sichtbar auf Marktplätzen, morgen bereit für AI-Commerce.
CoCareLab sucht digitale Tools für die stationäre Langzeitpflege
Gesucht sind Start-ups und Unternehmen, die gemeinsam mit dem CoCareLab digitale Tools für die stationäre Langzeitpflege entwickeln. Hier gibt’s alle Infos zur Bewerbung und zum Ablauf des Projekts.

Das CoCareLab ist ein Reallabor im Bereich der stationären Langzeitpflege, gefördert durch den Europäischen Sozialfonds (ESF+) im Rahmen des Programmes „soziale Innovation“. Ziel ist es, digitale Lösungen in der Langzeitpflegepraxis interdisziplinär und cocreativ zu entwickeln, zu testen und ihre Praxistauglichkeit zu evaluieren. Dabei arbeiten die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, die Bethanien gGmbH und die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg GmbH zusammen.
Die Mission
- Innovative Pflegetechnologie in der Langzeitpflege: Implementierung digitaler Assistenzsysteme für eine verbesserte Langzeitpflege.
- Bottom-up statt Top-down: Aktive Einbeziehung des Pflegepersonals, um Technologie an die realen Bedarfe anzupassen.
- Nachhaltiges Change-Management: Förderung effektiver Veränderungsprozesse durch den Einsatz bewährter digitaler Lösungen.
Was wird geboten?
- Testumgebung im realen Pflegealltag: Teilnehmende haben die Möglichkeit, ihre Innovation in einem realen Setting in der stationären Langzeitpflege im Haus St. Vinzenz in Braunschweig zu testen.
- Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation: Die Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaft wird das Projekt wissenschaftlich begleiten. Durch die Integration von Forschung wird sichergestellt, dass das Feedback von Anwender*innen in die Weiterentwicklung der digitalen Tools einfließt und so passgenaue und bedarfsgerechte Lösungen entstehen können.
- Sichtbarkeit und Öffentlichkeitsarbeit: Erhöhung der Sichtbarkeit durch die Öffentlichkeitsarbeit der Metropolregion GmbH, mit breiter medialer Präsenz und Zugang zu regionalen und überregionalen Netzwerken, sowie Kontakte in die Politik.
Wer ist gesucht? Was ist gefragt?
Bewerben können sich Start-ups und Unternehmen, die digitale Tools im Bereich der Langzeitpflege (weiter-)entwickeln. Neben den vorgegebenen Use Cases sind auch themenoffene Bewerbungen möglich, die innovative Lösungen für andere Aspekte der stationären Langzeitpflege bieten. Nähere Informationen zu den Use Cases gibt‘s auf Anfrage.
1. Digitale Erfassung von Ernährung in der Langzeitpflege
Zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ernährung in einer Langzeitpflegeeinrichtung wird ein digitales Tool entwickelt, das Pflegefachpersonen beim Ernährungsmanagement und der Essensbestellung unterstützt. Auf Basis eines im Tool hinterlegten Algorithmus werden u. a. individuelle Ernährungsbedarfe, Vorlieben, Unverträglichkeiten und pflegerisch-medizinische Diagnosen berücksichtigt. Das System überprüft und dokumentiert automatisch die Nährstoffversorgung nach aktuellen Leitlinien, ermöglicht ein kontinuierliches Monitoring und erleichtert so Pflege- und Betreuungspersonen den Alltag durch eine nutzerfreundliche, evidenzbasierte Unterstützung.
2. Digitales Notfallmanagement in der Langzeitpflege
Zur Unterstützung des Pflegepersonals in Notfällen bei Bewohnenden wird ein digitales Tool entwickelt, das auf Grundlage evidenzbasierter medizinischer und pflegefachlicher Algorithmen durch die Notfallsituation leitet. Dabei können wichtige Informationen schnell abgerufen, aber auch, u.a. durch Spracheingaben, zeitnah dokumentiert werden. Auf diese Weise können die aktuellen Informationen an bspw. den Rettungsdienst und/oder die Notfallambulanz übermittelt werden und stehen diesen noch vor der weiteren Versorgung zur Verfügung. Die aktuellen Daten werden zusätzlich automatisiert in die bestehende Pflegedokumentation übernommen.
3. Digitale Dokumentation mit Spracheingabe in der Langzeitpflege
Zur pflegefachlichen Unterstützung des Pflegepersonals und zur Verbesserung der Dokumentationsqualität wird ein digitales Tool entwickelt, das Spracheingaben ermöglicht und pflegerische Informationen automatisiert strukturiert erfasst. Pflegefachpersonen können Beobachtungen direkt bei Aufnahme, Wiederaufnahme oder während/nach der Versorgung dokumentieren, wodurch Pflegediagnosen zeitnah und nachvollziehbar abgebildet werden. Das System unterstützt die Zuordnung und Aktualisierung von Pflegediagnosen, standardisiert die Dokumentation und reduziert den administrativen Aufwand. Anstehende Aufgaben werden mit Hinweisen hinterlegt, sowie mittels Erinnerungsfunktion wieder aufgezeigt.
Die Anforderungen
Bewerber*innen müssen die Bereitschaft mitbringen, ihre Lösung kontinuierlich anzupassen und weiterzuentwickeln, basierend auf dem direkten Feedback der Anwender*innen. Auf Grundlage dessen wird eine situative Hospitation empfohlen. Idealerweise sind die digitalen Tools auf mobilen Endgeräten nutzbar.
Der Bewerbungsprozess
Bewerbungen müssen bis spätestens 28.11.2025 unter cocarelab-g@ostfalia.de eingereicht werden.
Beginn der Testphase: 01.04.2026
Alle weiteren Informationen zum Projekt gibt’s online hier
Gründer*in der Woche: syte – eine KI, die das Baurecht versteht
Von einer Strandbar in Sri Lanka zu einem vollvermessenen Deutschland: Wie Matthias Zühlke und David Nellessen eine KI-Software entwickelt haben, die Bebauungspotenziale erkennt und das Baurecht versteht.

Ob für Makler*innen, Banken, Kommunen oder Projektentwickler*innen. Wer verstehen will, was aus einem Gebäude oder Grundstück werden kann, kämpft sich oft durch Wochen voller Anträge, Pläne und verstreuter Datenquellen. Dass es auch anders geht, zeigen die Münsteraner Matthias Zühlke und David Nellessen. Ihre Lösung: eine Plattform, die auf Knopfdruck zeigt, welches unentdeckte Potenzial in einem Objekt steckt – energetisch, baurechtlich, wirtschaftlich. Ihr Ziel: Prozesse vereinfachen, Entscheidungen beschleunigen, CO₂-Emissionen senken. „Wir wollen dazu beitragen, ungenutzte und versteckte Potenziale leichter zu ermitteln und nachbarschaftsverträglich Wohnraum schaffen“, sagt Matthias Zühlke, CEO und Mitgründer von syte.
Zwei Wege, ein Ziel
Die Idee entstand nicht im Konferenzraum, sondern in einer Strandbar in Sri Lanka, fernab deutscher Bebauungspläne. 2019 traf Architekt Matthias, zu diesem Zeitpunkt Geschäftsführender Partner in einem Architekturbüro, im Urlaub auf seinen alten Sandkastenfreund David Nellessen, der sich gerade auf Weltreise befand. „Ich habe erzählt, wie absurd lange und teuer Baurechtsprüfungen sind und David hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen“, erinnert sich Matthias. Während eines Sabbatjahres 2020 half Matthias dann beim Bau eines Kulturzentrums in Ecuador. Die Reise gab ihm die Möglichkeit, fernab des Alltags neue Ideen zu entwickeln. Zurück in Deutschland wuchs sein Frust: über die Ineffizienz von klassischen Planungs- und Entwicklungsprozessen. „Oft werden Monate in Projekte investiert, ohne zu wissen, ob das Projekt wirtschaftlich tragfähig ist“, sagt Matthias. Dabei sind die Daten längst da. Die eigentliche Hürde liegt in ihrer fehlenden Verknüpfung.
Wer analysieren will, ob sich eine Sanierung, Umnutzung oder Bebauung lohnt, muss eine Vielzahl von Informationen zusammentragen – von Bebauungsplänen über Energieverbräuche und Fördermöglichkeiten bis hin zu Bodenrichtwerten. Wochenlange manuelle Recherche ist Standard. Matthias wollte das ändern und war überzeugt, dass Technologie ein zentraler Schlüssel dafür ist. Daher intensivierten er und der studierte Mathematiker David, der bereits erfolgreich die Location Messenger App Familionet gegründet und 2017 an Daimler verkauft hatte, ihren Austausch. Gemeinsam begannen sie, an der Idee zu arbeiten und gründen 2021 ihr PropTech syte.
Eine Plattform, die das Baurecht versteht
Die Idee hinter syte: eine KI-basierte Plattform, die automatisiert analysiert, was mit einem Gebäude oder Grundstück möglich ist. Nicht nach Bauchgefühl, sondern datenbasiert. Innerhalb von Sekunden ermittelt die KI das Bebauungs-, Energie- und Sanierungspotenzial jeder beliebigen Adresse in Deutschland. Die Grundlage dafür bilden über 300 Terabyte amtlicher Geodaten, darunter Satelliten-, Kataster- und LiDAR-Daten, sowie Marktdaten zu Mieten oder Kaufpreisen. Aus der Kombination dieser Datentypen entsteht ein digitaler Zwilling, der die jeweiligen Grundstücke und Immobilien als präzises Modell abbildet. Die Plattform erkennt Bebauungspotenziale, stellt Wirtschaftlichkeitsberechnungen an, bewertet Förderoptionen und erstellt automatisiert Sanierungspläne. „Man gibt eine Adresse ein und erhält direkt einen Überblick über mögliche Maßnahmen samt Kosten. Das spart Zeit und hilft, schneller ins Machen zu kommen“, erklärt Matthias.
Auch wenn das Gutachten am Ende weiter vom Menschen kommt, der zeitliche Aufwand bei der Entscheidungsfindung sinkt drastisch. Statt Wochen manueller Recherchearbeit können Daten auf Knopfdruck abgerufen werden. „Wir haben eine KI entwickelt, die das Baurecht versteht“, sagt David.
Dafür wurde die Plattform mit 20.000 Gebäude- und Grundstücksdaten trainiert. Was einfach klingt, ist aufwändig. Zwar stehen die meisten Daten als Open Source zur Verfügung, die Datenlandschaft ist jedoch fragmentiert. Was fehlt, ist eine zentrale Gebäudedatenbank und eine übergreifende Infrastruktur, die Informationen systematisch zusammenführt. David betont: „Die Daten zu besorgen, war mühsam. Die technologischen Möglichkeiten sind da, entscheidend für den flächendeckenden Einsatz sind allerdings auch politische und organisatorische Rahmenbedingungen.“
Ein Hebel für effizientes Bauen und Sanieren
Besonders spannend ist die neue Technik für Projektentwickler*innen und Makler*innen, da diese mithilfe von KI schnell und einfach einschätzen können, ob sich ein Projekt wirklich lohnt. Sie hilft bei der Beantwortung wichtiger Fragen, etwa: Wo kann ein Gebäude um eine Etage erweitert werden, sodass zusätzlicher Wohnraum entsteht? Welche Sanierungspotenziale sind vorhanden, um beispielsweise die Energieeffizienz zu erhöhen? Und welche Maßnahmen steigern den Wert eines Objekts – ökologisch wie wirtschaftlich?
„Wir wissen, wo noch Platz zum Bauen ist“, bringt es Matthias auf den Punkt. „Indem wir Potenziale aufdecken und Prozesse beschleunigen, tragen wir dazu bei, Deutschlands Energieeffizienz zu verbessern und gleichzeitig den Wohnraummangel zu lindern.“ Ein wichtiger Schritt, denn fast die Hälfte aller Gebäude hierzulande weist die Energieeffizienzklasse E bis H auf und gilt somit als ineffizient. Zudem fehlen bundesweit mehr als eine halbe Million Wohnungen.
Neben der klassischen Gebäude- und Grundstücksanalyse ermöglicht die Plattform mit dem „Portfolio-Scan“ auch die Bewertung ganzer Bestände. Ebenfalls werden Berechnungen zu öffentlichen Förderprogrammen integriert, um Sanierungsentscheidungen nicht nur schneller, sondern auch wirtschaftlich sicherer zu machen. Somit hilft syte, sich im Fördermitteldschungel zurechtzufinden. Mit der neuen Funktion „syte Build“ lassen sich zudem Flurstücke per Klick kombinieren und Bebauungs- sowie Nutzungsszenarien schnell und einfach simulieren.
Von Münster in die Welt
In nur vier Jahren hat sich syte zu einem führenden PropTech entwickelt, beschäftigt über 30 Mitarbeitende und überzeugt auch namhafte Investor*innen: 8,2 Mio. Euro konnte das Start-up seit Gründung einsammeln, zuletzt knapp fünf Millionen Euro in einer Seed-Runde, die von den Unternehmen der Schwarz Gruppe angeführt wurde. Bereits 2023 wurde das PropTech mit dem Deutschen KI-Preis ausgezeichnet. 2024 folgten der Gewinn des AI Startup Awards und der Gesamtsieg des PropTech Germany Awards, den syte schon 2023 in der Kategorie „Projektentwicklung & Smart City“ gewinnen konnte. Vor Kurzem erhielt das junge Unternehmen zudem den ZIA PropTech of the Year Award.
Mit der deutschlandweiten Verfügbarkeit seit Anfang des Jahres ist ein großer Meilenstein geschafft. Nun sollen weitere Wachstumsschritte folgen. „Bis 2028 möchten wir syte als zentrale Plattform für die Bewertung und Entwicklung von Immobilien in Europa und den USA etablieren“, so Matthias. Die nötigen Daten liegen in vielen europäischen Ländern bereits vor, oft sogar zugänglicher als in Deutschland.
„Stadtentwicklung darf keine Blackbox mehr sein“, sagt David. „Wir brauchen eine datenbasierte Grundlage für jede Entscheidung. Nur so kann Planung effizienter, nachhaltiger und transparenter werden.“ Technologie ist kein Selbstzweck, sondern Voraussetzung, um zukunftsweisend zu bauen und zu sanieren.
Matthias betont: „Wenn wir es mithilfe von Technologie schaffen, schneller bessere Entscheidungen zu treffen und dadurch die Baukosten zu senken, dann ist schon viel gewonnen.“ Was als Idee zweier Sandkastenfreunde am Strand von Sri Lanka begann, ist heute ein gefeiertes Tech-Start-up. Und die Immobilienwirtschaft? Die bekommt mit syte ein Werkzeug, das neue Gestaltungsräume schafft. Für mehr Tempo und mehr Mut zur Entwicklung.
Der Ultimate Demo Day 2025 – Europas größter Demo Day
Am 11. Dezember schlägt das Herz der europäischen Start-up-Szene in München. Der Ultimate Demo Day 2025 bringt Gründer*innen, Investor*innen, Unternehmen und Innovator*innen für einen Tag voller Pitches, Inspiration und wertvoller Kontakte zusammen. Das erwartet dich vor Ort.
Der größte Demo Day Europas
Mehr als 60 Start-ups, Weltklasse-Speaker*innen und unzählige Möglichkeiten, deine(n) perfekte(n) Business-Partner*in zu finden, warten auf dich beim Ultimate Demo Day 2025 im Munich Urban Colab.
Das erwartet dich auf der Bühne:
● Helmut Schönenberger, Mitgründer und CEO der UnternehmerTUM, eröffnet den Tag.
● Jan Goetz, CEO & Co-Founder von IQM Quantum Computers, im Impulsvortrag und Interview mit Stefan Drüssler.
● Ariane Hingst, ehemalige Profi-Fußballspielerin, Trainerin und Speakerin, mit ihrem Vortrag über Performance, Resilienz und Impact.
Anya Braithwait, Project Manager bei der DLD Conference, wird als erfahrene Moderatorin durch den Tag führen.
Im Fokus: cleveres Matching, effektives Networking
Beim Ultimate Demo Day 2025 dreht sich allerdings nicht alles um das exklusive Bühnenprogramm. Der Ultimate Demo Day ist ein Event, das auf Verbindung ausgelegt ist: cleveres Matching, effektives Networking und die einmalige Chance, die Menschen kennenzulernen, die deine Innovationsreise auf die nächste Stufe heben können. Wer weiß: Dein nächstes Portfolio-Start-up, dein(e) nächste(r) Investor*in oder Projektpartner*in könnte hier auf dich warten.
Prof. Dr. Helmut Schönenberger: „Der Ultimate Demo Day zeigt eindrucksvoll, welche Innovationskraft in unserem Ökosystem steckt. Wenn Start-ups, Investorinnen und Investoren sowie Industriepartner an einem Ort zusammenkommen, entstehen Lösungen, die unsere Zukunft maßgeblich gestalten.“
Auf einen Blick: Das erwartet dich beim Ultimate Demo Day 2025 am 11. Dezember 2025 im Munich Urban Colab:
● Inspirierende Keynotes, die neue Perspektiven eröffnen.
● Cleveres Matchmaking & Networking mit Investor*innen, Unternehmen und Partner*innen.
● Über 60 Start-up-Live-Pitches – mutige Visionen und Top-Innovationen, die man nicht verpassen möchte.
Hier erfährst du mehr über den Ultimate Demo Day 2025, den größten Demo Day Europas – inkl. Tickets und Ablauf des Events.
Der Ultimate Demo Day 2025 wird von UnternehmerTUM, UnternehmerTUM Funding for Innovators, TUM Venture Labs, UVC Partners, XPLORE, XPRENEURS, dem UnternehmerTUM Investor Network, dem Munich Urban Colab, der EIT Urban Mobility Initiative, der Boston Consulting Group, SAP und MakerSpace unterstützt.