Aktuelle Events
InsurTech Hub Munich integriert Gründerinnen-Netzwerk One Mission
One Mission, eine 2019 gegründete Initiative zur Förderung der Geschlechterdiversität im deutschen Start-up-Ökosystem, wird Teil des InsurTech Hub Munich (ITHM).
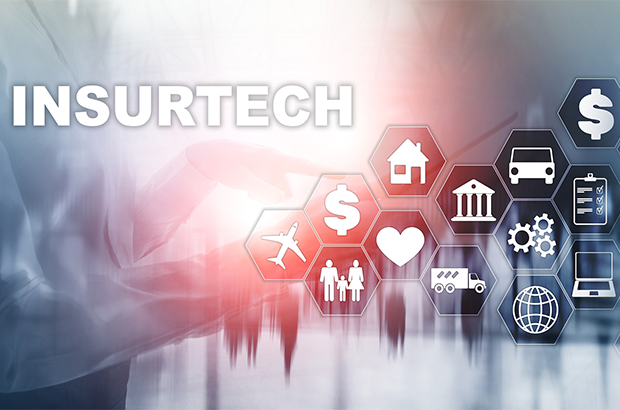
Der ITHM wird One Mission dabei unterstützen, den Anteil von Unternehmensgründungen durch Frauen zu steigern. One Mission zielt darauf, dass bis zum Jahr 2025 ein Viertel aller Start-ups in Deutschland von Frauen gegründet werden sollen (#25to25). Das Bayerische Wirtschaftsministerium fördert das ITHM-Projekt im Jahr 2023 über seine Gründerland-Bayern-Initiative.
Der InsurTech Hub Munich hat seit seiner Gründung vor mehr als fünf Jahren eine diverse Community von über 600 Start-ups aufgebaut. Die in München beheimatete und global agierende Innovationsplattform der Versicherungswirtschaft entwickelt ihre Diversitätsstrategie nun mit der Eingliederung von One Mission weiter. Gemeinsam mit One Mission wird der ITHM Gründerinnen gezielt fördern, verschiedene Projekte zur Steigerung des Frauenanteiles bei Unternehmensgründungen in München und Bayern vernetzen, erfolgreichen Unternehmensgründerinnen eine Plattform geben, um sie als Rollenmodell sichtbar zu machen, und das Bewusstsein für die Attraktivität von Unternehmensgründungen im Versicherungsbereich und im versicherungsnahen Spektrum steigern.
„Der InsurTech Hub Munich hat von Beginn an großen Wert auf Genderdiversität und die Förderung von Unternehmensgründerinnen gelegt. Jetzt haben wir mit der Integration von One Mission dieses Thema nochmals auf eine neue Ebene gehoben. Als Querschnittsbranche mit strategischen Verbindungen zu unterschiedlichsten Industrien eignet sich der Versicherungssektor und das Innovations-Ökosystem des ITHM zur Förderung unterschiedlichster Geschäftsmodelle. Wir sind davon überzeugt, dass viele Gründerinnen und deren Start-ups von den Formaten und Programmen des ITHM profitieren werden“, kommentiert Kathrin Schwidder, Mitglied im ITHM-Vorstand und Head of Strategy and Lifetime Partner Transformation bei der Generali Deutschland AG.
„Mit dem ITHM haben wir seitens One Mission einen perfekten Partner gefunden, um mehr Geschlechterdiversität im deutschen Start-up-Ökosystem zu erreichen. In den Start-up-Programmen des ITHM waren bislang schon durchschnittlich knapp 20 Prozent Gründerinnen vertreten. Den Anteil wollen wir nochmal deutlich steigern und damit eine Signalwirkung für mehr Female Entrepreneurship erreichen“, sagt Marlene Eder, die One Mission gemeinsam mit Vanessa Provenzano und Maike Wursthorn vor drei Jahren gegründet hat.
„Mehr Frauen als Gründerinnen und Unternehmerinnen: Dieses Ziel des InsurTech Hub München unterstützen wir gern. Deshalb fördern wir dieses Jahr auch die Initiative OneMission. Das Projekt ist die richtige Ergänzung zu unserer Dachkampagne Gründerland Bayern. Ich bin überzeugt: Der Standort Bayern wird noch besser, wenn es uns gelingt, mehr Frauen für das Unternehmertum zu begeistern", sagt Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
11 Mio. Euro für Physical AI: Wie FLEXOO Hardware zum Sprechen bringen will
Das Heidelberger Sensorik-Start-up FLEXOO hat eine Series-A-Finanzierungsrunde über 11 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Kapital plant FLEXOO die internationale Skalierung seiner Sensorplattform für Batterie-Speichersysteme und die Automobilindustrie.

Vom Forschungsprojekt zum DeepTech-Unternehmen
Hinter dem ambitionierten Vorhaben steht ein fünfköpfiges Gründerteam, das akademisches Know-how mit industriellem Anspruch verbinden will. Geführt wird das Heidelberger Unternehmen von Founding CEO und Managing Director Dr. Michael Kröger. Zum Gründungsteam gehören zudem Sieer Angar (Chairman of the Board), Dr. Mathieu Turbiez (Chief Revenue Officer), Dr. Jean-Charles Flores (Director Market Development North America) und Dr. Janusz Schinke (Managing Director).
Diese starke akademische Prägung ist typisch für DeepTech-Ausgründungen. Das Start-up hat seine technologischen Wurzeln im hochspezialisierten Umfeld der gedruckten Elektronik. Um diese Expertise zu kommerzialisieren, wurde die FLEXOO GmbH im Jahr 2024 offiziell als eigenständiges Spin-off des renommierten Heidelberger InnovationLab gegründet. Die Bündelung dieser Kompetenzen in einer eigenständigen Gesellschaft war der strategische Schritt, um eine Technologiearchitektur, die laut Investorenangaben von der Forschung bis zur Markteinführung validiert wurde, nun auf die globale industrielle Skalierung zu trimmen.
Das Versprechen: Hochauflösende Daten aus dem Inneren der Maschine
FLEXOO adressiert eine reale Schwachstelle aktueller KI-Systeme: KI-Algorithmen benötigen hochauflösende Echtzeit-Daten über den physikalischen Zustand von Hardware. Das Gründerteam hat dafür eine Sensorplattform entwickelt, die ultradünne, flexibel formbare Sensoren mit Edge-AI kombiniert.
Die Kerninnovation liegt laut Unternehmensangaben im Formfaktor: Die Sensoren sind unter 200 Mikrometer dünn und sollen sich nahtlos in nahezu jede Oberfläche oder Struktur integrieren lassen. Im Bereich der Batterietechnologie liefert dies auf dem Papier messbare Mehrwerte: FLEXOO gibt an, dass Validierungen mit führenden Batterieherstellern Kapazitätsgewinne von bis zu 5 Prozent zeigen. Dies soll komplett ohne Änderungen am Batteriezell-Design oder der bestehenden Zellchemie gelingen. Zudem sollen durch die direkten Daten auf Zellebene Frühwarnsysteme etabliert werden, die drohende Batterieausfälle proaktiv verhindern. Solche „bis zu“-Werte sind in frühen Validierungsphasen stets mit Vorsicht zu genießen, bis sie sich in der industriellen Massenanwendung verlässlich reproduzieren lassen.
Die Produktion als eigentlicher Hebel
Der entscheidende Überlebensfaktor für ein Hardware-Start-up ist die Skalierbarkeit der Produktion. FLEXOO setzt hier auf eine hochvolumige Druckfertigung, die nahezu jede Geometrie ermöglichen soll. Die Sensoren werden nicht aufwendig einzeln zusammengebaut, sondern gedruckt. Das ermöglicht laut Aussage der Investoren eine Kostenstruktur, die den breiten industriellen Einsatz erst realistisch macht und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis liefert.
Das Start-up reklamiert dabei selbstbewusst für sich, den weltweit präzisesten taktilen Sensor zu produzieren. Ob das patentierte Verfahren und die Fertigung „Made in Germany“ diesen technologischen Vorsprung gegen die immense Konkurrenz langfristig verteidigen können, wird sich letztlich in den harten Preisverhandlungen der Zulieferer-Industrie zeigen.
Die Realität der Skalierung: Verträge statt Prototypen
Trotz des starken technologischen Fundaments steht FLEXOO nun vor der klassischen Herkulesaufgabe für Hardware-Start-ups: Die Überführung von vielversprechenden Prototypen in ein profitables Seriengeschäft. Mit dem Abschluss der Series-A-Runde fokussiert sich das Unternehmen 2026 richtigerweise auf den Ausbau des internationalen Vertriebs und die Sicherung strategisch relevanter Lieferverträge. Zudem ist die Bereitstellung von Prototypen der Physical-AI-Plattform an Entwicklungspartner fest eingeplant.
Die Zusammensetzung der Investoren ist hierbei ein strategischer Vorteil: eCAPITAL bringt Erfahrung bei Deep-Tech-Unternehmen und einen klaren Fokus auf ClimateTech sowie IoT mit. AUMOVIO wiederum kann über seine Start-up-Einheit co-pace direkten Zugang zur globalen Automobil- und Mobilitätsindustrie bieten.
Dass FLEXOO parallel Einsatzfelder in stark wachsenden Zukunftsbereichen wie der humanoiden Robotik ins Auge fasst, deutet das enorme Potenzial der Sensor-Plattform an. Ob aus diesem Versprechen jedoch wirklich ein globaler Standard für Physical AI wird, müssen erst die harten Serien-Validierungen der nächsten Jahre zeigen. "Hardware is hard" – das gilt auch für smarte, gedruckte Sensoren aus Heidelberg.
12 Mio. USD für Secfix: Vom simplen Compliance-Tool zur europäischen Security-Plattform
Die regulatorischen Daumenschrauben für Europas Unternehmen ziehen sich an. Das Münchner Start-up Secfix liefert die passenden Antworten – und sichert sich nun in einer überzeichneten Series-A-Runde 12 Millionen US-Dollar.

Heute verkündet das Münchner Start-up Secfix einen bedeutenden Meilenstein: Das Unternehmen, das sich als eine der führenden End-to-End Security-Compliance-Plattformen in Europa positioniert, hat eine überzeichnete Series-A-Finanzierung in Höhe von 12 Millionen US-Dollar erfolgreich abgeschlossen. Angeführt wird die Kapitalmaßnahme von Alstin Capital. Flankiert wird der Lead-Investor von Bayern Kapital sowie dem Bestandsinvestor neosfer, der Innovationseinheit der Commerzbank-Gruppe.
Von der TU München zur europäischen Expansion
Hinter Secfix stehen die CEO Fabiola Munguia sowie ihre Mitgründer Grigory Emelianov (CTO) und Branko Džakula (CISO). Die Wurzeln des Start-ups reichen an die Technische Universität München (TUM) zurück, wo Munguia und Emelianov studierten. Zunächst startete das Team 2021 mit Requestee, einem Marktplatz für ethische Hacker und Penetrationstests – eine Gründungsgeschichte, über die StartingUp bereits ausführlich in einem Porträt berichtet hat.
Doch im direkten Austausch mit Start-ups und dem Mittelstand erkannten die Gründer*innen durch gutes Zuhören am Markt ein weitaus gravierenderes, strukturelles Problem: Europäische Unternehmen standen vor enormen Hürden, da Security-Zertifizierungen bis zu 18 Monate dauerten und extrem viel manuellen Aufwand erforderten. Dieser langsame und teure Prozess hemmte das Wachstum massiv, denn ohne die passenden Nachweise verzögerten sich wichtige Vertragsabschlüsse, was teilweise zu Millionenverlusten führte. Das Team verinnerlichte eine wichtige unternehmerische Lektion: Compliance ist kein reines IT-Thema, sondern ein entscheidender Wachstumshebel, um Enterprise-Deals überhaupt abschließen zu können. Aus dieser Erkenntnis heraus vollzog das Team einen strategischen Pivot zu Secfix (sie offizielle Umfirmierung und Rechtsformwandlung erfolgte im Januar 2023), um die Prozesse für Standards wie ISO 27001, den EU AI Act, NIS2, DSGVO und SOC 2 grundlegend zu automatisieren.
Vom reinen Tool zum strategischen Partner
Was bei Secfix ursprünglich als reines GRC-Automatisierungstool (Governance, Risk, Compliance) begann, hat sich laut Unternehmensangaben mittlerweile zu einer KI-gestützten End-to-End Security-Compliance-Plattform in Europa weiterentwickelt. Dies ist eine direkte Antwort auf die Marktdynamik: Mit Vorgaben wie ISO 27001, NIS2, DORA und dem EU AI Act steigt der regulatorische Druck auf europäische Firmen derzeit erheblich an. Um in diesem komplexen Umfeld nicht nur bloße Checkbox-Compliance zu betreiben, vereint Secfix heute Compliance-Automatisierung mit einem KI-nativen "CISO-as-a-Service". Das Portfolio deckt dabei weite Teile der Sicherheitsinfrastruktur ab und reicht von kontinuierlichem Monitoring, Incident-Management und Access-Management bis hin zu Cloud-Security-Scanning, Penetrationstests und vollumfänglicher Security-Führung.
Dieser ganzheitliche Ansatz scheint im Markt auf Resonanz zu stoßen: Laut Secfix können Kund*innen die Dauer ihrer Zertifizierungsprozesse durch die Plattform um bis zu 90 Prozent verkürzen. Gleichzeitig verweist das Start-up auf eine Audit-Erfolgsquote von 100 Prozent. Aktuell vertrauen bereits Hunderte von Kund*innen in über 15 europäischen Ländern auf den Service, darunter renommierte Unternehmen wie WorkMotion, Veremark, Orianda und Trafigura sowie Banken und Energieunternehmen.
Die nächsten Schritte: Europa im Visier und „Smart Money“ an Bord
Mit dem frischen Kapital will Secfix nun die Expansion in ganz Europa gezielt vorantreiben. Zudem investiert das Unternehmen in die Weiterentwicklung seiner KI-gestützten Automatisierung und skaliert das CISO-as-a-Service-Angebot für die wachsende Nachfrage im Mid-Market.
Die strategische Neuausrichtung bringt Fabiola Munguia, die CEO des Münchner Unternehmens, wie folgt auf den Punkt: „Wir haben damit begonnen, Unternehmen schnell und unkompliziert zur Zertifizierung zu bringen. Heute werden wir zu ihrem langfristigen Security- und Compliance-Partner für alles, was danach kommt. Unsere Vision ist es, Secfix als führende End-to-End Security-Compliance-Plattform Europas zu etablieren, die Unternehmen von der ersten ISO-27001-Zertifizierung an durch ihre gesamte Security- und Compliance-Reise begleitet.“
Für das weitere Wachstum setzt Secfix dabei ganz bewusst auf "Smart Money". Mit dem Lead-Investor Alstin Capital holt sich das Start-up einen Münchner Fonds an Bord, der stark auf B2B-Software fokussiert ist. Besonders wertvoll dürfte der „All-in“-Ansatz des Investors sein: Neben Kapital unterstützt Alstin die Gründerteams aktiv durch Sales-Coaching, Go-to-Market-Strategien sowie den Zugang zu relevanten Industriekontakten.
Plato sichert sich 14,5 Mio. USD für das KI-Betriebssystem für den Großhandel
Plato entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert.

Gegründet wurde Plato 2024 von Benedikt Nolte, Matthias Heinrich Morales und Oliver Birch. Die Plattform entstand ursprünglich aus Noltes familiengeführten Großhandelsunternehmen heraus, das mit veralteter Software und Fachkräftemangel zu kämpfen hatte. Dieser praxisnahe Ursprung prägt bis heute Platos industriegetriebenen Ansatz für KI-Transformation.
Das Unternehmen entwickelt KI-native Software, die zentrale Workflows in den Bereichen Vertrieb, Angebotserstellung und ERP-Prozesse für Großhandelsunternehmen automatisiert. Großhändler bewegen jeden fünften Dollar der globalen Produktionsleistung, sind jedoch bis heute massiv unterversorgt mit moderner Software. Platos Lösung stattet Vertriebsteams mit einem KI-Copiloten aus, steigert Profite und erhöht die Vertriebseffizienz via AI agents.
„Wir haben die Probleme aus erster Hand im Großhandel meiner Familie erlebt und Plato gemeinsam mit Experten entwickelt, um die Arbeitsweise der Branche neu zu denken. Wir bauen das KI-Betriebssystem für den Großhandel, beginnend mit einer intelligenten Automatisierungsplattform im Vertrieb. Mit dieser Finanzierung skalieren wir Plato, um die gesamte Branche zu transformieren und einen Tech-Champion für die Handelsökonomie aufzubauen – aus Deutschland, für die Welt“, sagt Benedikt Nolte, CEO von Plato.
Skalierung des KI-Betriebssystems für den Großhandel
Die Plattform erschließt verborgene ERP-Daten und automatisiert manuelle Aufgaben, sodass Vertriebsteams vom reaktiven ins proaktive Verkaufen kommen. Plato hat bereits mehrere der führenden Großhändler Europas mit sechsstelligen Vertragsvolumina gewonnen. Die 14,5 Mio.-USD-Finanzierung soll es Plato ermöglichen, sein vertikales Produktangebot auf Kundenservice und Einkauf auszuweiten und die internationale Expansion voranzutreiben.
„Besonders überzeugt hat uns an Plato die außergewöhnliche Qualität des Gründerteams. Das Team hat in diesem Bereich ein echtes „Right to winˮ und brennt für den Großhandel. Es vereint tiefgehende Branchenexpertise aus erster Hand mit starker technischer Umsetzung und dem Anspruch, ein branchenprägendes vertikales KI-Unternehmen aufzubauen. Großhändler suchen dringend nach branchenspezifischer KI-Software, um operative Herausforderungen zu lösen – und genau diese Lösung ist Plato“, sagt Andreas Helbig, Partner bei Atomico.
Milliarden-Coup für Dresdner BioTech: Seamless Therapeutics gewinnt Pharma-Riese Eli Lilly als Partner
Das 2022 gegründete TU-Dresden-Spin-off Seamless Therapeutics hat eine Plattform entwickelt, um das „Genome Editing“ auf einpräzises und flexibles Niveau zu bringen, um die Technologie für eine Vielzahl von Indikationen anwendbar zu machen. Jetzt hat das BioTech eine Forschungskooperation mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly vereinbart. Das Gesamtvolumen des Deals beläuft sich auf bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar – wir erklären, was hinter der Summe und der Technologie steckt.

Dass universitäre Spitzenforschung der Treibstoff für wirtschaftlichen Erfolg sein kann, beweist aktuell eine Meldung aus Dresden. Die Seamless Therapeutics GmbH, eine erst 2022 gegründete Ausgründung der Technischen Universität Dresden (TUD), spielt ab sofort in der Champions League der Biotechnologie mit. Mit Eli Lilly konnte eines der weltweit forschungsstärksten Pharmaunternehmen – bekannt u.a. für Durchbrüche in der Diabetes- und Adipositas-Behandlung – als strategischer Partner gewonnen werden.
Der Deal: Mehr als nur eine Schlagzeile
Die Dimensionen der Vereinbarung lassen aufhorchen: Der Kooperationsvertrag beziffert sich auf einen Wert von bis zu 1,12 Milliarden US-Dollar. Doch wie ist eine solche Summe für ein junges Start-up einzuordnen?
In der BioTech-Branche sind solche Verträge oft als sogenannte Bio-Bucks strukturiert. Das bedeutet: Die Milliarde liegt nicht sofort als Koffer voller Geld auf dem Tisch. Der Deal setzt sich in der Regel aus einer substanziellen Sofortzahlung (Upfront Payment) zum Start der Forschung und weiteren, weitaus größeren Teilzahlungen zusammen. Diese fließen erfolgsabhängig, sobald das Startup definierte Meilensteine erreicht – etwa den erfolgreichen Abschluss klinischer Studienphasen oder die Marktzulassung.
Die Technik: Warum Lilly so früh einsteigt
Dass ein Gigant wie Eli Lilly so früh in ein Start-up investiert, liegt an der disruptiven Technologie der Dresdner. Seamless Therapeutics hat eine Plattform entwickelt, um das „Genome Editing“ auf einpräzises und flexibles Niveau zu bringen, um die Technologie für eine Vielzahl von Indikationen anwendbar zu machen.
Während bekannte Verfahren wie die „Genschere“ CRISPR-Cas oft darauf basieren, die DNA-Stränge komplett zu durchtrennen (Doppelstrangbruch) – was zu ungewollten Fehlern bei der zelleigenen Reparatur führen kann –, gehen die Dresdner einen anderen Weg. Sie nutzen sogenannte Designer-Rekombinasen.
Vereinfacht gesagt arbeitet ihre Technologie nicht wie eine grobe Schere, sondern wie ein präzises „Suchen & Ersetzen“-Werkzeug. Sie können genetische „Schreibfehler“ direkt im Erbgut korrigieren, ohne die riskanten Brüche in der Doppelhelix zu erzeugen. Dieser Ansatz ist namensgebend („Seamless“ = nahtlos) und gilt als deutlich sicherer für die Anwendung am Menschen. Ein erstes konkretes Ziel der Kooperation ist die Bekämpfung von genetisch bedingtem Hörverlust.
Die Köpfe: Ein Team auf Expansionskurs
Hinter diesem technologischen Durchbruch steht kein anonymes Labor, sondern ein jahrelang eingespieltes Gründerteam aus der TUD. Den wissenschaftlichen Nukleus bildete die Forschungsgruppe von Prof. Frank Buchholz (Professor für Medizinische Systembiologie). Zusammen mit ihm trieben vor allem Dr. Felix Lansing, der heute als Chief Scientific Officer (CSO) die technologische Vision verantwortet, und Dr. Anne-Kristin Heninger (Head of Operations) die Entwicklung zur Marktreife voran. Komplettiert wurde das Gründungsteam durch Dr. Teresa Rojo Romanos und Dr. Maciej Paszkowski-Rogacz.
Dass Seamless Therapeutics den globalen Durchbruch ernst meint, zeigt auch eine strategische Personalie aus dem April 2024: Um die Brücke in den entscheidenden US-Markt zu schlagen, holte man den Branchenveteranen Dr. Albert Seymour als neuen CEO an Bord. Während Seymour die internationale Skalierung vorantreibt, sichern die Gründer weiterhin die technologische DNA des Unternehmens. „Die Zusammenarbeit mit Eli Lilly ist eine Bestätigung für unsere Gen-Editierungsplattform und ihr krankheitsmodifizierendes Potenzial“, erklärt Prof. Buchholz.
Der Standort: Wie aus Forschung Business wird
Der Erfolg fällt nicht vom Himmel, sondern ist das Ergebnis eines funktionierenden Transfer-Ökosystems. Das Startup wurde seit den frühen Phasen intensiv unterstützt durch TUD|excite, das Excellence Center for Innovation der TU Dresden, sowie durch SaxoCell, das sächsische Zukunftscluster für Präzisionstherapie. Prof. Ursula M. Staudinger, Rektorin der TUD, sieht in dem Deal eine Blaupause für den deutschen Innovationsstandort: „Das Investitionsvolumen unterstreicht eindrucksvoll das Potenzial dieser Technologie [...] Zugleich zeigt dieser Meilenstein, wie konsequent und erfolgreich die TUD den Transfergedanken lebt.“
Für Seamless Therapeutics beginnt nun die Arbeit, die rekombinase-basierte Technologie gemeinsam mit Eli Lilly durch die anspruchsvollen Phasen der Medikamentenentwicklung zu bringen – mit einem Team, das wissenschaftliche Exzellenz nun mit internationaler Management-Erfahrung verbindet.
Seed-Runde: Leipziger HRTech clarait erhält über 1,5 Mio. Euro
Das 2023 von Johannes Bellmann, Miriam Amin und Thilo Haase gegründete Start-up clarait digitalisiert einen der letzten analogen Bereiche im Unternehmen: die Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und HR.

Die clarait GmbH hat den Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde bekanntgegeben und sichert sich Kapital in Höhe von über 1,5 Millionen Euro. Lead-Investor der Runde ist der TGFS Technologiegründerfonds Sachsen, der einen siebenstelligen Betrag investiert. Als Co-Investor beteiligt sich der HR Angels Club, ein europaweites Netzwerk aus erfahrenen HR-Führungskräften und Investoren.
Marktlücke: Der „White Spot“ zwischen HR- und Legal-Tech
Während klassische HR-Prozesse wie Payroll oder Recruiting längst digitalisiert sind, gilt der Bereich der „Labour Relations“ (betriebliche Mitbestimmung) als einer der letzten kaum erschlossenen Märkte. In vielen Unternehmen dominiert hier noch der „Status Quo“ – ein Vorgehen, das angesichts strenger Compliance-Vorgaben und der DSGVO zunehmend riskant wird.
Clarait positioniert sich hier mit zwei verknüpften SaaS-Lösungen:
- BRbase unterstützt Betriebsräte bei der strukturierten Organisation von Sitzungen, Beschlüssen und Mitbestimmungsprozessen.
- HRflows liefert der Arbeitgeberseite juristisch geprüfte Workflows für mitbestimmungspflichtige Maßnahmen.
Wettbewerb & USP: Brückenbauer statt Insellösung
Im Wettbewerbsumfeld grenzt sich das Leipziger Start-up deutlich ab. Während etablierte Anbieter oft reine Insellösungen anbieten, verfolgt clarait einen Plattform-Ansatz. Ziel ist es, den Medienbruch zwischen Personalabteilung und Gremium zu beenden und beide Seiten auf einer Infrastruktur zu verbinden.
Das Start-up adressiert damit einen wachsenden Markt, der durch steigende regulatorische Anforderungen und den Trend zu revisionssicheren Workflows getrieben wird. Zu den Kunden zählen bereits DAX-40- und Fortune-500-Unternehmen.
Der „Perfect Fit“: Praxis trifft Prozesslogik
Ein wesentlicher Faktor für das Investment dürfte die Komposition des Gründerteams sein, das die nötige Neutralität für dieses politisch sensible Thema mitbringt:
- Johannes Bellmann (CEO) vereint die Perspektiven beider Verhandlungspartner und versteht das Geschäftsmodell sowie den Markt der betrieblichen Mitbestimmung tiefgehend.
- Thilo Haase (CPO) verantwortet die inhaltliche Ausgestaltung der Plattform.
- Miriam Amin (CTO) vervollständigt das Trio als technische Mitgründerin.
„Smart Money“ und KI-Pläne
Neben dem Kapital des TGFS bringt vor allem der Einstieg des HR Angels Club strategisches Gewicht. Das Netzwerk gilt als „Smart Money“ der HR-Tech-Szene und bietet Zugang zu Entscheidern in Personal- und Organisationsfunktionen. Sören Schuster, Geschäftsführer des TGFS, sieht in der Gremienverwaltung einen „bislang nur unzureichend digitalisierten Bereich“ und bescheinigt dem Team das Potenzial zum Qualitätsführer.
Das frische Kapital soll primär in den Ausbau der Vertriebsorganisation sowie die Weiterentwicklung der Software fließen. Geplant sind unter anderem die Integration von KI-gestützten Assistenzfunktionen sowie die Vorbereitung der Internationalisierung, die zunächst im deutschsprachigen Raum erfolgen soll.
Gründer*in der Woche: Famories – Wenn Stimmen bleiben
Wie das 2025 von Neele Himmelsbach und Lennie König gegründete Famories wertvollen Erinnerungen per privaten Podcasts ein digitales Zuhause gibt.

Die schönsten Familienerinnerungen entstehen zuhause, am Küchentisch, im Wohnzimmer, beim gemeinsamen Essen. Doch was passiert, wenn diese Momente verblassen? Neele Himmelsbach und ihr Co-Gründer Lennie König haben mit Famories eine Antwort darauf gefunden – und eine Plattform geschaffen, die Generationen verbindet, indem sie das Persönlichste bewahrt: unsere Stimme.
Es sind oft die leisen Momente, die den Anstoß für große Ideen geben. Für die Gründer*innen von Famories war es die Distanz zum Alltag, die die entscheidende Erkenntnis brachte. Während eines gemeinsamen Wanderurlaubs wurde Neele und Lennie schmerzlich bewusst, wie wenig sie eigentlich über die Lebensgeschichten ihrer eigenen Großeltern wussten. Diese Lücke im familiären Gedächtnis wurde durch einen Verlust noch deutlicher: Der Tod ihrer Großväter führte ihnen vor Augen, dass deren Geschichten, da sie nie festgehalten wurden, nun unwiederbringlich verloren waren.
Vom Sprachmemo zum „Privaten Podcast“
Die beiden beschlossen, es besser zu machen. Sie begannen, die Erinnerungen ihrer Großmütter aufzuzeichnen – ganz einfach per Sprachnachricht. Dabei machten sie eine entscheidende Entdeckung über die Kraft der eigenen Stimme: „Man hört Emotionen, Pausen, Lachen und dennoch ist die Hemmschwelle viel geringer als beim Schreiben oder Filmen“, so die Gründerin.
Der Ansatz war denkbar simpel: „Es reicht, eine Frage zu stellen und auf ‚Aufnehmen‘ zu drücken“, so Lennie. Doch die pragmatische Lösung offenbarte schnell ein technisches Problem: Die wertvollen Aufnahmen lagen verstreut auf verschiedenen Geräten. Aus diesem Chaos entwickelte Lennie den ersten Prototypen einer App, die diese Erinnerungen strukturiert und sicher speichert – die Idee des „privaten Familien-Podcasts“ war geboren. „Famories soll kein Telefonat ersetzen. Ich telefoniere weiterhin mit meiner Oma. Aber es schafft einen gemeinsamen Raum, in dem Geschichten gesammelt werden können, für die ganze Familie, über Generationen hinweg“, berichtet Neele.
Top-Start in die App-Charts
Was im Januar 2025 mit der Konkretisierung der Geschäftsidee im Digital Hub Aachen begann, nahm rasant Fahrt auf. Bereits im April 2025 wurde die Famories UG gegründet. Die Vision überzeugte nicht nur Investor*innen, sondern auch Jurys: Das Team sicherte sich das NRW-Gründerstipendium und gewann den Publikumspreis beim Pitch des Founder Institute Berlin. Der offizielle Launch im August 2025 zeigte, dass Famories einen Nerv getroffen hatte. Die App, die im Apple App Store und Google Play Store veröffentlicht wurde, positionierte sich bereits am ersten Wochenende auf Platz 24 der App-Store-Charts in der Kategorie „Soziale Netzwerke“.
Ein digitales Zuhause für alle Generationen
Heute ist Famories weit mehr als ein reines Archiv für Großeltern-Geschichten. Die Gründer*innen formulieren ihre Mission klar: „Unser Ziel ist es, Familien dauerhaft näher zusammenzubringen, indem wir ein digitales Zuhause schaffen“, so die Gründer*innen.
Durch wöchentliche Fragen und thematische Alben entstehen in der App echte „Erzählräume“. Egal ob für Pendler*innen, Studierende im Ausland oder Eltern – die App hilft Familien, Erinnerungen festzuhalten, die sonst verloren gingen. „Wir bekommen immer wieder Nachrichten von Nutzer*innen, die Famories für ganz unterschiedliche Lebensmomente nutzen: Eine Nutzerin hat uns geschrieben, dass sie die Meilensteine ihrer Kinder festhält, ein anderer Nutzer hat Famories sogar auf seiner eigenen Hochzeit genutzt. Das zeigt uns, dass unsere App viel breiter eingesetzt wird, als wir es ursprünglich gedacht haben.“
Wie wichtig dieser Ansatz gesellschaftlich ist, zeigte ein Pilotprojekt im Juli 2025 in Senioren-Wohngemeinschaften in Wildau und Zeuthen. Gemeinsam mit den Bewohner*innen wurden Lebensgeschichten festgehalten, was nicht nur den Dialog zwischen den Generationen stärkte, sondern auch den immensen Wert erzählter Erinnerungen für Angehörige und Pflegende unterstrich. „Das Projekt hat uns gezeigt: Jeder Mensch hat spannende Geschichten, man muss sich nur die Zeit nehmen, nachzufragen und zuzuhören. Genau das geht im Alltag oft verloren“, erzählt Lennie.
Vernetzung und Vision
Gründerin Neele treibt die Vision des Unternehmens konsequent voran. Im November 2025 wurde sie in das renommierte SHEROES-Investmentnetzwerk aufgenommen. Auch die Präsenz in der Öffentlichkeit wächst: Am 11. Februar sind die Gründer*innen im Rahmen des „Leaders & Mission Podcasts“ zu Gast bei IKEA in Berlin-Tempelhof. Dort diskutieren sie, wie IKEA Räume für Begegnung schafft, während Famories „die Geschichten bewahrt, die dort entstehen“.
Mit Funktionen wie personalisierbaren Weihnachtszeitungen und einem digitalen Adventskalender hat das Start-up zuletzt eindrucksvoll Gespür für emotionale Bindung bewiesen. Famories zeigt damit, dass in einer immer schnelleren digitalen Welt das Bedürfnis nach Beständigkeit wächst – und bietet eine Lösung, damit die Geschichten, die uns verbinden, nie wieder verloren gehen. „Langfristig wollen wir Geschichten nicht nur digital in der App bewahren, sondern Nutzer*innen ermöglichen, aus den Folgen Bücher oder sogar Videos zu generieren. Kinder sollen eine Tonie-Figur ihrer eigenen Oma erhalten, die ihre Geschichte erzählt“, träumt Neele.
exist Leuchtturm konkret: Wie die Startup Factory FUTURY ihre Kräfte im Bausektor bündelt
Der Bund will mit seinen exist Startup Factories international sichtbare Gründungs-Leuchttürme schaffen. In Hessen zeigt sich nun, wie diese Theorie in die Praxis übersetzt wird: Die Frankfurter Factory FUTURY und der mittelhessische Hub LOVEDIS formen eine strategische Allianz.

Es ist eines der ambitioniertesten Projekte der deutschen Gründungsförderung: Mit dem Leuchtturmwettbewerb will das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) die Fragmentierung der deutschen Start-up-Landschaft überwinden. Das Ziel sind hoch vernetzte, kapitalstarke Ökosysteme – sogenannte Startup Factories –, die Public-Private-Partnerships auf ein neues Level heben. Hintergründe dazu in unserem Special zu den exist Startup Factories.
FUTURY, einer der Gewinner dieses Wettbewerbs, liefert nun den Beweis, dass das Konzept „Factory“ mehr ist als ein Label: Durch die Allianz mit LOVEDIS (ehemals StartMiUp) wird die Innovationskraft des Finanzplatzes Frankfurt mit der industriellen Substanz Mittelhessens verzahnt.
Die Logik der Startup Factory: Skalierung durch Arbeitsteilung
Die Kernidee der Startup Factories – die Bündelung von Ressourcen für größere Schlagkraft – wird am Beispiel des Programms „The Mission Construction“ exemplarisch durchdekliniert. Während FUTURY als zentraler Hub und methodischer Enabler fungiert und die Verbindung zu Kapitalgebern und internationalen Netzwerken hält, übernimmt LOVEDIS die operative Führung im vertikalen Marktsegment Bau.
Dieser Schritt ist strategisch konsequent: LOVEDIS sitzt in Marburg inmitten einer Region, die reich an Hidden Champions des Baugewerbes ist. Die neue Aufgabenteilung verlagert die Validierung von Innovationen somit direkt an die Quelle der industriellen Wertschöpfung, während FUTURY den Rahmen für Skalierung und Methodik liefert.
Vom Pitch-Deck ins Real-Labor
Für Gründer*innen im Bereich ConstructionTech bedeutet diese Strukturreform eine Abkehr vom reinen Pitch-Training hin zur industriellen Integration. Der für 2026 angesetzte Accelerator nutzt die Factory-Struktur, um Startups Zugang zu sogenannten Real-Laboren zu verschaffen. Partner wie Lupp, FingerHaus oder Weimer Bau fungieren dabei nicht nur als Sponsoren, sondern öffnen ihre Baustellen und Datenräume für Pilotprojekte.
Das Ziel der Factory-Strategie ist dabei klar definiert: Weg von der Insel-Lösung, hin zu systemrelevanten Kooperationen. Nach einer dreimonatigen Validierungsphase mündet das Programm in einen One-on-One-Accelerator, der gezielt auf langfristige Lieferbeziehungen oder Co-Entwicklungen hinarbeitet.
10 Millionen Euro als Hebel für 1.000 Start-ups
Die Allianz zwischen LOVEDIS und FUTURY ist auch ein Signal an die Politik und Geldgeber. FUTURY tritt an, um bis 2030 rund 1.000 neue Startups hervorzubringen – unterstützt durch bis zu 10 Millionen Euro Bundesförderung, die durch private Mittel gespiegelt werden müssen.
Dass nun LOVEDIS als starker regionaler Partner die Federführung in einem Schlüsselsektor übernimmt, zeigt, wie die Mittel eingesetzt werden: Um regionale Exzellenzcluster (wie die Bauindustrie in Mittelhessen) an die große Infrastruktur der Startup Factory anzudocken. Mara Steinbrenner (CEO LOVEDIS) und Melissa Ott (MD FUTURY) betonen unisono, dass diese „Kollaboration der neue Standard“ sei – ein Modell, das notwendig ist, um im europäischen Wettbewerb um DeepTech- und Industrie-Innovationen bestehen zu können.
Gründungs-Optimismus 2026: Trotz Gegenwind auf Wachstumskurs?
Während die makroökonomischen Vorzeichen auf Abkühlung stehen – die OECD prognostizierte zuletzt eine Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums um rund zehn Prozent in den kommenden Jahren – zeichnet sich in der deutschen Gründer*innenszene ein überraschendes Gegenbild ab: Ein neuer Optimismus macht sich breit.

Laut dem aktuellen „Work Change Special Report“ von LinkedIn (befragt wurden über 1000 Unternehmensführungen und Fachkräfte in Deutschland) blicken 55 Prozent der deutschen Kleinunternehmer*innen zuversichtlich auf das Wachstum in den kommenden zwölf Monaten. Dieser Wert sticht besonders hervor, da kleine Unternehmen (KMU) rund 90 Prozent aller Unternehmen ausmachen und für 70 Prozent des globalen BIP verantwortlich sind. Wenn dieser Sektor trotzt, hat das Signalkraft.
Damit zeigt der Report eine klare Trendwende: Die wirtschaftliche Unsicherheit führt nicht zur Schockstarre, sondern zu mehr Eigeninitiative. Die Zahl der LinkedIn-Mitglieder in Deutschland, die ihrem Profil den Titel „Founder“ hinzufügen, ist im Jahresvergleich um 61 Prozent gestiegen. Ein Indiz dafür, dass sich der Begriff des Unternehmertums wandelt – weg von rein formalen Strukturen, hin zu einer agilen Founder-Economy, die oft digital startet, bevor sie im Handelsregister landet.
KI als der große „Gleichmacher“ für kleine Teams
Was treibt diesen Mut zur Selbständigkeit in einem schwierigen Umfeld? Die Daten legen nahe, dass technologische Barrieren fallen. Künstliche Intelligenz (KI) fungiert hier als „Equalizer“, der kleinen Teams Wettbewerbschancen eröffnet, die früher Konzernen vorbehalten waren. Das generative KI-Potenzial wird global auf eine Wertschöpfung von bis zu 6,6 Billionen US-Dollar geschätzt – und kleine Unternehmen wollen sich ihren Teil davon sichern.
- Wettbewerbsvorteil: 53 Prozent der Geschäftsführer*innen kleiner Unternehmen in Deutschland geben an, dass KI entscheidend für das Wachstum ihres Unternehmens ist.
- Gründungsmotor: Fast 30 Prozent der Fachkräfte in Deutschland sagen, dass erst die Verfügbarkeit von KI sie dazu ermutigt hat, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen.
- Hohe Adaption: Während in der breiten Wirtschaft die Implementierung oft schleppend verläuft, sind die auf LinkedIn aktiven Kleinunternehmen bereits deutlich weiter: Hier geben 84 Prozent an, KI bereits in irgendeiner Form zu nutzen.
Die Renaissance der Soft Skills: Vertrauen als Differenzierungsmerkmal
Der Report warnt jedoch davor, sich allein auf Technologie zu verlassen. In einer Ära, in der KI-generierte Inhalte exponentiell zunehmen, wird der Human Factor zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Wenn Aufmerksamkeit ein knappes Gut ist, wird Vertrauen zur härtesten Währung.
- Netzwerkeffekte: 69 Prozent der Marketingverantwortlichen in kleinen Unternehmen bestätigen, dass Käufer*innen Informationen heute primär über ihre Netzwerke validieren, bevor sie Entscheidungen treffen.
- Markenaufbau: Für 71 Prozent der deutschen Kleinunternehmer*innen ist der Aufbau einer starken Marke der Schlüssel, um ihre 3-bis-5-Jahres-Ziele zu erreichen.
- Authentizität: 72 Prozent setzen verstärkt auf „Community-Driven-Content“ – also Stimmen von Mitarbeitern und Experten –, da bloße Markenbotschaften an Wirkung verlieren.
Fazit für Gründer*innen
Die Strategie für 2026 lautet Hybridität: Erfolgreiche Gründer*innen nutzen KI für Geschwindigkeit und Skalierung im Hintergrund, investieren aber gleichzeitig massiv in den Aufbau persönlicher Netzwerke und einer glaubwürdigen Marke. Oder wie es die Daten zeigen: 65 Prozent der deutschen Kleinunternehmer*innen sehen das aktive Netzwerken inzwischen als essenziellen Schlüssel für langfristiges Wachstum an.
Wer heute gründet, tut dies mit mächtigeren Werkzeugen als je zuvor – muss aber mehr denn je beweisen, dass hinter der Technologie echte Menschen stehen.
Millionen-Spritze gegen den Brain Drain: Blockbrain holt 17,5 Mio. Euro
Wissen ist das neue Gold – doch es wandert oft mit den Mitarbeitenden aus der Tür. Das 2022 gegründete Stuttgarter Scale-up Blockbrain will das verhindern. Mit einer „No-Code“-Plattform konservieren die Gründer Antonius Gress, Mattias Protzmann und Nam Hai Ngo Firmenwissen in KI-Agenten. Jetzt gab es frisches Kapital, dass primär in die Expansion nach Großbritannien und Europa sowie in die Produktentwicklung fließen soll.

Der demografische Wandel setzt Unternehmen unter Druck: Wenn erfahrene Fachkräfte in den Ruhestand gehen oder kündigen, hinterlassen sie oft nicht nur eine leere Stelle, sondern eine Wissenslücke. Eingespielte Prozesse und implizites Erfahrungswissen („Tribal Knowledge“) gehen verloren. Genau hier hakt Blockbrain ein. Das Tech-Unternehmen gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde über 17,5 Millionen Euro bekannt.
Angeführt wird die Runde vom Münchner VC Alstin Capital und dem Londoner Tech-Investor 13books Capital. Zudem stockten die Bestandsinvestoren Giesecke+Devrient Ventures, Landesbank Baden-Württemberg Ventures und Mätch VC ihr finanzielles Engagement auf. Auch das Family Office von Harting beteiligte sich an der Runde, was die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 22,5 Millionen Euro hebt.
Vom Konzern-Problem zur Start-up-Lösung
Dass Blockbrain bei der Industrie einen Nerv trifft, liegt auch an der DNA des Gründerteams. CEO Antonius Gress kennt die Schmerzen großer Organisationen aus seiner Zeit bei Bosch, während CTO Mattias Protzmann als Mitgründer von Statista bereits bewiesen hat, wie man Datenmodelle skaliert. Dritter im Bunde ist Nam Hai Ngo (ehemals Antler).
Ihr Ansatz: Eine „No-Code“-Plattform, mit der Unternehmen ohne Programmieraufwand sogenannte Knowledge Bots erstellen können. Diese digitalen Zwillinge speichern nicht nur Dokumente, sondern bilden Entscheidungslogiken und Methodenwissen von Experten ab. Die Anwendungsfelder reichen vom schnelleren Onboarding neuer Mitarbeiter bis zur Automatisierung komplexer Vertriebsprozesse.
Der Markt scheint ihnen recht zu geben: 2025 konnte Blockbrain nach eigenen Angaben den Umsatz verfünffachen. Kunden wie Bosch, Roland Berger und die Seifert Logistics Group setzen die Lösung bereits ein. Letztere berichtet von einer Zeitersparnis von bis zu 15 Prozent pro Woche durch die KI-Assistenten.
Sicherheit als „Moat“ gegen ChatGPT & Co.
Während viele Unternehmen beim Einsatz generativer KI wegen Halluzinationen und Datenlecks zögern, positioniert sich Blockbrain als der „sichere Hafen“. Die Plattform ist nicht nur ISO-27001-zertifiziert und „EU-AI-Act-ready“, sondern ermöglicht durch eine Multi-Model-Architektur auch die volle Datensouveränität. Kund*innendaten können bei Bedarf in regionalen Cloud-Umgebungen des Nutzenden verbleiben.
Wie groß der Vorsprung vor herkömmlichen Enterprise-Lösungen ist, untermauert das Start-up mit Zahlen: In einem unabhängigen Benchmark des Sicherheitsspezialisten Giesecke+Devrient erzielte Blockbrain 92 von 105 Punkten – der Zweitplatzierte kam lediglich auf 58 Punkte. „Sich einfach auf Versprechungen und die Stärke eines Modells zu verlassen, ist im Unternehmenskontext schlicht nicht genug“, kommentiert CTO Protzmann die Strategie.
Expansion mit „Forward-Deployed“ Ingenieuren
Das frische Kapital fließt nun primär in die Expansion nach Großbritannien und Europa sowie in die Produktentwicklung. Dabei setzt Blockbrain auf ein spezielles Personalmodell: Sogenannte Forward-Deployed AI-Engineers sollen Kund*innen eng bei der Integration begleiten – remote oder vor Ort. Ziel ist es, Recherche-Workflows weiter zu automatisieren und KI vom Experimentierfeld zum verlässlichen Werkzeug im Kerngeschäft zu machen.
40 Mio. EUR Series-A für Berliner CleanTech metiundo
Das Berliner EnergieTech metiundo will das Tempo beim Smart-Meter-Rollout erhöhen und sichert sich dafür in einer der aktuell größten Series-A-Runden im deutschen CleanTech-Sektor 40 Mio. Euro.

Die Digitalisierung der Energiewende im Gebäudesektor erhält frisches Kapital: Das 2021 von von Dennis Nasrun und Felix Mücke gegründete metiundo hat eine Finanzierungsrunde über 40 Millionen Euro abgeschlossen. Das Kapital stammt aus Fonds, die von Octopus Energy Generation verwaltet werden, einem der führenden europäischen Investoren für grüne Infrastruktur. Für das Berliner Unternehmen markiert das Investment den nächsten Schritt vom Nischenanbieter zum breiten Marktakteur.
Kapital für Skalierung und Software
Das Geschäftsmodell von metiundo basiert auf „Smart Metering as a Service“. Anders als klassische Messstellenbetreiber deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Installation der Zähler über den Betrieb bis hin zur Aufbereitung der Daten über eine eigene Softwareplattform. Bislang hat das Unternehmen nach eigenen Angaben über 21.000 Zähler installiert.
Mit den nun eingesammelten 40 Millionen Euro soll vor allem die technische und personelle Infrastruktur ausgebaut werden. Konkret plant das Unternehmen Investitionen in die Weiterentwicklung der proprietären Softwareplattform sowie den Ausbau der eigenen Montage- und Installationsteams. Gesucht werden Fachkräfte in den Bereichen Softwareentwicklung, Installation und Betrieb, um die Kapazitäten für den bundesweiten Rollout zu erhöhen.
Dennis Nasrun, Co-Founder und CEO von metiundo, betont den strategischen Fokus: „Von Anfang an haben wir konsequent in unsere eigene Software investiert. Mit der neuen Finanzierung gehen wir jetzt entschlossen in die weitere Skalierung: mehr Installationen, höhere Qualität und noch mehr Geschwindigkeit beim Ausbau unserer Plattform.“
Sektorkopplung im Fokus der Investoren
Für den Investor Octopus Energy Generation ist der Einstieg bei metiundo Teil einer breiteren Strategie zur Dekarbonisierung des Immobiliensektors. Alex Brierley, Co-Head des Fondsmanagement-Geschäfts bei Octopus, verweist auf die Relevanz des Marktes: „Der Gebäude- und Wärmesektor zählt zu den größten CO2-Verursachern in Deutschland und ist für rund 30% der energiebezogenen Emissionen verantwortlich.“
Das Ziel der Investition ist es, integrierte Smart-Meter-Netzwerke über mehrere Liegenschaften hinweg aufzubauen. Dies soll nicht nur Transparenz schaffen, sondern die Grundlage für datenbasierte Zusatzlösungen bilden – etwa die Optimierung von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern vor Ort, um Betriebskosten zu senken.
Wettbewerb im Messstellenmarkt
Der Markt für Messstellenbetreiber in Deutschland ist derzeit starker Dynamik unterworfen. Der Gesetzgeber drückt beim Smart-Meter-Rollout aufs Tempo, wobei wettbewerbliche Messstellenbetreiber wie metiundo als „zentraler Hebel“ gelten, um die Installation intelligenter Messsysteme in der Fläche zu beschleunigen.
Ein Differenzierungsmerkmal von metiundo ist dabei der spartenübergreifende Ansatz: Die Plattform bündelt nicht nur Stromdaten, sondern integriert auch Wasserverbräuche, um ein Gesamtbild der energetischen Situation einer Immobilie zu erstellen.
Startschuss für SouthwestX: Eine von zehn offiziellen exist Startup Factories nimmt Arbeit auf
Die Startup-Factory SouthwestX hat am 6. Februar 2026 den operativen Betrieb aufgenommen. Als eines von bundesweit nur zehn Leuchtturm-Projekten, die sich im exist-Leuchtturmwettbewerb des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK) durchsetzen konnten, startet das Konsortium mit einem Gesamtbudget von 22,5 Millionen Euro.

Der offizielle Start markiert den Abschluss eines intensiven Auswahlprozesses. SouthwestX gehört damit zum exklusiven Kreis der zehn vom Bund prämierten exist Startup Factories, die beauftragt sind, Deutschland international als führenden Deep-Tech-Standort zu etablieren. Ziel des in Saarbrücken ansässigen Hubs ist die Förderung von Ausgründungen in der Großregion Saarland, Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Frankreich.
Exzellenz-Status und Finanzierung
Der Status als offizielle exist Startup Factory ist an strikte Kriterien geknüpft. Um den finalen Zuschlag und die damit verbundene Bundesförderung von 10 Millionen Euro zu erhalten, musste SouthwestX den Wettbewerb nicht nur fachlich gewinnen, sondern auch die Wirtschaftlichkeit durch privates Kapital nachweisen. Dem Konsortium gelang es, 12,5 Millionen Euro an privaten Mitteln aus der Industrie zu akquirieren. Diese Public-Private-Partnership sichert dem Standort eine Gesamtfinanzierung von 22,5 Millionen Euro für die erste Phase.
Langfristige Strukturziele
Die Initiatoren verfolgen mit der Factory langfristige strukturpolitische Ziele. Nach eigenen Angaben sollen in den kommenden zehn Jahren über die Plattform rund 1.500 Startups gegründet und etwa 20.000 Arbeitsplätze in der Region geschaffen werden. Der inhaltliche Fokus liegt auf der Überführung wissenschaftlicher Erkenntnisse in industrielle Anwendungen (Deep Tech) sowie auf Technologien zur ökologischen Transformation der Wirtschaft (Green Transformation).
Grenzüberschreitender Ansatz und KI-Fokus
Im Vergleich zu den anderen neun Factories positioniert sich SouthwestX mit einem dezidiert europäischen Profil. Durch die Einbindung von Partnern aus Frankreich und Luxemburg entsteht ein grenzüberschreitendes Innovationsnetzwerk. Ein thematischer Schwerpunkt liegt auf „Responsible AI“ (vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz). Hierbei wird unter anderem auf die Expertise des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) zurückgegriffen.
Zum Start 2026 wurden drei Kernprogramme aufgelegt:
- Startup Journey: Ein Inkubator-Programm für Teams in der Frühphase.
- Innovation Journey / GTI: Das Programm „Green Transformation Innovation“ zielt auf die Vermittlung von Kooperationen und Pilotprojekten zwischen Startups und etablierten Industrieunternehmen.
- Startup Leaders Program: Ein Weiterbildungs- und Vernetzungsangebot für Wachstumsunternehmen (Scale-ups) mit Fokus auf Internationalisierung.
Beteiligte Institutionen
Das Partnernetzwerk umfasst neben dem DFKI unter anderem die WHU – Otto Beisheim School of Management, die Max-Planck-Institute, die Universität des Saarlandes sowie die Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU).
Ralf Zastrau, Co-CEO von SouthwestX, bezeichnete den Start als Schritt, um „aus wissenschaftlicher Exzellenz unternehmerische Dynamik“ zu erzeugen. Der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke betonte im Rahmen der Veranstaltung die Bedeutung des Transfers zwischen Forschung und wirtschaftlicher Anwendung für den Standort.
Gründer*in der Woche: JUPUS - zwischen Jura und KI
Wie René Fergen mit seinem LegalTech-Start-up JUPUS dem Fachkräftemangel in Kanzleien entgegenwirken und unseren Zugang zum Rechtssystem sichern will.

Es gibt Branchen, die scheinen immun gegen Wandel zu sein. Die Rechtsbranche ist eine davon – konservativ, traditionsbewusst, hierarchisch. Digitalisierung und Transformation sind dort Konzepte, die längst noch nicht ihren Schrecken verloren haben. Das beginnt sich zu ändern, unter anderem auch dank René Fergen und seinem Start-up JUPUS. Fergen, studierter Jurist, erfuhr in erster Person, wie manuelle Prozesse die Arbeit in Kanzleien verlangsamen und wie sehr dies die Branche – geplagt vom Fachkräftemangel – ausbremst. Als 25-jähriger technologiebegeisterter Student entschied er sich dafür, eine Lösung zu bauen.
Er war davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz (KI) Kanzleien revolutionieren kann. Heute, nur wenige Jahre später, gilt René als einer der wichtigsten Treiber dieser Entwicklung und sein Unternehmen als eines der am schnellsten wachsenden Start-ups in Europa.
„Kein Mandant spricht mit einer KI“
Wenn René heute erzählt, wie alles begann, schwingt in seiner Stimme immer noch ein Rest Ungläubigkeit mit. „Ich war noch im Studium und habe in einer Branche gepitcht, in der Anzug und Krawatte zum Pflichtprogramm gehören“, erinnert er sich. „Ich kam im Hoodie, war in den Augen vieler zu jung, um die Lösung für eine der größten Herausforderungen der Branche zu haben. Nicht selten wurde ich einfach aufgrund meines jungen Alters belächelt. Da kollidierten zwei Welten aufeinander.“
Seine Idee: KI-gestützte Tools, die den Kanzleialltag automatisieren, von der Telefonassistenz über die Mandatsaufnahme und die Aktenanlage bis hin zur Erstellung kompletter Schriftsätze. Eine gute Idee, zumal es so ein Tool bisher nicht auf dem Markt gab. Trotzdem musste der junge Gründer durch eine harte Schule gehen. Akquisegespräche waren oft demotivierend.
Viele waren noch nicht bereit für die Transformation und sagten: „Kein Mandant gibt sensible Daten in einen Chatbot ein.“ „Niemand will mit einer Telefon-KI sprechen.“ Und: „Wenn das funktionieren würde, hätte es längst jemand gemacht.“
Der Diplom-Jurist ließ sich nicht beirren. „Ich wusste, dass Kanzleien an ihrer eigenen Bürokratie ersticken, dass nicht Digitalisierung, sondern Stillstand das Risiko ist.“ Die ihm entgegengebrachte Skepsis blieb zunächst Renés Begleiter. „‚Das geht nicht‘ war wahrscheinlich der Satz, den ich in den ersten Jahren am häufigsten gehört habe“, sagt er. Doch er verstand, dass Widerstand auch ein Signal für Potenzial sein kann. „Wenn niemand an deine Idee glaubt, bedeutet das oft nur, dass sie neu ist. Das Unmögliche wirkt unmöglich, bis man es tut.“
Ein Podcast als Inspiration
Im Jurastudium dreht sich eigentlich alles um Klausuren, Hausarbeiten, Staatsexamen. Ein bisschen an der Praxisrealität vorbei, fand René. Der Weg in die LegalTech-Welt begann für ihn mit einem Podcast. Er habe „einfach mal reingehört“ und nie wieder aufgehört zu brennen, erzählt er heute. Plötzlich war ihm klar: Die Rechtsbranche stand vor einem Wendepunkt. Ihre Zukunft wird nicht nur digitaler, sondern grundlegend anders.
Um diesen Gedanken eine Plattform zu geben, gründete er noch zu Studienzeiten einen LegalTech-Verein. Er suchte den Austausch mit Anwält*innen, Richter*innen und Professor*innen. Aus Diskussionen wurden Ideen, aus Ideen erste Prototypen. Gemeinsam mit zwei Informatikstudenten entwickelte er 2022 einen kleinen Chatbot für Kanzlei-Websites. Die Idee war noch roh, aber er verkaufte das Tool an die ersten Kanzleien. Es funktionierte und verschaffte die geplante Entlastung. Als der junge Gründer einen Business Angel überzeugte, floss die erste Investition. Aus einem studentischen Nebenprojekt wurde so ein echtes Vorhaben.
Bruch und All-in-Moment
Doch gerade als das Projekt Fahrt aufnahm, kam ein heftiger Rückschlag im Gründungsteam. „Als wir drei, vier, fünf aktive Kanzleikunden hatten, stiegen meine Mitgründer von heute auf morgen aus“, erzählt René. „Für mich war das ein Schock: laufende Kunden, Investorenerwartungen – und plötzlich keinen, der die Technologie vorantrieb.“
Es folgte ein harter Konflikt. René stand vor einer Entscheidung: aufgeben oder sich verschulden, um das Projekt zu retten. Er glaubte an seine Idee und entschied sich dafür, 60.000 Euro Schulden aufzunehmen. Ohne Einkommen, direkt nach dem Studium, ging er all-in. Dieser Moment markierte den Wendepunkt und war die Geburtsstunde von JUPUS.
Neustart mit klarer Mission
Denn kurz darauf lernte René Jannis Gebauer kennen, seinen heutigen Co-Founder. Rasch setzten der Jurist und der Tech-Experte Konzept, Produkt und Marke neu auf. In nur zwei Jahren entstand so das erste KI-Sekretariat speziell für Anwaltskanzleien. Das LegalTech-Start-up hat über acht Millionen Euro von namhaften Investoren wie Acton Capital und dem High-Tech Gründerfonds eingesammelt. Aus der Zweimann-Bude ist ein 60-köpfiges Team aus Entwickler*innen, KI-Expert*innen, Jurist*innen und viel mehr geworden. JUPUS’ Website-Chatbot und Telefon-KI gelten als die meistgenutzten KI-Tools für Anwaltskanzleien im deutschsprachigen Raum. Die Plattform bearbeitet mehr als 10.000 Anrufe pro Woche und über 400 juristische Vorgänge täglich – mehr als jede Kanzlei im DACH-Raum.
JUPUS automatisiert wiederkehrende Abläufe vollständig, von der Mandatsaufnahme über Terminvereinbarungen bis hin zur Kommunikation mit Mandant*innen. Prozesse, die bis zu zehn Tage dauern können, reduziert das Tool dank seiner KI auf wenige Minuten. So sparen Kanzleien im Schnitt bis zu 70 Arbeitsstunden pro Monat. Die neu gewonnene Zeit können Anwält*innen in die juristische Arbeit stecken, also in die Rechtsberatung, die Vertretung vor Gericht oder in Verhandlungen. Ein enormer Gewinn für Kanzleien und Mandant*innen.
Die Plattform ist die erste Lösung auf dem deutschen Markt, die ganze Prozesse in der gesamten Kanzleitätigkeit schnell, DSGVO-konform und skalierbar automatisiert übernimmt. Denn bisher werden in einer durchschnittlichen mittleren Kanzlei selbst Vorgänge, die mit digitalen Tools erledigt werden könnten, meist manuell bearbeitet: Dokumentation und Auflistung der Neuanfragen, Kontaktaufnahme und Kommunikation mit den Klient*innen, Terminfindung, Dokumente einscannen, ablegen, mit der Post zur Unterschrift verschicken etc.pp. Wenn die Fachkraft fehlt, blockiert das die Ressourcen der Anwält*innen.
Technologie mit Wirkung
Warum das wichtig ist? In Deutschland gibt es rund 50.000 Anwaltskanzleien. Viele von ihnen kämpfen mit denselben Problemen: steigende Mandant*innenerwartungen, Fachkräftemangel, stagnierende Prozesse. Vor allem kleine und mittlere Kanzleien (90 Prozent des Markts) leiden darunter. Ganz besonders macht ihnen der Fachkräftemangel zu schaffen. Und das wird sich in absehbarer Zukunft nicht ändern, denn es gibt zwar immer mehr Anwält*innen, aber immer weniger Rechtsanwaltsfachangestellte. Das belegen diese Zahlen: Während sich die Zahl der Anwält*innen in den letzten 30 Jahren verdreifacht hat, ist die Zahl der Auszubildenden in Kanzleien um 70 Prozent gesunken.
„Wir lösen kein Luxusproblem“, sagt René. „Wir sorgen dafür, dass auch kleine und mittlere Kanzleien konkurrenzfähig bleiben. Und dass Bürger*innen weiterhin Zugang zu rechtlicher Unterstützung haben, unabhängig davon, ob die Kanzlei Personal findet.“
Anderen Gründer*innen gibt René Fergen diesen Tipp: „Gründen heißt, sich zu entscheiden – vor allem dann, wenn es unbequem wird –, und dranzubleiben, wenn es wehtut. Es gibt keine Abkürzung. Erfolg ist selten ein Knall, sondern das leise Ergebnis vieler guter und einiger schlechter Tage hintereinander.“
Pheno-Inspect sichert sich Seed-Finanzierungsrunde in Mio.-Höhe
Pheno-Inspect – 2020 von Dr. Philipp Lottes als Ausgründung der Universität Bonn gestartet – ist ein Agrar-KI-Unternehmen und entwickelt KI-basierte Softwarelösungen zur automatisierten Analyse hochauflösender Drohnenbilder in der Landwirtschaft.

Was 2020 als Ausgründung der Universität Bonn begann, entwickelt sich zu einem wichtigen Player für die Digitalisierung der Landwirtschaft. Pheno-Inspect hat sich darauf spezialisiert, dem Landwirt quasi „Adleraugen“ zu verleihen. Das Start-up aus Nordrhein-Westfalen entwickelt KI-basierte Software, die hochauflösende Drohnenbilder vollautomatisch auswertet.
Das Besondere dabei: Die Technologie blickt nicht nur grob auf den Acker, sondern analysiert Feldbestände bis auf die Einzelpflanze genau. Das Ziel ist es, den Pflanzenbau durch datenbasierte Entscheidungen effizienter und ressourcenschonender zu gestalten – ein Thema, das angesichts von Klimawandel und Kostendruck in der Agrarbranche Hochkonjunktur hat.
Prominente Investoren setzen auf „Precision Farming“
Dass Pheno-Inspect mit diesem Ansatz einen Nerv trifft, zeigt die Zusammensetzung der aktuellen Finanzierungsrunde. Neben dem Companisto Business Angel Netzwerk beteiligt sich die NRW.BANK, die im Zuge der Runde ein Wandeldarlehen in Höhe von 500.000 Euro in eine feste Beteiligung umgewandelt hat. Aufhorchen lässt auch der Einstieg von CLAAS. Der weltweit tätige Landmaschinenkonzern steigt als strategischer Investor ein. Für ein junges B2B-Tech-Start-up ist dies mehr als nur Kapital; es ist ein Zugang zu immenser Industrieexpertise und potenziellen Vertriebswegen.
Fokus auf SaaS und Skalierung
Das frische Kapital soll nun gezielt in das Wachstum fließen. Pheno-Inspect plant, seine Plattform konsequent in Richtung Software-as-a-Service (SaaS) auszubauen. Im Mittelpunkt steht dabei der neue FarmAnalyzer. Mit dieser Plattform will das Unternehmen die komplexe Feldanalyse vereinfachen und für Landwirte direkt nutzbar machen – im Self-Service und über die gesamte Vegetationsperiode hinweg. Parallel dazu soll das interdisziplinäre Team am Standort in NRW weiter wachsen, um neue KI-Module zur Marktreife zu bringen.
„Der Abschluss unserer ersten Finanzierungsrunde ist ein wichtiger Schritt in der Unternehmensentwicklung“, erklärt Dr. Philipp Lottes, Gründer und CTO von Pheno-Inspect. „Mit der neuen FarmAnalyzer-Plattform werden wir Feldanalysen auf Einzelpflanzenebene erstmals einfach, wirtschaftlich und praxisnah direkt Landwirten zur Verfügung stellen.“
Mit der Finanzierung im Rücken und einem starken Industriepartner an der Seite ist Pheno-Inspect nun bereit, die digitale Transformation auf dem Acker weiter voranzutreiben.

