Aktuelle Events
Es gibt keine Rechtssicherheit mehr!
Mehr rechtliche Sicherheit gefordert
Autor: Hans LuthardtExperten-Interview mit Dr. Andreas Lutz vom Verband der Gründer und Selbstständigen e.V. Der VGSD hat im Februar 2015 eine Arbeitsgruppe zum Thema „Scheinselbstständigkeit“ eingerichtet, die über die Missstände aufklären möchte. Anfang Juni startete die Arbeitsgruppe eine Petitionskampagne zu diesem Thema. Noch läuft die Petition - hier gibt's Details.
Das Interview

Arbeitsministerin Nahles will ein „Gesetz gegen den Missbrauch von Werkverträgen“ auf den Weg bringen. Es ist zwar zu hören, dass der ursprüngliche Entwurf weniger hart für Selbständige ausfällt, als ursprünglich gedacht, aber noch ist nichts entschieden. Das Gesetz soll dem Schutz von Solo-Selbständigen dienen, indem es die aktuelle Verwaltungspraxis der Deutschen Rentenversicherung (DRV) festschreibt. Was ist Ihrer Meinung nach daran falsch?
Statt Solo-Selbstständige gezielt vor Missbrauch zu schützen werden sie durch die Verwaltungspraxis der DRV unter den Generalverdacht der Scheinselbstständigkeit gestellt. Für Auftraggeber ist es inzwischen in vielen Fällen so riskant, Einzelunternehmer und Freiberufler zu beauftragen, dass sie ihnen zunehmend gar keine Aufträge mehr geben. Eine Reihe großer Unternehmen hat faktisch einen Auftragsstopp verhängt.
Grund ist die immer rigidere Entscheidungspraxis der DRV bei Statusfeststellungsverfahren. Die dabei entwickelten Kriterien, die in erheblichem Maße dem allgemeinen Rechtsempfinden widersprechen und nicht mehr zeitgemäß sind, sollen durch das Gesetz festgeschrieben werden.
Erstes Beispiel: Wissensarbeiter brauchen heute kaum mehr als einen Computer und ein Smartphone um ihre hochbezahlte Dienstleistung zu erbringen. Das eigentliche Kapital ist das erworbene Know-how. Dieses Fehlen von Investitionen für Maschinen, Lager etc. legt die DRV ihnen dann aber als Indiz für Scheinselbstständigkeit aus.
Zweites Beispiel: Wenn ein Trainer ein Seminar hält, ist es sachlogisch notwendig, Termin, Ort und Thema zu vereinbaren. Das wird von der DRV dann teilweise schon als Weisungsgebundenheit und Eingliederung in betriebliche Abläufe und damit Scheinselbstständigkeit interpretiert, wogegen man sich in einem Sozialgerichtsverfahren wehren muss. Da ist jeder Maßstab verloren gegangen!
Stehen Solo-Selbständige tatsächlich unter Generalverdacht, scheinselbständig zu sein?
Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann hat am 4.6.2015 in der Tagesschau nach Gesprächen zu diesem Thema mit Angela Merkel und mehreren Ministern Solo- und Scheinselbstständigkeit gleichgesetzt (Link) zuvor haben dies auch andere Teilnehmer an Konferenzen zum Thema „Arbeiten 4.0“ getan. Betroffene Selbstständige waren zu dem Dialog übrigens nicht eingeladen.
Diese Gleichsetzung ist unverantwortlich, denn sie führt dazu, dass die Beschäftigung von Solo-Selbstständigen zum finanziellen und strafrechtlichen Risiko für Auftraggeber wird und diese dann keine Aufträge mehr an kleine Unternehmen vergeben.
Auch im Grünbuch zum Thema „Arbeiten 4.0“ wird Solo-Selbstständigkeit mit prekärer Beschäftigung gleichgesetzt. Dabei handelt es sich um eine äußerst inhomogene Gruppe vom freischaffenden Künstler bis hin zum hochbezahlten IT-Experten.
Was kritisieren Sie an der gängigen Praxis der Statusfeststellung, also der amtlichen Klärung, ob Scheinselbständigkeit oder echte Selbständigkeit vorliegt?
Lange Zeit galten Statusfeststellungsverfahren bei der DRV als Möglichkeit Rechtssicherheit herzustellen und viele Auftraggeber beantragten für jeden neuen Auftragnehmer standardmäßig ein solches Verfahren, trotz der mehrmonatigen Bearbeitungszeiten.
In den letzten Jahren wurden die Kriterien für eine Scheinselbstständigkeit jedoch so stark ausgeweitet, dass der Anteil der auf „abhängig beschäftigt“ lautenden Bescheide von 19% in 2006 auf 46% in 2013 zunahm. Die Entscheidungen wurden schwer vorhersehbar. Selbst spezialisierte Rechtsanwälte wagen keine Prognose mehr über den Ausgang.
Was hat vor diesem Hintergrund das aktuelle Statusfeststellungsverfahren mit Rechtssicherheit zu tun?
Das Statusfeststellungsverfahren bietet keine Rechtssicherheit mehr. Alle Experten raten davon ab, selbst ein solches Verfahren anzustoßen, denn als Antragsteller ist man auch an zu Unrecht ergangene DRV-Bescheide gebunden. Damit hat man im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die keine Prüfung haben vornehmen lassen, gravierende Wettbewerbsnachteile. Das Überprüfen ergangener Bescheide durch Sozialgerichte dauert mehrere Jahre. Entstandener Schaden wird nicht erstattet.
Der Feststellungsbescheid bietet selbst bei einem positiven Ausgang nur sehr eingeschränkte Rechtssicherheit, da er sich immer nur auf die aktuelle Situation zum Prüfungszeitpunkt bezieht. Und auch während des Verfahrens besteht, anders als oft behauptet, meist keine Rechtssicherheit, da die zugrundeliegenden Bedingungen in der Praxis nur selten erfüllt sind.
Selbst Betriebsprüfungen, bei denen die Auftragsverhältnisse geprüft und nicht bemängelt wurden, führen übrigens zu keiner Rechtssicherheit.
Was bewirkt die von Ihnen beschriebene Rechtsunsicherheit in der Praxis?
Zunächst einmal haben die Auftraggeber so reagiert, dass sie durch die vorsichtige Auswahl der freien Mitarbeiter (z.B. Nachweis mehrerer Auftraggeber), Formulierung der Verträge, Änderungen bei der Zusammenarbeit (was oft auf eine Schlechterbehandlung der freien Mitarbeiter hinauslief), gesellschaftsrechtliche Konstruktionen (wie Zwischenschaltung einer GmbH) usw. Sicherheit herzustellen, denn sie wollten die Selbstständigen weiter beauftragen, auf die sie ja teilweise dringend angewiesen sind, z.B. als Experten zu einem Thema.
Das hat für Auftraggeber und -nehmer zu zusätzlicher Bürokratie und Aufwand geführt. Aber zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass unabhängig vom getriebenen Aufwand eine rechtssichere Beauftragung nicht mehr möglich und gewollt ist mit der Konsequenz, dass Aufträge eher an größere Auftragnehmer mit Angestellten vergeben werden. Solo-Selbstständige werden so gegenüber diesen Unternehmen massiv benachteiligt – obwohl sie geschützt werden sollten.
Was ist also das eigentliche Motiv/Motivation seitens der Regierung, Verwaltung und Gerichte, wenn nicht der Schutz der echten Selbständigen?
Das zentrale Motiv für die Vorgehensweise ist, wie Vertreter von Regierung, Verwaltung und Gerichten immer wieder durchblicken lassen, möglichst viele Selbstständige auf diesem Weg in die Rentenversicherung zu zwingen. Es entsteht der Eindruck, dass aus fiskalischen Gründen insbesondere die gut und fair bezahlten Selbstständigen geprüft werden. Eigentlich müsste ja dort geprüft werden, wo schlecht bezahlt wird. Wenn eine Rentenversicherungspflicht für Selbstständige eingeführt werden soll, so darf dies meines Erachtens nicht willkürlich für einzelne, sondern muss demokratisch legitimiert in einem transparenten Prozess erfolgen.
Kennen Sie Beispiele, die zeigen, dass einem Selbständigen wegen des Verdachts auf Scheinselbständigkeit das berufliche Aus gedroht hat bzw. er oder sie seine berufliche Existenz verloren hat?
Es gibt zahllose Beispiele dafür, dass jemand sein Geschäft schließen musste oder wichtige Aufträge verloren hat. Vor allem aber leben viele Auftraggeber unter einer ständigen Unsicherheit. Die meisten Betroffenen wollen anonym bleiben. Wir sind deshalb froh, dass wir in unserer VGSD-Arbeitsgruppe „Scheinselbstständigkeit“ mit Christa Weidner eine Betroffene haben, die ihre Geschichte erzählt. Im zweiten Halbjahr macht sie eine Vortrags-Roadshow, die sie nach München, Hamburg, Köln, Stuttgart, Frankfurt und Berlin bringen wird. Sie musste fünf Prozesse gegen die DRV führen. Sie hat zwar alle gewonnen, aber ihr Geschäft mit 70 Mitarbeitern musste sie schließen und Jahre ihres Lebens in den Kampf gegen die DRV investieren. Sie wird bei der Vortragsserie über ihre Erfahrungen berichten, aber auch viele Tipps geben.
Was fordern Sie konkret vom Gesetzgeber, um die Rechtssicherheit herzustellen?
Zentrale Forderung ist die Entwicklung klarer, für jeden Auftraggeber und -nehmer verständlich und den Verhältnissen der heutigen Arbeitswelt angemessene Kriterien, die eine rechtssichere Auftragsvergabe ermöglichen (im Zweifel spätestens durch Hinzuziehen eines Rechtsanwalts oder Steuerberaters).
Die Kriterien sollen leicht nachweisbar, als Positivkriterien formuliert („Wenn … dann selbstständig“) und nicht situationsabhängig sein. Es sollten Kriterien gewählt werden, die die Stellung der Selbstständigen stärken, statt sie zu schwächen. (Beispiel: Das Recht, einen erheblichen Teil der vereinbarten Arbeitszeit an einem selbstgewählten Ort zu erbringen.)
Arbeitsbedingungen, die auf Sachzwängen beruhen, dürfen nicht zu einer Auslegung gegen Selbstständige führen. Stattdessen sollte die Verhinderung von Missbrauch Vorrang vor der immer schwieriger werdenden Abgrenzung zwischen selbstständiger und abhängiger Beschäftigung haben.
Idealerweise würde durch solche Kriterien das Statusfeststellungsverfahren überflüssig. Bis es so weit ist fordern wir als Sofortmaßnahme: Die Weisung an die DRV, sich stärker auf tatsächlich Schutzbedürftige zu konzentrieren und Kriterien ausgewogener anzuwenden sowie die Beschleunigung des Verfahrens. Außerdem halten wir eine organisatorische Trennung der für das Statusfeststellungsverfahren zuständigen Abteilungen von der DRV für nötig, da hier Interessenkonflikte bestehen.
Sie haben fünf Kriterien entworfen, die es vereinfachen sollen, das Vorliegen von Selbständigkeit zu bestimmen. Welche sind diese?
Im Rahmen unseres Positionspapiers haben wir die folgenden Kriterien vorgeschlagen, zusammen mit Hinweisen wie sie umgesetzt werden könnten, damit es wenig Interpretationsspielraum gibt:
- Es handelt sich um eine freiwillige, gut informierte Entscheidung beider Seiten
- Der Stundensatz (nach Abzug von Reisekosten) beträgt > xx Euro
- Der Auftragnehmer ist Existenzgründer bzw. Berufsanfänger (z.B. erste x Jahre)
- Der Auftraggeber ist selbst Solo-Selbstständiger
- Der Auftragnehmer verfügt über einen Nachweis ausreichender Altersvorsorge (Existenzminimum im Alter ist bzw. wird abgesichert)
Auf unserer Website laden wir zu einer UserVoice-Abstimmung ein, in der Besucher eigene Kriterien und Lösungsansätze vorschlagen und aus den vorhandene auswählen können.
Was raten Sie Auftraggebern? Lieber auf Zeitarbeitskräfte zurückgreifen?
Echte Selbstständige werden sich ungern in Arbeitnehmerüberlassung drängen lassen. Wir empfehlen Auftraggebern, das Thema dem Auftragnehmer gegenüber offen anzusprechen. Jeder Selbstständige wird Verständnis dafür haben, dass wer ein angemessenes Honorar bezahlt, nicht noch 40% zusätzliche Beiträge riskieren möchte. Es sollte im gemeinsamen Interesse eine genaue Auftragsklärung stattfinden und dem Auftragnehmer größtmögliche Freiheit eingeräumt werden, was den Ort und die Zeit der Leistungserbringung betrifft.
Risikofaktoren sind u.a. die Tätigkeit beim Auftraggeber, die Bezahlung ausschließlich nach Zeitaufwand, die Nutzung von Arbeitsmitteln des Auftraggebers und kleinteilige Weisungen. Bei größeren Aufträgen ist es sinnvoll, einen Rechtsanwalt in die Vertragsgestaltung einzubeziehen. Auf unserer Website haben wir Aufzeichnungen von zwei Experten-Telkos mit Rechtsanwälten zu diesem Thema bereitgestellt, die es sich anzuhören lohnt. Wie gesagt: Die Entscheidungspraxis der DRV widerspricht dem normalen Rechtsgefühl, deshalb sollte man sich vorab genau informieren.
Vor allem aber bitten wir alle Selbstständigen, egal ob Auftraggeber oder -nehmer um die Mitzeichnung unserer Petition für mehr Rechtssicherheit unter www.vgsd.de/schein
Das Interview führte Hans Luthardt
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Markenschutz im Netz
Wie Start-ups in der digitalen Welt die Kontrolle über ihre Marke behalten.

Die digitale Welt ist ein Ort voller Möglichkeiten: Sie öffnet Türen, wo früher Mauern standen, und ermöglicht es selbst jungen Unternehmen, in kürzester Zeit globale Reichweite zu erzielen. Plattformen wie TikTok Shop revolutionieren den Onlinehandel, indem sie Hürden abbauen und direkten Zugang zu Millionen potenzieller Kund*innen bieten. Für Start-ups ist das eine enorme Chance, aber auch ein Minenfeld.
Denn je einfacher der Markteintritt, desto schwieriger wird es, die Kontrolle über die eigene Marke zu behalten. Nicht autorisierte Händler*innen, verwässerte Markenbotschaften und plötzliche Lieferengpässe sind keine hypothetischen Risiken mehr, sondern Alltag für viele junge Unternehmen. Wer erfolgreich wachsen will, muss seine Marke nicht nur im Blick behalten, sondern sie aktiv schützen.
Warum Markenschutz für Start-ups überlebenswichtig ist
Markenschutz ist weit mehr als ein kosmetisches Thema. Es geht darum, das zu bewahren, was eine Marke ausmacht: Vertrauen, Wiedererkennbarkeit und eine klare Positionierung. Gerade für Start-ups, deren Markenidentität noch im Aufbau ist, kann ein unkontrollierter Außenauftritt schnell zur Wachstumsbremse werden. Eine starke Marke signalisiert Verlässlichkeit, Qualität und Haltung.
Werden diese Botschaften durch Dritte verwässert – etwa durch schlechte Produktbeschreibungen, fehlerhafte Logistik oder inkonsistente Preise –, leidet nicht nur das Image, sondern auch die Profitabilität. Kund*innenbindung entsteht nicht aus Zufall, sondern durch ein konsequent gelebtes Markenerlebnis. Und genau das steht auf dem Spiel, wenn der Vertrieb außer Kontrolle gerät.
Die unsichtbaren Gegner: Wo junge Marken heute angreifbar sind
Die größten Herausforderungen für Start-ups liegen oft im Verborgenen. Besonders kritisch sind diese drei Bereiche:
- Unautorisierte Händler*innen: Produkte, die über inoffizielle Kanäle verkauft werden, entziehen sich jeder Qualitätskontrolle. Diese Verkäufer*innen agieren außerhalb der geplanten Markenstrategie, bieten häufig keine einheitlichen Preise und liefern teils mangelhafte Ware oder einen unzureichenden Kund*innenservice. Das Ergebnis: Das Vertrauen potenzieller Kund*innen schwindet, obwohl das Start-up selbst keinerlei Fehler gemacht hat.
- Inkonsistente Markenbotschaften: Wer Produkte über Plattformen wie Amazon, eBay oder TikTok Shop vertreibt, ist auf die korrekte Darstellung seiner Marke angewiesen. Doch sobald mehrere Verkäufer*innen parallel agieren, entstehen Inkonsistenzen: unterschiedliche Bilder, widersprüchliche Texte, fehlerhafte Übersetzungen. Das Markenbild zersplittert – und mit ihm die Möglichkeit, sich klar vom Wettbewerb abzugrenzen.
- Unerwartete Bestandsprobleme: Wird der Markt von nicht autorisierten Drittanbietenden mit Ware geflutet, verzerren sich die Lagerbestände und die Nachfrage lässt sich nicht mehr sauber prognostizieren. Die Folge: Das Start-up verliert die Kontrolle über Preisgestaltung und Verfügbarkeit. Das gefährdet nicht nur den Umsatz, sondern auch die Zufriedenheit der Kund*innen.
TikTok Shop: Goldgrube oder Risiko?
Ein aktuelles Beispiel für neue Chancen und neue Risiken ist der TikTok Shop. Die Social-Commerce-Plattform ist seit Kurzem auch in Deutschland, Frankreich und Italien für Händler*innen geöffnet und bietet Start-ups einen direkten Zugang zu einem hoch engagierten, konsumfreudigen Publikum.
Allein in den genannten Ländern wird der E-Commerce-Markt bis 2030 ein Volumen von über 5,5 Milliarden US-Dollar erreichen – ein gigantisches Potenzial für junge Marken.
Doch diese Gelegenheit bringt auch Herausforderungen mit sich: Die Dynamik von TikTok erfordert schnelles Handeln, ein tiefes Verständnis kultureller Unterschiede und ein extrem feinjustiertes Markenbild. Was in einem Markt funktioniert, kann im nächsten verpuffen oder sogar Schaden anrichten.
Deshalb gilt: Ohne konsistente Markenführung, solide Vertriebsverträge und lokale Expertise ist der Schritt auf TikTok Shop riskanter als er scheint. Wer hingegen mit einem strukturierten Ansatz startet, kann hier nicht nur Umsatz, sondern auch Markenbindung aufbauen – vorausgesetzt, man behält die Zügel in der Hand.
KI als neuer Schlüssel zum Markenschutz
Die zweite große Entwicklung, die den Markenschutz im digitalen Raum transformiert, ist die künstliche Intelligenz (KI). Für Start-ups kann der gezielte Einsatz von KI zum Gamechanger werden. Denn während Ressourcen oft begrenzt sind, bietet KI die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren und datenbasiert zu optimieren – vom Produktlisting über das Monitoring bis hin zur Warenverfügbarkeit:
Personalisierung in Echtzeit: KI-basierte Algorithmen analysieren das Verhalten potenzieller Käufer*innen in Echtzeit und helfen, Inhalte gezielt anzupassen. So wird aus einem generischen Produkttitel ein individualisiertes Einkaufserlebnis, etwa durch Empfehlungen à la „Geschenkideen für Muttertag“, basierend auf bisherigen Suchverläufen. Das stärkt nicht nur die Conversion, sondern auch das Markenimage als relevante, kompetente Anbieter*innen.
Digital-Shelf-Optimierung: Auf Marktplätzen wie Amazon oder TikTok Shop entscheidet der digitale Auftritt über Sichtbarkeit und Verkaufserfolg. Mithilfe von KI lässt sich analysieren, anhand welcher Keywords die eigenen Produkte sichtbar sind, wie sie sich gegenüber dem Wettbewerb positionieren und warum sie (nicht) konvertieren. Diese Insights ermöglichen eine datengetriebene Optimierung der Listungen und eine konsequente Steuerung der Markenpräsenz.
Vorausschauende Bestandsplanung: Gerade für kleine Unternehmen ist die Balance zwischen Warenverfügbarkeit und Lagerkosten ein kritischer Faktor. KI hilft dabei, Nachfrageprognosen zu erstellen, saisonale Schwankungen zu erkennen und Nachschubzyklen präzise zu steuern. So lassen sich Lieferengpässe und Überbestände vermeiden, was wiederum die Performance und die Markenwahrnehmung stärkt.
Strategien für zuverlässigen Markenschutz
Die gute Nachricht: Es gibt wirksame Hebel, mit denen junge Unternehmen die Kontrolle über ihre Marke zurückgewinnen – oder gar nicht erst verlieren:
- Selektiver Vertrieb als Fundament: Ein effektiver Ansatz ist der selektive Vertrieb. Dabei legen Start-ups vertraglich fest, welche Partner*innen ihre Produkte unter welchen Bedingungen verkaufen dürfen. So lässt sich sicherstellen, dass nur Händler*innen zum Zug kommen, die die Markenstandards (etwa bei Verpackung, Kund*innenkommunikation oder Retourenmanagement) einhalten.
- Technologie gezielt einsetzen: Moderne Analysetools und KI-Lösungen helfen dabei, verdächtige Verkaufsaktivitäten zu identifizieren, Preisabweichungen zu erkennen und Verstöße gegen Markenrichtlinien schnell zu lokalisieren. Eine proaktive Überwachung der digitalen Verkaufskanäle ist unerlässlich, um auf Veränderungen unmittelbar reagieren zu können.
- Klare Vertragsregelungen und rechtlicher Rückhalt: Start-ups sollten von Anfang an rechtssichere Vertriebsverträge aufsetzen, die konkrete Regelungen zur Produktdarstellung, Preisbindung und Plattformpräsenz enthalten. Die EU bietet hierfür mit der Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung eine solide rechtliche Grundlage. Solange der Marktanteil eines Unternehmens unter 30 Prozent liegt, können Vertriebskanäle gezielt gesteuert und nicht autorisierte Händler*innen ausgeschlossen werden.
- Aufklärung als Vertrauensbooster: Auch die Kund*innen müssen wissen, worauf sie achten sollten. Durch gezielte Kommunikationskampagnen über Social Media oder Newsletter können Start-ups auf die Risiken nicht autorisierter Händler*innen hinweisen und den eigenen Onlineshop oder vertrauenswürdige Partnerschaften klar hervorheben.
Fazit: Markenschutz ist kein Luxus, sondern erfolgskritisch
Wer in der digitalen Welt bestehen will, muss nicht nur auffallen, sondern auch konsistent wirken. Für Start-ups bedeutet das: Markenschutz ist keine Kür, sondern Pflicht. Er schützt nicht nur vor kurzfristigen Schäden, sondern bildet das Fundament für nachhaltiges Wachstum, starke Kund*innenbeziehungen und echte Differenzierung im Wettbewerb. Je früher Gründende Markenschutz zur Chefsache machen, desto besser. Denn eine starke Marke ist kein Zufallsprodukt – sie ist das Ergebnis klarer Entscheidungen, strategischer Partnerschaften und eines intelligenten Technologieeinsatzes.
Der Autor Torsten Schäfer ist als Europe Managing Director bei Pattern für das Umsatz- und Rentabilitätswachstum in Europa verantwortlich.
Non-Disclosure Agreement: Wenn‘s geheim sein und bleiben muss
Recht für Gründer*innen: Fünf wichtige Fragen und Antworten zu Geheimhaltungsvereinbarungen, auch Non-Disclosure Agreements (NDAs) genannt.

Geheimhaltungsvereinbarungen, auch bekannt als Non-Disclosure Agreements, dienen dazu, vertrauliche Informationen zu schützen, die zwischen Geschäftspartner*innen ausgetauscht werden. Wie wertvoll eine Geheimhaltungsvereinbarung für die Parteien wirklich ist, kommt allerdings stark auf die Ausführung an – der Teufel steckt auch hier im Detail. Denn Geheimhaltungsvereinbarungen sind meist nur ein Nebenschauplatz bei Verhandlungen größerer Projekte, bisweilen geraten sie in den Hintergrund. Da ist die Versuchung groß, eine Standardvorlage aus dem Internet, aus einem früheren Projekt oder von der Konkurrenz zu übernehmen – fertig ist das NDA.
Was auf den ersten Blick wie eine schnelle, kostensparende Lösung aussieht, kann allerdings im Streitfall erhebliche Probleme verursachen. Denn ist das NDA nicht auf die Situation der Vertragsparteien zugeschnitten, fehlen häufig entscheidende Details. Zumindest diese fünf Fragen sollten sich Unternehmer*innen vor dem Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung stellen.
1. Wer sind die richtigen Vertragsparteien?
Oft läuft es in der Praxis so: Vertragspartei A sendet ihr NDA-Muster als „Lückentext“ an Partei B. Diese trägt ihren Unternehmensnamen und Firmensitz selbst ein. Ist der Vertragspartner Teil einer Konzernstruktur, wird häufig die Muttergesellschaft genannt. Abgeschlossen wird der Vertrag dann zwischen A und der Konzernmutter B. Legt A der Tochtergesellschaft B, mit der sie die Geschäfte macht, wichtige Informationen offen, ist dies von der geschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung nicht gedeckt. Im Streitfall folgt das böse Erwachen für Partei A: Obwohl Tochtergesellschaft B alle Verhandlungen geführt hat, die Firmennamen von Mutter- und Tochtergesellschaft B ähnlich klingen, beide vielleicht sogar denselben Firmensitz haben, ist der Vertrag mit der „falschen“ Gesellschaft geschlossen worden und somit nutzlos. Die offengelegten Informationen sind im Zweifel nicht geschützt.
Teilweise sehen NDA-Muster vor, dass auch verbundene Unternehmen von der Vereinbarung umfasst sind. Dann muss vorab geklärt werden, ob die unterzeichnende Gesellschaft die relevanten Gesellschaften wirksam vertritt. Sonst kann es sein, dass die verbundenen Gesellschaften zwar geschützt, nicht aber selbst zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.
Komplexer wird es, wenn weitere Unternehmen beteiligt sind. Ein Beispiel: Partei A, B und C schließen der Einfachheit halber für ein gemeinsames Projekt ein mehrseitiges NDA. Im Grundsatz spricht nichts dagegen, solange genau geregelt ist, welche Partei welche Informationen inwieweit geheim halten muss. Doch gerade, wenn ein zweiseitiges NDA-Muster nur marginal auf diese Situation angepasst wird, fehlen häufig Regelungen, welche Informationen in welcher Beziehung ausgetauscht werden dürfen.
Ein Beispiel: A legt gegenüber B Informationen offen, B muss diese geheim halten. Tauscht B die Informationen mit C aus, ist nicht klar, ob B damit nicht bereits gegen das NDA verstößt und ob C diese Informationen dann überhaupt vertraulich behandeln muss.
2. Welche Informationen sollen geschützt werden?
Geschäftsgeheimnisse sind regelmäßig bereits nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG) geschützt. Voraussetzung ist allerdings ein „Geheimnis“ im Sinne des Gesetzes und dass das Unternehmen Maßnahmen zu dessen Geheimhaltung ergreift. Ratsam ist es daher, sensible Informationen durch entsprechende NDAs abzusichern. Aus dem NDA sollte sich zunächst klar ergeben, ob die Geheimhaltungsvereinbarung die Informationen beider Parteien schützt oder nur eine Partei einseitig zur Geheimhaltung verpflichtet ist.
Dann ist genau festzulegen, welche Informationen geschützt werden sollen – etwa nur bestimmte technische Details oder auch kaufmännische Themen. Soll die Zusammenarbeit selbst vertraulich behandelt werden? Oder soll sie beispielsweise zu Werbezwecken offengelegt werden können? Je konkreter der Umfang der vertraulichen Informationen im NDA definiert ist, umso weniger Anlass für Konflikte gibt es später. Eine sehr konkrete Geheimhaltungsvereinbarung lässt sich in den meisten Fällen nicht automatisch auf andere Projekte übertragen und hilft bei einem Folgeprojekt im Zweifel also wenig.
3. Wie werden Informationen geschützt?
Bei besonders sensiblen Informationen lohnt es sich, zu regeln, welche Personen im Unternehmen davon wissen dürfen und die interne Weitergabe auf Personen mit Need-to-know für die Durchführung des Projekts zu beschränken.
Bevor eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet wird, die die Anfertigung von Kopien und Backups verbietet, sollte geprüft werden, ob technisch überhaupt gewährleistet werden kann, dass keine automatischen Backups auf irgendeinem Server schlummern.
Auch die Laufzeit einer Geheimhaltungsvereinbarung ist oft formularmäßig vorgegeben und nicht an den Einzelfall angepasst. Sollen die Details nach erfolgreicher Durchführung eines Projekts veröffentlicht werden? Oder sind die Informationen derart sensibel, dass sie niemals weitergegeben werden sollen? Zu kurze Fristen, die unabhängig von der tatsächlichen Dauer eines Projekts vereinbart werden, sind gegebenenfalls riskant.
4. Wie schützt man sich für den Fall von Verstößen gegen das NDA?
Vertragsstrafen dienen dazu, Verstöße gegen Geheimhaltungsvereinbarungen zu ahnden – auch ohne, dass ein konkreter Schaden dargelegt werden muss. Wird die Aufnahme einer Vertragsstrafe in das NDA verabsäumt, bleibt nur der Nachweis eines tatsächlichen Schadens, der in der Praxis regelmäßig schwierig bis unmöglich zu erbringen ist.
Geheimhaltungsvereinbarungen sind in den meisten Fällen nach dem Recht über Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zu bewerten. In diesen Grenzen muss sich das NDA bewegen und darf im Einzelfall nicht unangemessen sein. Für die Partei, die das NDA-Muster bereitgestellt hat, gelten hier strenge Regeln: Ist beispielsweise in einer beidseitigen Geheimhaltungsvereinbarung eine unangemessen hohe Vertragsstrafe vorgesehen, muss der/die Vertragspartner*in diese im Zweifel nicht zahlen – das Unternehmen, von dem das NDAMuster kam, bei einem eigenen Verstoß allerdings schon.
5. Passen die Schlussbestimmungen?
Schlussbestimmungen – insbesondere zu Gerichtsstand und anwendbarem Recht – werden in Verträgen gerne übersehen. Sie spielen aber auch in Geheimhaltungsvereinbarungen eine nicht unwesentliche Rolle. Sieht das NDA-Muster einen Gerichtsstand am Sitz einer Vertragspartei vor oder regelt hierzu gar nichts, hat die Partei, die eine Verletzung der Vereinbarung rügt, nur die Wahl, einen öffentlichen Rechtsstreit zu führen oder dem Verstoß gar nicht nachzugehen.
Bei internationalen Vertragsbeziehungen kommt hinzu, dass eine Entscheidung auch durchsetzbar sein muss. Hier kann eine Schiedsklausel die sachgerechte Lösung darstellen. Ist nicht die Anwendung deutschen Rechts, sondern eines anderen Landes vereinbart, können die zu beachtenden Punkte ganz anders aussehen. Ob darin ein Nachteil für die Parteien liegt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
Fazit
Schweigen muss, wer im NDA zur Verschwiegenheit verpflichtet wurde. Sonst niemand. Die Verschwiegenheitspflicht gilt dabei nur für die Themen, die wirksam als vertraulich erklärt wurden. Dabei ist zu bedenken, dass nicht alle unternehmens- oder projektbezogenen Informationen so schützenswert sind, dass sich viel Aufwand für die Gestaltung einzelner NDAs lohnt. Die Faustregel: je wichtiger die Information, umso wichtiger ist ein guter Vertrag über den Schutz dieser Information.
Kritisch werden die Punkte des NDA erst, wenn ein(e) Vertragspartner*in gegen die Vertraulichkeit verstößt oder ein(e) potenzielle(r) Investor*in prüft, ob die wertvollen Informationen eines Unternehmens auch ausreichend geschützt sind. Beide Szenarien sind denkbar ungünstige Zeitpunkte für die Feststellung, dass wichtige Informationen ungeschützt sind.
Die Autorin Isabelle Hörner ist Rechtsanwältin bei der Kanzlei Menold Bezler in Stuttgart und berät u.a. zum Vertrags-, Handels- und Vertriebsrecht.
Gericht, Verträge, Haftung: Die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für Start-ups
Innovation und Unternehmergeist prägen viele junge Firmen, doch rechtliche Themen geraten leicht in den Hintergrund. Dabei können Haftungsrisiken, unklare Verträge oder Streitigkeiten vor Gericht schnell zum Existenzproblem werden. Eine vorausschauende Strategie schafft Vertrauen bei Investor*innen und Geschäftspartner*innen, sichert das Unternehmen gegen unerwartete Gefahren ab und legt die Basis für professionelles Wachstum.

Elementare Schritte zur rechtlichen Absicherung
Eine solide Rechtsstruktur beginnt bereits bei der Wahl der passenden Rechtsform. Ob GmbH, UG oder eine andere Variante, jede Gesellschaftsform hat eigene Haftungs- und Steueraspekte. Wer im Vorfeld klärt, wie Gesellschafter*innen entlohnt werden und welche Kontroll- oder Mitspracherechte bestehen, verhindert spätere Konflikte.
Ebenfalls wichtig ist ein umfassendes Risikomanagement, das mögliche Streitfälle frühzeitig einkalkuliert. Gemeinsam mit juristischen Fachpersonen lassen sich Verträge entwickeln, die Interessen aller Beteiligten klar definieren. Dabei lohnt es sich, den aktuellen Status quo abzubilden und zukünftige Entwicklungen wie Kapitalerhöhungen oder den Einstieg neuer Investorinnen zu berücksichtigen. Fehlende oder lückenhafte Regelungen sorgen im Eifer des Geschäftsalltags sonst für Unsicherheit.
Gerichtsprozesse und mögliche Stolpersteine
Kein junges Unternehmen plant, direkt vor Gericht zu landen. Dennoch entsteht gerade bei innovativen Geschäftsmodellen ein erhöhtes Konfliktpotenzial, beispielsweise durch Patentrechte, Markenstreitigkeiten oder Datenschutzvorwürfe. Ein Gerichtsverfahren bindet finanzielle Mittel und Kapazitäten des gesamten Teams. Somit empfiehlt sich eine klare Strategie für den Fall rechtlicher Auseinandersetzungen.
In diesem Kontext spielen Rechtsmittel wie Berufung oder Beschwerde eine Rolle, wenn ein Urteil nicht akzeptiert wird. Ergänzend besteht in seltenen Fällen die Möglichkeit zur Wiederaufnahme des Verfahrens, etwa bei neu aufgetauchten Beweisen oder gravierenden Verfahrensfehlern. Dieser Schritt wird häufig unterschätzt, da er komplexe Voraussetzungen hat und keineswegs immer zum Erfolg führt. Deshalb wird in den meisten Fällen auf gütliche Einigungen gesetzt oder eine möglichst rasche Beilegung angestrebt, bevor sich die Auseinandersetzung weiter zuspitzt.
Gerade bei Konflikten mit Kund*innen oder Geschäftspartner*innen können alternative Streitbeilegungsmechanismen wie Mediation oder Schiedsverfahren eine sinnvolle Ergänzung sein. Solche Verfahren gelten als schneller und weniger belastend für die Geschäftsbeziehung. Eine entsprechende Klausel in den Verträgen erleichtert später den Zugriff auf diese Methoden.
Vertragliche Grundlagen im Start-up
Grundlegende Dokumente wie Gesellschaftsverträge, Geschäftsordnungen und Investitionsvereinbarungen verdienen besondere Aufmerksamkeit. Jede Passage sollte praxisnah formuliert werden, damit keine Unklarheiten entstehen, etwa zu Stimmrechten oder Gewinnverteilung. Selbst wenn sich Gründer*innen gut kennen oder ein Vertrauensverhältnis zu Investor*innen besteht, ist Verbindlichkeit erforderlich.
Um ungewollte Interpretationsspielräume zu vermeiden, empfiehlt sich eine Dokumentation aller Vereinbarungen in schriftlicher Form. Besonders wichtig ist, bereits vor dem Markteintritt Regelungen zum Schutz geistigen Eigentums zu treffen. Ebenso helfen Geheimhaltungsvereinbarungen (NDAs), sensible Geschäftsdaten zu schützen. Wer standardisierte Vorlagen nutzt, riskiert jedoch, spezifische Risiken zu übersehen. Individuell zugeschnittene Verträge tragen maßgeblich zum Erfolg eines Unternehmens bei und verhindern, dass Ärgernisse erst in der Wachstumsphase auffallen.
Haftung und Risikoanalyse
Nicht nur die Gesellschaft als juristische Person kann in Haftung genommen werden, sondern unter Umständen auch einzelne Geschäftsführer*innen oder Gesellschafter*innen. Zu den häufigsten Problemfeldern zählt die Verletzung von Informations- und Aufklärungspflichten, die zu Schadensersatzansprüchen führt. Darüber hinaus setzt eine mangelhafte Buchführung das Team unkalkulierbaren Risiken aus.
Um Schieflagen vorzubeugen, empfiehlt sich eine gründliche Risikoanalyse, die potenzielle Gefährdungen beleuchtet. Datenschutzverstöße können beispielsweise hohe Bußgelder nach sich ziehen, während fehlerhafte Produktangaben zu Produktrückrufen führen können. Spezifische Branchenanforderungen sind zu beachten, etwa im Gesundheitssektor oder in hoch regulierten Bereichen wie FinTech.
Mit einer D&O-Versicherung lassen sich Schadensersatzansprüche gegen leitende Personen abfedern. Diese Police deckt allerdings nicht jede erdenkliche Situation ab. Im Vorfeld ist zu prüfen, welche Ausschlüsse gelten und in welchen Fällen die Versicherung tatsächlich greift. Auch eine allgemeine Betriebshaftpflicht ist ratsam, um bei Schäden gegenüber Dritten gewappnet zu sein.
Schutz des geistigen Eigentums und Datenschutz
Start-ups basieren oft auf innovativen Ideen, neuen Technologien und kreativen Marken. Daher sind Patente, Urheberrechte und Markenrechte wesentlich, um das eigene geistige Eigentum zu schützen. Die Anmeldung von Patenten oder Marken ist jedoch mit gewissen Kosten und formalen Anforderungen verbunden. Wer frühzeitig in diesen Schutz investiert, kann sich gegebenenfalls gegen Nachahmerinnen wehren und behält eine starke Position im Wettbewerb.
Daneben gewinnt der Datenschutz mit jedem Schritt in Richtung Digitalisierung an Bedeutung. Persönliche Daten von Kund*innen, Mitarbeiter*innen oder Nutzer*innen zu sammeln, ist an strenge Anforderungen gebunden. Bei einem Verstoß drohen empfindliche Strafen durch die Datenschutzaufsichtsbehörden. Zudem schadet schon ein Imageschaden dem Vertrauen der Öffentlichkeit und potenziellen Geschäftspartner*innen. Eine professionelle Datenschutz-Compliance schafft nicht nur Rechtssicherheit, sondern wird zunehmend zum Qualitätsmerkmal am Markt.
Strategische Absicherung und Versicherungen
Neben den bereits genannten Policen für Geschäftsführer*innen und den allgemeinen Betrieb lohnt sich eine Auseinandersetzung mit branchen- oder projektspezifischen Versicherungen. Cyber-Versicherungen etwa gewinnen an Bedeutung, da Angriffe auf IT-Infrastrukturen erhebliche finanzielle Verluste auslösen können. Warenkreditversicherungen werden ebenfalls relevant, wenn mit großen Liefermengen gearbeitet wird und Ausfälle die Liquidität bedrohen.
Eine gründliche Prüfung einzelner Versicherungsprodukte hilft dabei, den jeweils passenden Schutz zu finden. Pauschale Empfehlungen greifen selten, denn Umfang und Kosten variieren stark. Oftmals lässt sich aber ein individuelles Paket zusammenstellen, das zentrale Risikobereiche abdeckt, ohne das Budget über Gebühr zu belasten. Solche Maßnahmen fördern die Stabilität des Geschäftsmodells und signalisieren Stakeholder*innen, dass das Management verantwortungsbewusst handelt.
Praxisnahe Tipps für den Start-up-Alltag
Rechtliche Sorgfalt beginnt nicht erst bei formellen Verträgen oder Gerichtsstreitereien. Der tägliche Umgang mit E-Mails, Geschäftsgeheimnissen oder Kund*innendaten erfordert ebenso Aufmerksamkeit. Eine transparente Unternehmenskultur, in der rechtliche Belange offen diskutiert werden, senkt das Risiko teurer Fehler. Schulungen und Workshops können die Belegschaft für Themen wie Compliance, Geheimhaltung oder Datenschutz sensibilisieren.
Zusätzlich ist sinnvoll, Rechts- und Steuerberatung nicht nur punktuell, sondern als festen Bestandteil in Entscheidungsprozesse einzubinden. Regelmäßige Updates zu Gesetzesänderungen oder neuen Vorschriften verhindern böse Überraschungen. Außerdem entsteht durch enge Zusammenarbeit mit Expert*innen ein Netzwerk, das im Ernstfall rasch weiterhelfen kann. Dieser ganzheitliche Ansatz beschleunigt das Unternehmenswachstum, weil er Raum für strategische Überlegungen freihält und Streitfälle minimiert.
Schlussfolgerung
Zukünftige Erfolgschancen hängen stark von einer soliden und vorausschauenden Rechtsstrategie ab. Zwar sorgen neue Technologien und internationale Märkte für enorme Expansionsmöglichkeiten, bringen jedoch auch weitergehende Verpflichtungen, etwa im Bereich Datenschutz oder E-Commerce. Zusätzlich spielen Kooperationen mit etablierten Unternehmen eine immer größere Rolle, was harmonisierte Verträge und gegenseitiges Vertrauen voraussetzt.
Wer frühzeitig in die Qualität der eigenen Rechtsgrundlagen investiert, schafft damit die Basis für Stabilität und langfristige Chancen. Bei sorgfältiger Planung bleiben Start-ups flexibel, können Innovationen zügig vorantreiben und sind zugleich gewappnet für die Herausforderungen eines sich rasant wandelnden Wirtschaftsumfelds.
Gleiches Recht für alle
Obwohl es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz bereits lange gibt, wissen die wenigsten, was es damit alles auf sich hat. Und das kann sehr teuer werden. Was Sie als Arbeitgeber über das Gesetz wissen sollten.
Während Regelungen für Diskriminierungsverbote früher verstreut in verschiedenen Vorschriften und Gesetzen zu finden waren, hat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eine einheitliche gesetzliche Grundlage geschaffen. Darin ist sowohl der Anspruch auf Entschädigung als auch der auf Schadensersatz erstmals klar geregelt. Zur Anwendung kommt das Gesetz immer dann, wenn eine Benachteiligung oder Diskriminierung von Bewerbern, Mitarbeitern oder auch von Kunden vorliegt bzw. vermutet wird. Relevant wird das AGG für Gründer spätestens dann, wenn der erste (freie) Mitarbeiter eingestellt werden soll und eine Stellenausschreibung zu formulieren ist.
Was untersagt das AGG?
Per Gesetz verboten sind nicht nur belästigende Verhaltensweisen wie Mobbing oder sexuelle Belästigung, sondern auch jede Art von unmittelbarer und mittelbarer Benachteiligung. Unter einer unmittelbaren Benachteiligung ist zu verstehen, dass eine Person aufgrund der im AGG genannten Kriterien schlechter behandelt wird als eine andere und daher beispielsweise nicht eingestellt wird. Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn Vorschriften oder Verfahren im Unternehmen eine Person ohne sachliche Rechtfertigung benachteiligen. Was heißt das?
AGG-sichere Stellenanzeigen
Wer in einer Stellenanzeige „einen persönlichen Assistenten“ oder eine „junge Aushilfe“ sucht, begibt sich bereits auf dünnes Eis. Denn diese geschlechts- oder altersbezogenen Formulierungen sind unzulässig. Ernsthaft an der Stelle interessierte Bewerber können die Stellenausschreibung als Indiz für eine Diskriminierung sehen und innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Nichteinstellung eine Entschädigung verlangen. Diese liegt im Ermessen des Arbeitsgerichts und ist nur für den Fall auf bis zu drei Monatsgehälter gedeckelt, dass der Bewerber auch bei einer diskriminierungsfreien Auswahl nicht eingestellt worden wäre. Zwar lässt sich aus einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot kein Beschäftigungsverhältnis begründen, dennoch lohnt sich die bewusste Formulierung von geschlechtsneutralen Stellenausschreibungen. Geschlechtsneutral muss dabei nicht nur die Überschrift, sondern auch das Kleingedruckte formuliert sein.
Auf Nummer Sicher gehen Sie, wenn Sie die im Job zu erledigenden Tätigkeiten in den Mittelpunkt stellen und keine detaillierten Anforderungen formulieren. Gefährlich können selbst Formulierungen wie „stresserprobt“ oder „belastbar“ sein, da diese möglicherweise behinderte Bewerber ausschließen.
Plattformen rechtssicher gestalten: Neue rechtliche Vorgaben aus Brüssel
Was Unternehmer bei Aufbau und Gestaltung von Plattformen rechtlich beachten sollten, damit sie EU-rechtskonform bleiben.
Die EU hat den Digital-Markt für sich „entdeckt“: Schlag auf Schlag kommen neue Richtlinien und Verordnungen – also „EU-Gesetzestexte“ – mit spezifischen Anforderungen, die von Plattformen und anderen digitalen Produkten und Dienstleistungen erfüllt werden müssen. Das Ziel ist ein Europa, das „fit“ ist für das digitale Zeitalter. Gerade bei Aufbau und Gestaltung von Plattformen hat es jüngst einige Neuerungen gegeben, die Du beachten solltest.
Wer ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung entwickelt, muss auch etliche rechtliche Vorgaben beachten. Digitale Plattformen bergen dabei rechtlich einige besondere Hindernisse. Denn eine Plattform bringt nicht nur dein Unternehmen mit Endkunden zusammen, sondern eröffnet eine Interaktionsmöglichkeit zwischen den verschiedenen Playern auf deiner Plattform. Die großen Plattformen stehen deshalb gerade auch unter besonderer Beobachtung der Wettbewerbshüter. Dafür ist aber schon eine ganz starke Marktdurchdringung erforderlich.
Bei der Entwicklung einer Plattform ist es ratsam, die rechtskonforme Gestaltung möglichst früh in die Planungen einzubeziehen. Dies verhindert böse Überraschungen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Entwicklung bereits weit vorangeschritten ist. Oft wäre es zu Beginn sogar ein Leichtes gewesen, die rechtlich benötigten Buttons, Checkboxen und „Klicks“ einzubauen. Dies nachträglich zu tun, bindet (eigentlich nicht vorhandene) Ressourcen und verzögert im Worst Case den Launch der Plattform.
Besonders wichtig ist dabei:
1. Datenflüsse bestimmen und rechtskonform gestalten: Für jede Verarbeitung personenbezogener Daten muss eine Erlaubnisgrundlage gefunden werden. Das kann die Nutzungsvereinbarung sein, eine Einwilligung oder auch dein überwiegendes unternehmerisches Interesse. Das Ganze muss transparent in der Datenschutzerklärung beschrieben werden.
2. Nutzungsvereinbarung aufsetzen: Was kann und will ich verbindlich zusagen? Und welche Klauseln muss ich von Rechtswegen aufnehmen? Hier gibt es ganz aktuell neue Vorgaben aus der EU, wenn auf deiner Plattform Verträge geschlossen werden können zwischen Unternehmen und Verbrauchern.
3. Registrierungsprozess rechtskonform gestalten: Was muss ich tun, um die Nutzungsvereinbarung wirksam einzubeziehen? Und wie weise ich auf die Datenschutzerklärung hin? Benötige ich noch zusätzliche Einwilligungen? Muss ein Double Opt-In implementiert werden? Mit welchem Text?
4. Pflichtangaben beachten: Was muss ich auf meiner Plattform wie angeben, z.B. das Impressum oder Hinweise auf Streitschlichtung?
Datenflüsse gestalten und beschreiben
Plattformen leben von der Verarbeitung (auch) personenbezogener Daten. Sie stehen damit im Kreuzfeuer von EU-Datenschutzgrundverordnung und ePrivacy-Recht. Da hier bei Verstößen hohe Bußgelder drohen, ist es besonders wichtig, die Anforderungen von Anfang an eng im Blick zu halten. Das verschärfte EU-Recht im Datenschutz gilt inzwischen schon seit über zwei Jahren. Viele Einzelfragen sind trotzdem noch nicht geklärt und im Fluss, die datenschutzkonforme Gestaltung ist damit in jedem Einzelfall eine große Herausforderung. Mit transparent aufbereiteten Datenflüssen und einem frühzeitigen Abgleich, was zulässig ist, ist diese Herausforderung in der Praxis aber zumeist gut zu managen. Ressourcen sollten dafür aber unbedingt eingeplant werden.
Dies gilt gerade auch deshalb, weil das Datenschutzrecht umfassende Dokumentationen fordert: Die Prozesse müssen in sog. Verarbeitungsverzeichnissen beschrieben werden, die Risiken sind zu analysieren und womöglich in einer Datenschutzfolgenabschätzung umfassend aufzubereiten, den Plattformnutzern muss die Datenverarbeitung transparent in einer Datenschutzerklärung erläutert werden u.v.m.
Und auch für nicht personenbezogene Daten sind einige Spezialvorgaben der EU zu berücksichtigen, allen voran die Geoblocking-Verordnung (EU) 2018/302. Ihr Ziel ist es, dass alle EU-Bürger von überall her „like-a-local“ shoppen können. Der Online-Zugang zu einem Angebot darf deshalb nicht durch technische Mittel gesperrt werden, weil der Besucher von einem anderen Ort aus zugreifen möchte. In eine ähnliche Richtung zielt die Verordnung (EU) 2018/1807 über einen Rahmen für den freien Verkehr nicht-personenbezogener Daten in der EU, die Datenlokalisierungsauflagen grundsätzlich ebenso verbietet.
Nutzungsvereinbarungen im Einklang mit den EU-Vorgaben: die neue Platform-to-Business-Verordnung
Bevor die Plattform den Nutzern geöffnet wird, sollten zudem passende Nutzungsbedingungen geschrieben werden. Hierbei sind zwei Elemente ganz zentral:
- Du musst sehr klar festlegen, was du versprechen kannst und möchtest. Daran bist du nämlich gebunden und die wesentlichen Versprechen können nachträglich nicht mehr einseitig geändert werden. Was muss ich außerdem wegen der von mir genutzten Vorprodukte aufnehmen? Wenn ich Plattformen etwa auf Azure aufbaue, verpflichtet mich Microsoft, für eine ordnungsgemäße Nutzung zu sorgen und meinen Kunden bestimmte Pflichten aufzuerlegen, z.B. mit Passwörtern sorgfältig umzugehen. Und welche Open Source Elemente habe ich in meiner App integriert, für die ich die Lizenzbedingungen einhalten muss?
- Außerdem ist auf eine Reihe rechtlicher Vorgaben zu achten. Das deutsche AGB-Recht ist dabei sicherlich vielen geläufig. Anlass dieses Artikels ist dagegen ein anderer Rechtskreis: Die EU ist gerade sehr aktiv mit neuen Vorschriften für digitale Angebote. Das bringt neue Herausforderungen mit sich, da zunächst einmal identifiziert werden muss, welche Texte aus Brüssel nun für das eigene Produkt, die eigene Dienstleistung überhaupt relevant sind. Zahlenmäßig werden es immer mehr. Allerdings ist dies auch mit einer großen Chance verbunden, denn die Vorgaben der EU gelten regelmäßig auch gleichermaßen in der ganzen EU: Der Rollout über verschiedene Länder hinweg wird so (rechtlich) deutlich einfacher.
Für Plattformen gilt nun seit dem 12. Juli 2020 die sog. „P2B-Verordnung“. Mit vollem Namen heißt sie Verordnung (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten. Als EU-Verordnung müssen sich Unternehmen direkt an ihre Vorgaben halten. Anders, als bei EU-Richtlinien, können wir also nicht erst auf ein nationales Umsetzungsgesetz warten.
Die P2B-Verordnung richtet sich an alle Betreiber von Plattformen, auf denen Verträge zwischen gewerblichen und privaten Nutzern vermittelt werden oder die bei der Suche helfen. Paradebeispiele sind eBay, Amazon oder auch etsy. Die Größe ist der P2B-Verordnung egal: Auch Startups sind vom ersten Tag an erfasst, wenn sie auf ihrer Plattform Unternehmer und Verbraucher zusammenbringen.
Inhaltlich schreibt die P2B-Verordnung vor, wie der Plattformbetreiber seine Nutzungsbedingungen zu gestalten hat. Gerade bei jungen Projekten sticht hier etwa heraus, dass eine 30tägige Kündigungsfrist vorgesehen werden muss, um gewerbliche Nutzer von der Plattformnutzung ausschließen zu dürfen (mit Begründung). Das kann bei kurzen Entwicklungszyklen erheblich ausbremsen und sollte frühzeitig bedacht werden. Auch ist ein Beschwerdemanagement einzurichten. Bei Suchen oder Rankings muss erklärt werden, nach welchen Parametern gelistet wird.
Geschützt werden sollen durch diese Verordnung vor allem die gewerblichen Anbieter: Plattformbetreibern soll es nicht (mehr) möglich sein, durch undurchsichtige Listings oder intransparente Regelungen manche Anbieter zu befördern, andere dagegen auszubremsen. Das ist für große Plattformanbieter nachvollziehbar, für kleinere dagegen weniger.
Im Wesentlichen ist die Umsetzung der P2B-Verordnung mehr Fleißarbeit denn Hexenwerk. Gerade bei Neuentwicklungen kann sie hemmend wirken, jedenfalls in der trial and error-Phase. Wird sie nicht eingehalten, droht die Nichtigkeit der einzelnen Nutzungsbestimmung.
Wenn der Wald vor lauter Bäumen verschwindet
Bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass eine rechtskonforme Plattformgestaltung durchaus kein leichtes Unterfangen ist. Gerade von der EU sind in den letzten Monaten etliche Vorgaben gekommen, die sich in vielen verschiedenen Texten finden. Bei einer systematischen Herangehensweise ist aber auch dieser Herausforderung mit etwas Fleißarbeit und Liebe zum Detail gut zu meistern. Die vorstehende Übersicht möge hier dem ersten Zugang dienen.
Für das 4. Quartal 2020 hat die EU-Kommission übrigens noch einen neuen Digital Services Act angekündigt, der sich insbesondere mit Haftungsthemen und Verantwortlichkeiten bei illegalen Inhalten beschäftigen soll, erneut ein Plattformthema. Die Reise ist mithin noch nicht zu Ende und wird es wohl auch noch lange nicht sein. Dies kennen Sie vermutlich schon bestens vom Datenschutzrecht, das seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 auch fortlaufend mit neuen Erkenntnissen „Prozessoptimierungen“ erfordert. Es gilt daher: Wachsam bleiben. Die wirklich relevanten Anforderungen werden kommuniziert. Wer diese mit offenen Augen und Ohren aufnimmt, wird selten ins offene Messer laufen.
Die Autorin Dr. Kristina Schreiber ist auf die rechtliche Begleitung von Digitalisierungsprojekten spezialisiert und Partnerin bei Loschelder Rechtsanwälte
Abmahn(un)wesen: Was ist Recht – was Abzocke?
Nahezu täglich tauchen neue Berichte über teure Abmahnungen gegen Betreiber geschäftlicher Internet-Präsenzen auf. Viele Betroffene wissen nicht, was es mit diesen Forderungen auf sich hat und zahlen sofort, statt sich erst schlau zu machen. Wir klären auf.
Ob HomepageBetreiber, eBay-Verkäufer, Chat-User oder Tauschbörsennutzer, keiner scheint vor kostenintensiven Abmahnungen durch Rechtsanwälte sicher. Häufig sind sich die Betroffenen dabei keiner Schuld bewusst und fallen bei Erhalt einer Abmahnung aus allen Wolken.
Was steckt hinter dem Phänomen „Abmahnung“, warum sind so viele Internetnutzer davon betroffen und was ist daran rechtens? StartingUp bringt mit Hilfe des im Internetrecht erfahrenen Berliner Rechtsanwalts Timothy Ahrens Licht in diesen für Nichtjuristen schnell undurchschaubaren und im Zweifelsfall teuer werdenden Sachverhalt:
Definition: Was ist eine Abmahnung?
- Die Abmahnung ist eine außergerichtliche Aufforderung, also ein Mahnschreiben eines vermeintlichen Anspruchsinhabers an den Adressaten, in dem dieser aufgefordert wird, eine behauptete Rechtsverletzung unverzüglich einzustellen und zukünftig zu unterlassen.
- In dem Mahnschreiben wird der behauptete Rechtsverstoß beschrieben, und es wird erklärt, wogegen verstoßen wurde. Unter Setzung einer kurzen Frist (zirka eine Woche) wird dann die Beseitigung des Rechtsverstoßes und die Unterlassung für die Zukunft verlangt.
- Üblicherweise wird in der Abmahnung gleich auch Schadensersatz geltend gemacht und die Gebührenrechnung des abmahnenden Rechtsanwalts beigelegt.
Arbeitszeiten – so klappt es mit dem Gesetz
In Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten. Wie schaffen es junge Unternehmer, rechtliche Probleme damit zu vermeiden?
Früh anfangen und bis spät in die Nacht arbeiten, das Wochenende durch. Wer ein Unternehmen gründet, klotzt erst einmal ran. Überdurchschnittliche Motivation und Einsatz erwarten Gründer meist auch von ihren Mitarbeitern. Doch in Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten, die Arbeitnehmer schützen sollen. Wie schaffen junge Unternehmer es, rechtliche Probleme zu vermeiden? Und welche Möglichkeiten haben sie zur freien Gestaltung bei den Arbeitszeiten?
Welche Regeln gelten für Gründer?
In Deutschland unterliegen Mitarbeiterverhältnisse einer starken Reglementierung, für die größere Unternehmen eigens Juristen einstellen. Sicher nicht der erste Schritt in jungen Unternehmen, doch gelten für sie in Bezug auf das Arbeitsrecht genau die gleichen Gesetze wie für DAX-Konzerne. Ausnahmeregelungen gibt es nicht. Unabhängig von der Unternehmensgröße müssen Arbeitgeber bestimmte Mindestanforderungen einhalten:
- Mitarbeiter dürfen die tägliche (8h) und wöchentliche Höchstarbeitszeit (48h) nicht überschreiten. Zeitweise bis zu 10h täglich und 60 Stunden wöchentlich ist ohne besondere Begründung möglich, wenn die Arbeitszeit in sechs Monaten durchschnittlich höchstens acht Stunden pro Tag beträgt. Solche phasenweisen Anstrengungen durch hohe tägliche Arbeitszeiten müssen also zeitnah durch weniger Arbeit wieder ausgeglichen werden.
- Arbeitnehmer müssen Pausen und Ruhezeiten einhalten. Am Stück dürfen sie maximal sechs 6 Stunden arbeiten. Wer zwischen sechs und neun Stunden am Schreibtisch sitzt, muss mindestens 30 Minuten pausieren, bei über neun Stunden mindestens 45 Minuten. Und zwischen den Arbeitszeiten müssen mindestens ununterbrochen 11 Stunden liegen (mit Ausnahmen in einzelnen Branchen und bei Bereitschaft).
- Für Sonn- und Feiertage gilt ein Beschäftigungsverbot, ebenfalls mit branchenspezifischen Ausnahmen.
Für Gründer ist es ratsam, sich mit dem Wachsen der Firma frühzeitig über die Dos und Don'ts bei Arbeitszeiten zu informieren, denn es können spürbare Strafen drohen. Die gesetzliche Grundlage kann man zunächst im Arbeitszeitgesetz nachlesen. Vorsicht jedoch vor der eigenständigen Auslegung, das kann nach hinten losgehen. Die bessere Wahl, um sich einen Überblick zu verschaffen, sind zuverlässige Internetquellen aus Fachkreisen. Wer einen konkreten Fall klären will oder generell Lösungen für sein Unternehmen schaffen möchte, wendet sich am besten an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.
Die typischen Fallstricke
Für Jungunternehmer ist es nicht immer leicht, im Dickicht der Vorschriften den passenden Weg zu finden und angesichts der hohen eigenen Motivation für die Firma alle gesetzlichen Vorschriften zu befolgen.In der Praxis bekommen Gründer deshalb meist aus zwei Gründen Probleme:
1. Das Unternehmen versucht das Arbeitszeitgesetz zu umgehen, indem es Beschäftigte nicht als Arbeitnehmer einstuft, für die das Gesetz ausschließlich gilt. Das passiert häufig mit freien Mitarbeitern, die eigentlich normale Angestellte und somit scheinselbständig sind. Oder Mitarbeiter werden als leitende Angestellte ausgewiesen, weil für diese nicht alle Regelungen des Arbeitszeitgesetzes relevant sind. So entstehen auf einmal Teams, die ausschließlich aus leitenden Angestellten bestehen. Ob jemand jedoch in diese Kategorie fällt, entscheidet nicht der Arbeitgeber selbst durch die Vergabe einer Jobbezeichnung. Den Status bestimmen vielmehr Kriterien wie zum Beispiel die Weisungsgebundenheit des Mitarbeiters.
Gründer, die sich von diesem vermeintlichen Schlupfloch locken lassen, laufen Gefahr nachträglich Sozialabgaben und Steuern zahlen zu müssen. Und noch schlimmer: Der Beschäftigte könnte über seinen Arbeitnehmerstatus klagen.
2. Mitarbeiter machen zu viele Überstunden. Wer die Vorschriften zu den Arbeitszeiten in seiner Belegschaft missachtet, dem drohen Bußgelder, Nachzahlungen an den Arbeitnehmer und sogar Freiheitsstrafe.
Also Achtung, denn die Folgen sind ernst für Gründer! In der Regel haben junge Unternehmen keine finanziellen und zeitlichen Ressourcen für finanziellen Ahndungen oder kräftezehrende Gerichtsverfahren. Doch es gibt eine vollkommen legitime Möglichkeit, um nicht in die Falle zu tappen: Wer ganz legal Freelancer beschäftigt statt Mitarbeiter an sich zu binden, schafft sich viele Freiheiten vor allem in der Gründungsphase.
Homeoffice als Alternative?
Arbeiten von zuhause und nach individuellen Zeitvorstellungen, das ist längst keine Ausnahme mehr. In vielen Branchen ist Arbeiten im Homeoffice gut umsetzbar und sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer mit vielen Vorteilen verbunden. Doch auch hier gelten Vorschriften für den Arbeitsschutz, auch wenn die Einhaltung schwerer zu kontrollieren ist. Arbeitnehmer, die zum Beispiel am Nachmittag ihr Kind versorgen und dann abends bis spät arbeiten, laufen Gefahr, die Ruhezeiten nicht einzuhalten. Und die Verantwortung liegt auch hier beim Arbeitgeber. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigen, können sich aber absichern, indem sie
- eine Regelung zur Zeiterfassung finden,
- mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung über Arbeitsumfang und Ruhezeiten treffen und
- über feste Arbeitstage und Kernarbeitszeiten. Das erleichtert die Erreichbarkeit für Emails und Anrufe. Denn: Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gilt per Gesetz als Nachtarbeit.
Flexiblere Arbeitszeitmodelle – sind Anpassungen des Gesetzes in Sicht?
Mancher mag sich fragen, wie das deutsche Arbeitszeitgesetz eigentlich mit dem Geist in Start-up-Unternehmen zusammenzubringen ist. Tatsächlich stammt es aus dem Jahr 1994, und seither hat sich die Arbeitswelt stark verändert. Eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes tut daher auch aus anwaltlicher Sicht dringend Not, um es ins digitale Zeitalter zu überführen und an die Bedürfnisse von New Work und einen veränderten Arbeitsmarkt anzupassen. Im vergangenen Jahr gab es dazu Anregungen von Parteien, doch im Bundestagsausschuss kam es dann zu keiner Einigung.
Beispielsweise diskutierten die Politiker, die deutschen Regelungen an die Europäische Arbeitszeitrichtlinien anzugleichen. Konkrete Ideen sind, statt tägliche Höchstarbeitsstunden wöchentliche Grenzen bei der Arbeitszeit einzuführen. Alternativ könnten die täglichen Höchstgrenzen erhöht werden, ohne gleichzeitig die wöchentliche Arbeitszeit hochzuschrauben. Beide Ansätze verhindern die dauerhafte Überlastung von Mitarbeitern. Und sie erhöhen die Flexibilität für Betriebe, zum Beispiel wenn es in Phasen kurzzeitig viel zu tun gibt. Noch scheinen nicht alle Bundestagsfraktionen bereit für den Wandel zu sein. Klar ist aber: Früher oder später wird es Änderung beim Arbeitszeitgesetz geben müssen, um dem digitalen Zeitalter zu gerecht zu werden.
Weniger Stunden, mehr Produktivität – möglich für Gründer?
Die engen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes werden von Gründern nicht selten als hinderlich empfunden. Doch es gibt auch ganz andere Ansätze, die dem Pioniergeist von jungen Unternehmen entgegen kommen könnten. Beispiel Sechsstundentag: Menschen, die weniger arbeiten, sind deutlich produktiver und gleichzeitig weniger anfällig für Fehler und Krankheiten. Das zeigen zahlreiche Versuche mit einem Sechsstundentag in Unternehmen und Einrichtungen in Schweden. Die zunächst höheren Kosten zahlten sich dabei schnell durch die gesteigerte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter aus. Ist das vereinbar mit dem deutschen Recht? Ja, denn es gibt keine gesetzliche Mindestarbeitszeitdauer, geregelt ist nur die Höchstdauer. Arbeitgeber sind also frei, ob sie ihre Angestellten 8 Stunden oder eben weniger arbeiten lassen.
Fazit
An der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes führt auch für Gründer kein Weg vorbei. Vermeintliche Hintertüren des Gesetzes auszunutzen, birgt erhebliche Gefahren mit empfindlichen Folgen für Unternehmen und Verantwortliche. Es gibt jedoch auch innerhalb der Grenzen legitime Möglichkeiten, die Arbeitszeit für Mitarbeiter flexibler zu gestalten und ihre Motivation und den Enthusiasmus für das Unternehmen zu unterstützen. Und nicht zuletzt besteht Aussicht darauf, dass das Arbeitszeitgesetz in absehbarer Zukunft auch den Gegebenheiten des digitalen Zeitalters angepasst wird.
Die Autorin Franziska Hasselbach ist Rechtsanwältin bei der auf Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei Hasselbach in Köln, Frankfurt und Bonn.
Gewerberaum mieten
Der Mietvertrag über Gewerberaum weicht von den Regelungen des Wohnraummietvertrages ab. Hauptunterschied: Dem Gewerberaummietvertrag sind grundsätzlich keine gesetzlichen Schranken gesetzt. Daher sind vielfältige Ausgestaltungen im Gewerbemietrecht möglich, sofern die Vertragsparteien darüber Einigkeit erzielen. Es gilt umso mehr der stets aktuelle Grundsatz nach Friedrich Schiller: "Drum prüfe wer sich (ewig) bindet."
Denn der Gründer verliert als Gewerbetreibender oder auch als Freiberufler den Schutz des Verbraucherrechts, wenn er im Sinne seines Unternehmens handelt. Andererseits eröffnen sich jedoch für beide Vertragsparteien im Gewerbemietrecht flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten. Über Inhalt und Abschluss des Mietvertrages entscheidet im Fall der Gewerberaummiete damit in gleichem Maße die Sympathie, die Marktsituation wie auch das Verhandlungsgeschick der Vertragspartner bzw. deren jeweiliger Interessenvertreter.
Definition: Wohnraum und/oder Gewerberaum?
Die Abgrenzung, ob es sich um einen Mietvertrag über Wohnraum oder Gewerberaum handelt, kann schwierig werden, wenn die vermieteten Räume zugleich zu Wohn- und Betriebszwecken genutzt werden sollen. Gerade bei Gründern und insbesondere bei Freiberuflern fällt die klare Abgrenzung des Gewerbemietrechts zum privaten Mietrecht oft nicht leicht.
Typische Beispiele im freiberuflichen Bereich sind der Arzt oder Steuerberater, der vorn in den Räumlichkeiten seine Praxis bzw. sein Büro einrichtet und den hinteren Teil der Räume als privaten Wohnraum nutzt. In erster Linie kommt es darauf an, was nach dem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien – wie er im Vertrag festgelegt wird – den Schwerpunkt des Vertrages bilden soll. Soll also ein Wohnraum- oder Gewerberaummietverhältnis begründet werden?
Zweckentfremdung von Wohnraum kann teuer werden.
Die Fälle sind jedoch nicht immer so klar: wie im Beispiel eines Online-Händlers, der aus seiner Wohnung kurzerhand ein Warenlager macht. Besonders im letztgenannten Beispiel droht allerdings die außerordentliche fristlose Kündigung, da die Aufnahme eines Gewerbebetriebes in einem Wohnraum ohne die Zustimmung des Vermieters die Rechte des Vermieters erheblich verletzt. Man spricht in diesem Fall von einer Zweckentfremdung durch den Mieter.
Zudem drohen ordnungsrechtliche Sanktionen: In Zeiten immer knapper werdenden Wohnraums haben die Städte und Kommunen ihre Bußgelder teilweise drastisch erhöht. Bis zu 100.000 Euro sind beispielsweise nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz des Landes Berlin für diese Ordnungswidrigkeit durch den Verursacher zu entrichten. Wird dem Vermieter eine Zweckentfremdung seiner Mietsache bekannt, wird er diese schnellstens unterbinden wollen, um seine Haftung zu vermeiden, und da ist die außerordentliche fristlose Kündigung meist das Mittel der Wahl.
Doch so weit muss es nicht kommen: Wer die eventuell negative Reaktion seines Vermieters nicht scheut, kann auf Verständnis hoffen und diesen fragen. Lässt sich der Vermieter ein, sollte das gemeinsam gefundene Verständnis schriftlich fixiert werden. Zur rechtssicheren Formulierung sollte ein Anwalt hinzugezogen werden.
Vertragslaufzeit im Gewerbemietrecht: endlos?
Mietverträge über Gewerberaum werden häufig auf Zeit geschlossen (3, 5 oder mehr Jahre). Nach der Konzeption des Gesetzgebers ist eine Beendigung vor Ablauf der vorbestimmten Zeit nur schwer möglich. Bei einem auf unbestimmte Zeit geschlossenen Gewerberaummietvertrag kann jedoch zum Ende eines jeden Quartals ohne Angabe eines Grundes unter Einhaltung der Kündigungsfrist (regelmäßig 6 Monate) gekündigt werden.
Die Vor- und Nachteile beider Regelungsmöglichkeiten sollten frühzeitig abgewogen werden. Gemeinsam mit einem Berater können die verschiedenen Konzepte zu bedarfsgerechten, flexiblen Regelungen besprochen werden. Soll der Mietvertrag ein vorbestimmtes Ende haben, so ist die Formvorschrift des § 550 BGB zu berücksichtigen. Diese Vorschrift ordnet für Zeitmietverträge zwingend die Schriftform an. Wird bei Vertragsabschluss hiergegen verstoßen, so gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Wer trägt Rechte und Pflichten beim Gewerbemietvertrag?
Im Hinblick auf die gesetzlichen Mängelrechte können diese durch beide Vertragspartner einvernehmlich ausgeschlossen werden. Mit den sogenannten "Dach-und-Fach-Klauseln" kann es sogar noch einen Schritt weiter gehen: Dem Mieter kann vertraglich die Pflicht auferlegt werden, für die Instandsetzung und Instandhaltung des Gewerberaumes verantwortlich zu sein. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, macht sich der Mieter gegenüber dem Vermieter schadensersatzpflichtig. Dies hat die Rechtsprechung dann als zulässig angesehen, wenn dem Mieter im Gegenzug weitreichende Rechte ähnlich eines Eigentümers eingeräumt werden.
Wenn der Mieter durch den Vermieter also z.B. das Recht eingeräumt bekommt, erhebliche bauliche Veränderungen nach seinen eigenen, für den Gewerbebetrieb vorteilhaften Wünschen vorzunehmen, dann kann er grundsätzlich auch dazu verpflichtet werden, diese wirtschaftlich zu unterhalten. Gleichzeitig ist es möglich, von der gesetzlichen Verpflichtung des Mieters, die von ihm vorgenommenen baulichen Maßnahmen bei Beendigung des Mietverhältnisses wieder auszubauen, durch Vertrag abzuweichen.
Achtung: Mietrückstand!
Anders als im Wohnraummietrecht genießt der Mieter von Gewerberaum keinen besonderen Schutz, da dieser unter sozialen Gesichtspunkten nicht geboten ist. Dies hat letztendlich auch zur Folge, dass dem Mieter grundsätzlich auch schon bei Rückstand von weniger als einer Monatsmiete gekündigt werden kann.
Dies geht jedenfalls nach der Rechtsprechung dann, wenn besondere Umstände des Einzelfalles hinzukommen, die die Interessen des Vermieters gegenüber jenen des Mieters überwiegen lassen. Denkbar sind nach dem Bundesgerichtshof eine geringe Kreditwürdigkeit des Mieters oder eine kritische finanzielle Situation des Vermieters, die durch den Mietrückstand herbeigeführt wurde oder sie verschlimmert hat.
Abschließend lässt sich festhalten, dass Unternehmenserfolg neben wirtschaftlichem Sachverstand oft auch solide Kenntnisse der aktuellen Rechtslage erfordert. Und das fängt spätestens bei der Gestaltung des Gewerbemietvertrages an.
Der Autor, Mag. iur. Dennis Kallabis, ist als Jurist in einer Wirtschaftskanzlei in Düsseldorf tätig. Im Schwerpunkt hat er deutsches und europäisches Unternehmensrecht studiert.
Klug verhandelt ist die halbe Miete
Was ist bei der Anmietung von Räumen für das eigene Unternehmen zu beachten? Was sollte im Mietvertrag auf jeden Fall geregelt sein? Was muss man akzeptieren?
Geschäftsraummiete, Wohnraummiete und Pacht
Geschäftsraummiete liegt immer dann vor, wenn Räume nach dem vertraglichen Zweck zur gewerblichen oder freiberuflichen Nutzung angemietet werden. Bei Mischmietverhältnissen mit Wohn- und Gewerberaum gilt das Geschäftsraummietrecht, wenn mehr als die Hälfte der Gesamtfläche der Räume gewerblich genutzt wird. Die Rechtsvorschriften zur Pacht gelten, wenn ein komplett betriebsbereites Objekt, wie z.B. eine Gaststätte, zur Verfügung gestellt wird.
Mündlich oder schriftlich?
Um einen wirksamen Mietvertrag abzuschließen, müssen sich die Vertragsparteien über die „Gebrauchsüberlassung einer Mietsache gegen Entgelt für eine bestimmte Mietdauer“ verständigen. Ein Mietvertrag über Geschäftsräume kann auch mündlich geschlossen werden. Allerdings bedürfen Mietverträge, die für einen längeren Zeitraum als ein Jahr abgeschlossen werden, der Schriftform. Es empfiehlt sich aus Beweisgründen auf jeden Fall der Abschluss eines schriftlichen Mietvertrags.
Der inhaltlichen Gestaltung des Geschäftsraummietvertrags kommt besondere Bedeutung zu, denn der gesetzliche Schutz des Geschäftsraummieters ist nicht vergleichbar mit den gesetzlichen Schutzbestimmungen des Wohnraummieters. So gelten insbesondere weder Kündigungs- und Bestandsschutz noch die Sozialklausel noch die Vorschriften zur Regelung der Miethöhe und zum Räumungsschutz. Um sicher zu gehen, dass man als gewerblicher Mieter seine Rechtsposition sinnvoll absichert, empfiehlt es sich, anwaltliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen und den Geschäftraummietvertrag sorgfältig zu verhandeln.
Mietgegenstand und Nutzungsbestimmung
Das Gewerberaummietobjekt muss nach Anschrift, Lage und Umfang genau im Vertrag beschrieben sein. Ein Gewerberaummietvertrag enthält häufig auch eine Nutzungsbestimmung, die man aus Mietersicht möglichst weit formulieren sollte, z.B. "zur gewerblichen Nutzung".
Mietzins, Nebenkosten und Kaution
Die Miethöhe kann bei Vertragsabschluss zwischen den Vertragsparteien frei vereinbart werden, wobei ortsübliche Vergleichsmieten ein Maßstab für den geforderten Mietzins sein sollten. Mietwucher ist verboten. Gezahlt wird der Mietzins in monatlichen Beträgen, jeweils zu Beginn eines Monats im Voraus. Grundsätzlich sind nach dem Gesetz mit dem Mietzins alle Nebenkosten (also die Betriebskosten) abgegolten. In der Praxis der Geschäftsraummietverträge werden die Betriebskosten allerdings meist unter Bezugnahme auf die Betriebskosten-Verordnung ganz oder teilweise auf den Mieter umgelegt. Es ist ratsam, die Nebenkostenbestimmungen im Vertrag sehr sorgfältig zu verhandeln.
Mietzeit – am besten mit Verlängerungsoption
Die Laufzeit des Vertrags kann frei vereinbart werden. Es empfiehlt sich, im Fall eines befristeten Mietverhältnisses, eine Verlängerungsklausel vorzusehen, wonach sich das Mietverhältnis über die feste Vertragsdauer hinaus automatisch um eine bestimmte Zeitspanne verlängert, wenn es nicht zum Ablauf der Mietzeit von einer der Vertragsparteien gekündigt wird. Aus wichtigem Grund ist das Mietvertragsverhältnis für beide Parteien jederzeit kündbar.
Die Beendigung einer gewerblichen Tätigkeit oder wirtschaftliche Schwierigkeiten stellen jedoch grundsätzlich keinen wichtigen Grund dar, um das Mietverhältnis zu kündigen, es sei denn, im Vertrag ist ein Sonderkündigungsrecht für den Mieter vorgesehen für den Fall des Nichterreichens konkret genannter Mindestumsatzerwartungen über einen bestimmten Zeitraum. Insgesamt empfiehlt sich ein sehr gut verhandelter individueller Mietvertrag, um das eigene Unternehmen am gewählten Standort viele Jahrzehnte erfolgreich mit überschaubaren Mietkosten etablieren zu können.
Für eine Handvoll Euro
Wenn Streitigkeiten mit Geschäftspartnern oder Kunden drohen, bietet die Mediation eine sinnvolle und günstige Alternative zum teuren Rechtsstreit.
Wenn man Gründer fragt, worauf sie besonders stolz sind, dann sprechen sie vielleicht über den ersten großen Auftrag, über die reibungslose Finanzierung durch die Bank oder sie erzählen von der super Stimmung im Gründer-Team. A. Meier und H. Habermehl (Namen von der Redaktion geändert), seit Juli 2010 Inhaber einer eigenen Firma, verweisen hingegen auf einen Passus in ihrem Gesellschaftervertrag. Auf diesen Passus sind sie stolz, denn er beugt vor, falls die beiden Geschäftsführer und Gesellschafter sich einmal nicht mehr so gut verstehen.
Wenn sie sich einmal nicht einigen können oder gar Streit entsteht. Dann, so steht in dem Papier, werde man keinesfalls direkt vor den Kadi ziehen, sondern erst einmal einen unparteiischen Dritten, einen sogenannten Mediator, zu Rate ziehen.„Wir halten beide 50 Prozent der Gesellschafteranteile, da kann es nun einmal zu Patt-Situationen kommen“, erklärt Meier. Und weil solche Situationen der Firma bzw. der Unternehmung nicht schaden sollen, musste das Gründerduo eine Lösung finden – die Mediation.
Killerfaktor Dauerstreit
Bei der Mediation handelt es sich um ein alternatives Konfliktlösungsverfahren, das auf vermittelnden Gesprächen basiert. So soll etwa der Gang vor den Kadi und die damit verbundenen negativen Begleiterscheinungen abgewendet werden. Zumal Rechtsstreitigkeiten in der Regel lange, oft zu lange dauern. Denn während die Streithähne ihre Energie vor Gericht verpulvern, kocht das Unternehmen auf Sparflamme, wichtige Entscheidungen unterbleiben. Außerdem zerrt ein Prozess derart an den Nerven der Beteiligten, dass das angeknackste Verhältnis zwischen den Streithähnen am Ende meist ganz zerrüttet ist. Auch das zieht negative Konsequenzen für die Firma nach sich, etwa wenn sich ein einst funktionierendes Geschäftsführerduo trennt oder ein wichtiger Geschäftspartner abspringt. Zu dem wirtschaftlichen Schaden kommt hinzu, dass der Ruf ruiniert wird. Am Ende wenden sich Kunden und Mitarbeiter ab. Wenn es richtig schlecht läuft, kann die Firma nach dem Prozess einpacken.
Dieses Risiko können Unternehmen mit Hilfe der Mediation vermeiden. Schließlich geht es hierbei – anders als beim Gerichtsverfahren – nicht darum, um jeden Preis Recht zu bekommen, sondern ganz im Gegenteil darum, zu kooperieren. „Es ist wie mit den Kindern und der Orange“, erklärt Volker Schlehe, Leiter des IHK-MediationsZentrums München die Arbeitsweise: Wenn sich zwei Kinder um eine Orange streiten, würde ein Richter jedem Kind die Hälfte der Frucht zuteilen. Der Mediator aber fragt, was die Kinder mit der Orange machen wollen. „Und dann kommt vielleicht heraus, dass ein Kind den Saft will und das andere die Schale.“
Mobilitätsbudget – das musst du wissen
Eine Wochenkarte für Bus und Bahn, eine kurze Fahrt mit dem E-Roller oder doch lieber das Car-Sharing-Angebot bei schlechtem Wetter? Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden dafür ein Mobilitätsbudget zur Verfügung stellen, sollen bald eine neue Möglichkeit der Pauschalbesteuerung nutzen können. Welche Voraussetzungen dazu erfüllt sein müssen, liest du hier.

Was ist das Mobilitätsbudget?
Das Mobilitätsbudget ist ein Angebot von Unternehmen für ihre Mitarbeitenden, alternative Verkehrsmitteln für privat veranlasste Reisen zu nutzen. Das Unternehmen stellt dafür einen bestimmten Betrag zur Verfügung, die Mitarbeitenden können die Verkehrsangebote je nach aktuellen Bedürfnissen, Verfügbarkeit und persönlichen Präferenzen flexibel miteinander kombinieren. Das Mobilitätsbudget ist damit eine gute Alternative zum privaten Auto oder Dienstwagen.
Was ist jetzt neu?
Im Regierungsentwurf für ein Jahressteuergesetz 2024 wurden die Rahmenbedingungen für ein Mobilitätsbudget definiert und steuerliche Anreize für dessen Nutzung geschaffen. So sollen Unternehmen die Möglichkeit erhalten, den damit verbundenen geldwerten Vorteil für Arbeitnehmende pauschal mit 25 Prozent zu versteuern. Die Regelungen zur Dienstwagenbesteuerung sollen damit nicht verändert werden.
Welche Verkehrsmittel können genutzt werden?
Unternehmen können die Angebotswahl in ihrem Mobilitätsangebot selbst bestimmen. Grundsätzlich können neben ebenfalls steuerlich geförderten Jobtickets auch Budgets für die gelegentliche Inanspruchnahme von Sharing-Angeboten wie E-Roller, Leihräder oder Carsharing-Autos, enthalten sein. Auch Einzelfahrkarten, Zeitkarten und Ermäßigungskarten für den Bus- und Bahnverkehr, also etwa der monatliche Anteil einer BahnCard, können Teil des Mobilitätsbudgets sein.
Was fällt nicht unter das Mobilitätsbudget?
Die dauerhafte und nicht nur gelegentlichen Nutzung von Pkw ist ausgeschlossen. Auf Dauer ausgelegte Mietwagen-, Leasing- oder Abo-Modelle fallen also nicht unter das Mobilitätsbudget. Gleiches gilt für Luftfahrzeuge, Privatwagen der Mitarbeitenden und dauerhaft auch zur privaten Nutzung überlassene Dienstwagen. Wird für die Arbeitnehmenden bereits eine Pauschalbesteuerung für die Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte vorgenommen, kann die Pauschalbesteuerung für ein Mobilitätsbudget nicht dafür in Anspruch genommen werden.
Wer muss das Mobilitätsbudget versteuern?
Grundsätzlich müssen die Mitarbeitenden einen solchen geldwerten Vorteil versteuern. Die Betriebe hingegen müssen entsprechende Sozialversicherungsbeiträge abführen. Werden die Pläne der Regierung umgesetzt und entschließen sich Unternehmen dann das Mobilitätsbudget künftig selbst pauschal mit 25 Prozent zu versteuern, ist dieses beitragsfrei.
Was sind die Voraussetzungen für eine Pauschalbesteuerung?
Die pauschale Versteuerung ist nur zulässig, wenn Betriebe das Mobilitätsbudget zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewähren. Zudem ist die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung auf einen Höchstbetrag von 2.400 Euro im Kalenderjahr begrenzt und kann nicht für bereits pauschal versteuerte Sachbezüge oder Zuschüsse genutzt werden. Die Regelungen sind also nur alternativ anwendbar.
Tipp: Was solltest du jetzt tun?
- Behalte die geplanten Steuerbegünstigungen im Blick!
- Prüfe, ob deine Belegschaft Interesse an einem Mobilitätsbudget als Benefit hat.
- Sprich mit deinem/deiner Steuerberater*in, um zu klären, welche Vor- und Nachteile eine Pauschbesteuerung für dein Unternehmen hat.
Der Autor Andreas Islinger – LL.M. Sozialrecht, Master of Arts in Taxation – ist Partner, Steuerberater und Leiter Rentenberatung und Lohnzentrum bei ECOVIS in München.
Genussrechte – eine bessere Alternative der Mitarbeitendenbeteiligung?
Seit der Verabschiedung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes wird eine bisher wenig beachtete Methode der Mitarbeitendenbeteiligung für Jungunternehmen interessant: Genussrechte. Warum es sich lohnt, diese Alternative genauer zu betrachten.
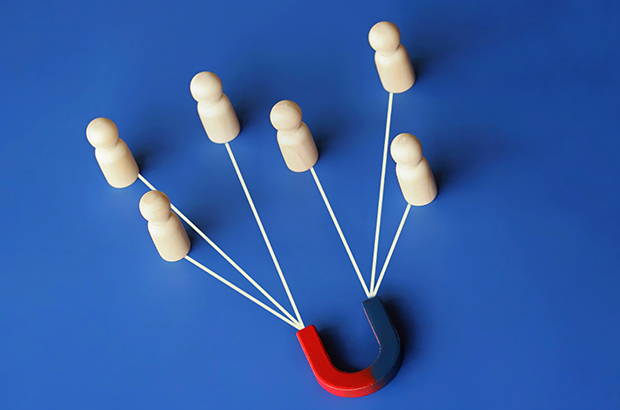
Beteiligungen für Mitarbeitende sind für junge Unternehmen essentiell, um auf dem Arbeitsmarkt um die besten Talente konkurrieren zu können. Arbeitnehmende müssen sich dank gut ausgestalteter Beteiligungsprogramme nicht mehr zwischen lukrativem Gehalt und innovativem Arbeitgebenden entscheiden – wovon insbesondere Start-ups profitieren.
Die technische Umsetzung eines Beteiligungsprogramms für Mitarbeitende kann auf unterschiedliche Arten und Weisen erfolgen. Aktuell sind in Deutschland Virtual Stock Option Plans (VSOPs) die gängige Form in der Praxis. Doch seit der Verabschiedung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes wird eine weitere – bisher wenig beachtete – Methode für Jungunternehmen interessant: Genussrechte. Doch welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben Genussrechte und VSOPs und warum lohnt es sich, diese Alternative genauer zu betrachten?
Virtuelle Beteiligung
Im deutschen Venture Capital-Markt werden Mitarbeitendenbeteiligungen typischerweise durch virtuelle Anteile abgebildet (VSOPs). Mitarbeiter*innen werden dabei wirtschaftlich so gestellt, als hätten sie eine echte (gesellschaftsrechtliche) Beteiligung am Unternehmen erhalten. Allerdings erhalten Beschäftigte bei VSOPs nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen das Unternehmen. Das bedeutet, dass sie im Falle eines Exits eine Sonderzahlung erhalten. Dabei ist der Strukturierungs- und Verwaltungsaufwand gering, da Unternehmen zur vertraglichen Beteiligung in der Regel auf standardisierte Verträge zurückgreifen können. Da keine Gesellschaftsanteile übertragen werden, gelangen keine Mitarbeiter*innen in das Cap Table und der Gang zum Notariat bleibt erspart. Nachteilig sind hingegen die steuerlichen Konsequenzen für die Mitarbeitenden: Bei entsprechender Ausgestaltung kommt es zwar zum Zeitpunkt der Ausgabe der virtuellen Beteiligung nicht zu einer Besteuerung der Mitarbeiter*innen. Allerdings unterliegt der Erlös dann bei Zahlung der normalen Lohnversteuerung mit einem Spitzensteuersatz von 45 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.
Genussrechte als Alternative?
Aufgrund aktueller steuerlicher Gesetzesänderungen rückt eine andere Gestaltungsmöglichkeit (wieder) in den Fokus: eigenkapitalähnliche Genussrechte. Im Folgenden werfen wir einen detaillierten Blick auf das Beteiligungsmodell.
Ausgestaltung
Genussrechte können inhaltlich annähernd genauso flexibel ausgestaltet werden wie VSOPs und stellen aus juristischer Sicht ebenfalls keine reale Beteiligung dar, sondern nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen das Unternehmen auf die Beteiligung am Gewinn. Aber auch eine Teilhabe am klassischen Exit-Erlös kann vereinbart werden. Bei der Ausgabe der Genussrechte leistet der Arbeitnehmende entweder eine Kapitaleinlage oder er erhält das Genussrecht schlicht unentgeltlich/verbilligt. Genussrechte können vom Arbeitgeber zu einem beliebigen Nennwert ausgegeben werden und eine Teilhabe am Gewinn und/ oder einem Liquidations-/Exiterlös mit oder ohne Verzinsung sowie mit oder ohne Verlustbeteiligung vermitteln.
Aufwand und praktische Umsetzung
Verträge für Genussrechte können für nahezu jede Gesellschaft maßgeschneidert gestaltet werden. Die Ausgabe obliegt – wie auch bei VSOPs – grundsätzlich der Geschäftsführung. In der Praxis sollte bei der Ausgabe ein entsprechender Gesellschafterbeschluss die Geschäftsführungsmaßnahme flankieren, um mögliche Streitigkeiten in Bezug auf die Wirksamkeit der Maßnahme vorzubeugen. Oftmals ist dies aufgrund von satzungsrechtlichen Zustimmungsvorbehalten ohnehin notwendig.
Der Beteiligungs- und Verwaltungsaufwand ist gering, da Unternehmen – wie bei den VSOPs – auf standardisierte Verträge zurückgreifen können. Formerfordernisse sind nicht gegeben und ein Gang zum Notar ist ebenfalls nicht notwendig.
Die für Mitarbeitendenbeteiligungen üblichen Vesting- bzw. Leaver-Regelungen unterscheiden sich bei den Genussrechten von den VSOPs kaum. Ein Augenmerk sollte bei einem Verfall aufgrund eines Leaver-Events auf die Rückübertragung von Genussrechten an den Arbeitgebenden gelegt werden. Dies sollte im Beteiligungsprogramm geregelt werden.
Steuerliche Vorteile der Genussrechte
Die Gewährung von Genussrechten (wie auch von echten Anteilen) führte bislang zum Zeitpunkt der Zuteilung zu einer lohnsteuerpflichtigen Sachzuwendung in Höhe des Marktwerts der gewährten Beteiligung, auch wenn noch kein Exit-Erlös erzielt wurde (Dry-Income-Problematik). Dafür profitieren echte Anteile sowie Genussrechte von einem linearen Steuertarif für Kapitaleinkünfte mit einem maximalen Steuersatz von 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer (§ 32d EStG).
Zukunftsfinanzierungsgesetz – Steuerliche Begünstigung von Genussrechten
Mit Inkrafttreten des Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) am 1. Januar 2024 hat der Gesetzgeber die Regelungen des § 19a EStG überarbeitet, um die genannte Dry-Income-Problematik zu mildern und um Beteiligungen für Mitarbeitende im Venture Capital-Bereich attraktiver zu machen. Die Vorschrift findet sowohl auf echte Anteile wie auch auf Genussrechte Anwendung.
Eine Dry-Income-Problematik besteht zwar bei VSOPs nicht, denn die Lohnsteuerpflicht fällt bei entsprechender Strukturierung bei VSOPs erst zum Zeitpunkt eines Exits in Höhe des individuellen (progressiven) Steuersatzes mit maximal 45 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer an. Der lineare Steuertarif für Kapitaleinkünfte (max. 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) auf etwaige Wertzuwächse findet im Rahmen der VSOPs jedoch gerade keine Anwendung – im Gegensatz zu eigenkapitalähnlich ausgestalteten Genussrechten. Damit können Genussrechte bei entsprechender Ausgestaltung das „Beste aus beiden Welten“ vereinen: Einen Besteuerungsaufschub im Rahmen der Lohnsteuer für die unentgeltliche/verbilligte Einräumung des Genussrechts und einen niedrigen Steuertarif für Kapitaleinkünfte bei der Realisierung des Wertzuwachses beim Exit. Sollte der Wert des Genussrechts dann niedriger sein als zum Zeitpunkt der Gewährung, ist für die aufgeschobene Lohnsteuer dann auch nur der niedrigere Wert maßgebend.
Bedingungen für den Besteuerungsaufschub
Der Besteuerungsaufschub für etwaig anfallende Lohnsteuer im Zusammenhang mit der unentgeltlichen/verbilligten Einräumung wird unter bestimmten Voraussetzungen gewährt: Zu diesen zählt, dass eine qualifizierte Unternehmensbeteiligung vom Arbeitgebenden zusätzlich zum regulären Arbeitslohn unentgeltlich oder vergünstigt am Unternehmen eingeräumt wird (keine bloße Entgeltumwandlung), die Gründung des Unternehmens nicht länger als 20 Jahre zurückliegt und das Unternehmen zum Zeitpunkt der Einräumung des Genussrechts einen Jahresumsatz von EUR 100 Mio. oder eine Jahresbilanzsumme von EUR 86 Mio. nicht überschreitet sowie nicht mehr als 1.000 Mitarbeitende hat.
Dies stellt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der eigenkapitalähnlichen Genussrechte gegenüber den VSOPs dar. Denn eine Beteiligung über virtuelle Anteile an einem Unternehmen gilt gerade nicht als Vermögensbeteiligung im Sinne des § 19a EstG i.V.m. dem 5. VermBG und profitiert somit – anders als die Genussrechte – nicht von der Begünstigung des § 19a EStG.
Der Besteuerungsaufschub endet nach § 19a EStG erst, wenn entweder das Genussrecht ganz oder teilweise entgeltlich oder unentgeltlich übertragen wird (Exit) oder das Dienstverhältnis beendet wird, spätestens aber nach 15 Jahre. Sofern das Unternehmen gegenüber dem Finanzamt unwiderruflich erklärt, im Exit-Fall für die Lohnsteuer zu haften, endet der Besteuerungsaufschub auch nicht beim Wechsel des Arbeitgebenden oder spätestens nach 15 Jahren, sondern tatsächlich erst beim Exit.
Fazit
Für die Einführung eines Beteiligungsprogramms für Mitarbeitende in Form von eigenkapitalähnlichen Genussrechten bzw. die Umstellung eines bestehenden virtuellen Mitarbeitendenbeteiligungsprogramms (VSOP) auf eigenkapitalähnliche Genussrechte sprechen steuerrechtliche Vorteile. Dazu zählt insbesondere der Besteuerungsaufschub für etwaig anfallende Lohnsteuer im Zusammenhang mit der unentgeltlichen/ verbilligten Einräumung und die Anwendung des linearen Steuersatzes für Kapitaleinkünfte auf etwaige Wertzuwächse. Hierdurch bekommen Start-ups im umkämpften Arbeitsmarkt um die besten Talente starke Argumente im Vergleich zur Konkurrenz.
Allerdings sollten sich Unternehmer*innen durch eine fachkundige Beratung absichern, um Risiken von eigenkapitalähnlichen Genussrechten vorzubeugen. Dazu zählen insbesondere die saubere Strukturierung zur Einhaltung der steuerlichen Erfordernisse sowie die Abwägung mit alternativen Modellen, insbesondere virtuelle und reale Beteiligungsmodelle für Mitarbeitende.
Die Autoren:
Dr. Andreas Demleitner ist Rechtsanwalt & Steuerberater im Bereich Corporate Tax bei PwC und berät als Partner sowohl Start-ups als auch Investor*innen im Venture Capital-Umfeld mit den Schwerpunkten Durchführung von Finanzrunden und Implementierung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen, Andreas.demleitner@pwc.com
Dr. Minkus Fischer, EMBA, ist Local Partner bei PwC Legal im Bereich Legal Deals im Stuttgarter Büro. Er berät seit über zehn Jahren in den Bereichen Corporate/M&A, mit einem Schwerpunkt in Venture Capital-Transaktionen, Minkus.fischer@pwc.com
Die Chancen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes
Wenn Deutschland wieder ein Gründer*innenland werden soll, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Das hat der Gesetzgeber erkannt und zuletzt mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz einen bunten Strauß von Vorschlägen geflochten. Für Gründer*innen bieten sich so neue Chancen.

Unter steuerlichen Gesichtspunkten erwies sich bislang eine Holdingstruktur als vorteilhaft, wobei die operative Gesellschaft (GmbH) von einer ebenfalls als GmbH gestalteten Gesellschaft gehalten wurde, welche ihrerseits von dem / der Gründenden gehalten wurde. Vielfach wurde zwischen den beiden Gesellschaften noch eine Organschaft geschlossen, der ein Ergebnisabführungsvertrag zugrunde lag. Diese Struktur ermöglichte es einerseits, etwaige Gewinne lediglich mit einem kombinierten Steuersatz aus Gewerbe- und Körperschaftsteuer von circa 30% vorzubelasten, die dann als Ausschüttung von der natürlichen Person mit dem Abgeltungsteuersatz von 25% bezogen werden konnte. Andererseits war eine nahezu steuerfreie Veräußerung der operativen Gesellschaft möglich. Dieser Veräußerungserlös konnte dann wieder investiert werden und löste erst im Rahmen einer späteren Ausschüttung an den Gründer eine weitergehende Besteuerung in Höhe des Abgeltungsteuersatzes von 25% aus.
2021: Rechtsformneutralität bringt gleiche steuerliche Ergebnisse
Mit der Option zur Körperschaftsteuer können Gründende einer Personengesellschaft nunmehr das gleiche steuerliche Ergebnis erzielen, denn 2021 schuf der Gesetzgeber mit dem Körperschaftmodernisierungsgesetz eine Rechtsformneutralität bezüglich der Besteuerung von Unternehmen zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften, indem er der Personengesellschaft ein Wahlrecht zur Körperschaftsteuer eingeräumt hat. Das aus gesellschaftsrechtlicher Perspektive oft vorteilhaftere Personengesellschaftsrecht kann also gewählt werden, ohne dadurch steuerliche Nachteile gegenüber einer Kapitalgesellschaft zu erleiden.
Steuerliche Rahmenbedingungen für Mitarbeitervergütungen
Genauso wichtig sind die steuerlichen Rahmenbedingungen für Mitarbeitervergütungen. In den letzten Jahren wurden hier zwar gesetzliche Änderungen vorgenommen, diese konnten aber nur unzureichend die Realität und Bedürfnisse der Start-ups abdecken. Im Kern geht die Besteuerung davon aus, dass Arbeit jeweils gleich besteuert und nicht einer unternehmerischen Beteiligung gleichgestellt werden soll: Die Besteuerung für den/die Gründenden selbst mit seiner/ihrer Gesellschaft gilt eben nicht für die Mitarbeitenden, obwohl sie, wie der/die Gründer*innen auch, ebenfalls ihre Arbeits- und Innovationskraft einbringen.
Echte Beteiligung als Instrument immer noch realitätsfern?
Vor diesem Hintergrund scheint der einfachste Weg eine echte Beteiligung der Mitarbeitenden am Unternehmen. So erhalten sie Gewinnausschüttungen und sind an Exit-Erlösen beteiligt. Sie erlangen im Gegenzug aber auch alle mit einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung verbundenen Rechte (etwa Teilnahme- und Stimmrechte) und Pflichten (beispielsweise Treuepflichten). Ein solcher gesellschaftsrechtlicher Einfluss ist aus Sicht des Gründenden nicht immer wünschenswert, da er seine gestalterische Freiheit einschränken kann. Steuerlich stellt sich bei echten Beteiligungen das Problem, wenn die jeweilige Beteiligung unter dem Verkehrswert des Unternehmens gewährt wird. Dann liegt ein geldwerter Vorteil in Höhe der Differenz vor, der mit Zufluss einer Besteuerung wie Lohn unterliegt, obwohl keine Liquidität erlangt wird (Dry Income).
Lösung der Dry Income-Problematik
Dieses Problem hat der Gesetzgeber im Juli 2021 mit § 19a EStG abzumildern versucht, indem die Besteuerung aufgeschoben wurde. Die Einzelheiten und Anforderungen an einen solchen Steueraufschub wurden aber als realitätsfern und unzureichend angesehen. Ungewöhnlich zügig reagiert der Gesetzgeber nun mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz hierauf:
- Die Besteuerung des geldwerten Vorteils aus der Beteiligung soll mit Veräußerung oder Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgen; ab 2024 spätestens 20 statt bisher zwölf Jahre nach deren Übertragung.
- Im Falle des Rückerwerbs der Anteile bei Verlassen des Unternehmens soll nur die tatsächlich an den/die Mitarbeitenden gezahlte Vergütung maßgeblich sein, wodurch insbesondere in Leaver-Fällen, in denen der Kaufpreis in der Regel unterhalb des Verkehrswerts der Beteiligung liegt, das Risiko einer Besteuerung von nicht realisierten Werten entschärft wird.
- Eine Besteuerung wird weitergehend bis zum Zeitpunkt des tatsächlichen Verkaufs hinausgeschoben, wenn der/die Arbeitgebende auf freiwilliger Basis unwiderruflich erklärt, dass er/sie die Haftung für die einzubehaltende und abzuführende Lohnsteuer übernimmt.
Hierzu müssen die Beteiligungen
- nicht vom Arbeitgebenden selbst, sondern können auch durch (Gründungs-)Gesellschafter*innen gewährt werden;
- nicht solche des Unternehmens des Arbeitgebenden, sondern können auch konzernangehörige Beteiligungen sein.
Des Weiteren wird der Anwendungsbereich dergestalt ausgeweitet, dass
- begünstigte Unternehmen solche mit bis zu 1.000 Mitarbeitenden sind, die einen Jahresumsatz von höchstens 100 Mio. EUR oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 86 Mio. EUR aufweisen, wobei diese Schwellenwerte im Zeitpunkt der Übertragung der Beteiligung oder in einem der sechs vorangegangenen Kalenderjahre nicht überschritten sein dürfen, und
- der maßgebliche Gründungszeitraum des Unternehmens maximal 20 Jahre vor dem Beteiligungszeitpunkt liegen darf.
Steuerliche Stärkung unter anderem durch Pauschalbesteuerung
Weitergehend kann der durch die Anteilsübertragung gewährte geldwerte Vorteil bei dem Mitarbeiter pauschal mit einem Steuersatz in Höhe von 25% besteuert werden und unterliegt nicht mehr dem persönlichen Einkommensteuersatz. Auch wird der Freibetrag für die verbilligte oder unentgeltliche Überlassung von Mitarbeiterkapitalbeteiligungen vom Arbeitgeber ab 2024 von derzeit 1.440 auf 5.000 EUR jährlich erhöht, was auch zu einer Sozialversicherungsfreiheit in gleicher Höhe führt. Dies erfordert aber, dass es sich um eine freiwillige Leistung des Arbeitgebenden handelt, die grundsätzlich allen Mitarbeitenden des Unternehmens offensteht, die ein Jahr oder länger ununterbrochen in einem gegenwärtigen Dienstverhältnis zu diesem stehen. Daher ist dieses Tool für eine reine Managementbeteiligung nicht geeignet.
Was das Zukunftsfinanzierungsgesetz vermissen lässt
Bedauerlicherweise hat der Gesetzgeber keine Anpassung im Vermögensbildungsgesetz vorgenommen, auf welchem die Begünstigungen für die Mitarbeiterbeteiligungen aufbauen. Diese Regelungen kommen nicht zur Anwendung, wenn es sich beim Start-up um eine Personengesellschaft handelt, die sich für die Körperschaftsteuer entscheidet – und deshalb steuerlich wie eine Körperschaft behandelt wird.
Alternative Beteiligungsmodelle noch notwendig?
Dem Problem des Dry Income begegnete die Gestaltungspraxis bislang durch Hurdle- oder Growth Shares. Bei Hurdle Shares erfolgt lediglich eine Beteiligung an den zukünftigen Wertsteigerungen, weshalb diese im Zeitpunkt der Gewährung grundsätzlich nicht zu einem sofortigen steuerlich relevanten Lohnzufluss führen. Weiterhin haben sich Virtual Shares oder Virtual Options als Instrument der Incentivierung von Mitarbeitenden erwiesen. Mit solchen Ansprüchen vermeidet man wegen ihrer rein schuldrechtlichen Ausgestaltung eine gegebenenfalls nicht gewünschte Teilhabe an Zukunftsfragen des Unternehmens. Steuerlich betrachtet stellt lediglich die jeweilige (indirekte) Partizipation an den Gewinnen und/oder dem Exit-Erlös zu besteuernden Lohn dar. Dieser wird nach dem individuellen Steuersatz besteuert, sodass die steuerlichen Regelungen für Einkünfte aus Kapitalvermögen nicht angewendet werden. Dem/der Mitarbeitenden fließt hier nicht bereits mit Einräumung dieser Ansprüche etwas zu, sodass sich das Dry Income-Problem nicht stellt.
Fazit
Die Regierung ist das Thema verbesserter steuerlicher Rahmenbedingungen angegangen. Man ist dabei zwar noch lange nicht bei den Vergünstigungen, die andere Standorte insoweit genießen – aber es ist ein wesentlicher Schritt. Nun müssen die Gründenden die jeweiligen Weichen selbst stellen.
Zu den Autoren:
Dr. Matthias Geurts ist Partner bei der Kanzlei Schalast und berät Venture Capital-/Private Equity-Investoren in aufsichtsrechtlichen Strukturierungsfragen und Start-ups sowie Gründer bei der Optimierung ihrer Unternehmensgestaltung, deren Finanzierung und Mitarbeiter-beteiligungsmodellen.
Dr. Marc-Andre Rousseau ist Partner bei der Kanzlei Schalast für den Bereich Venture Capital/Start-ups. Er berät Venture Capital-Investoren, Family Offices und Angel-Investoren sowie Startups in allen rechtlichen Finanzierungsfragen sowie Start-ups bei Exit- und Gewinnbeteiligungsmodellen.
Wie wehre ich mich gegen Diskriminierung?
Diskriminierung hat viele Gesichter – der Zeitgeist ist für Betroffene günstig, um sich zu wehren. Welche Rechte haben Betroffene und was können sie tun?

Die Zeiten sind vorbei, in denen Diskriminierung am Arbeitsplatz achselzuckend hingenommen wurde. Mit dem 2006 in Kraft getretenem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), welches das vorherige Beschäftigtenschutzgesetz ablöste, hat der Gesetzgeber Fakten geschaffen und eine Rechtsgrundlage hergestellt, auf deren Basis sich Betroffene gegen Diskriminierung wehren können.
Wie wird Diskriminierung definiert?
Eine Diskriminierung ist eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung aufgrund bestimmter Persönlichkeitsmerkmale. Das AGG, das auch als Antidiskriminierungsgesetz bekannt ist, erhebt den Anspruch, dass niemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechtes, Alters, seiner sexuellen Identität, Behinderung, Weltanschauung und Religion benachteiligt werden darf.
Die Chancen- und Entfaltungsfreiheit im Berufsleben gilt damit uneingeschränkt.
Eine Erweiterung des AGG wurde Anfang 2019 verabschiedet. Stellenanzeigen müssen jetzt so gestaltet sein, dass sie sich in ihrer Ansprache gleichermaßen an männliche, weibliche und diverse Personen (m/w/d) richten.
Anwälte helfen
Betroffene von Diskriminierung am Arbeitsplatz profitieren von einer erleichterten Beweisführung, die es ihnen ermöglicht, sich gegen Ungleichbehandlung zu wehren. So können schon Indizien wie die Einladung einer einzigen Frau in der zweiten Bewerbungsrunde, die Ablehnung eines Vorstellungsgesprächs bei einer Behinderung oder ein deutlich geringeres Gehalt für eine Frau gegenüber einem Mann in derselben Position dazu führen, dass man Recht erhält.
Hinzu kommt, dass Kanzleien wie rightmart längst für das Thema sensibilisiert sind und ihre Expertise als Rechtsbeistand gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz erheblich erweitern konnten. Betroffene sollten sich nicht scheuen, sich professionelle Unterstützung zu holen, wenn sich das Problem sonst nicht lösen lässt.
Ansprüche von Betroffenen
Durch das AGG sind Arbeitgeber in der Pflicht, jegliche Diskriminierung im Betrieb sofort zu unterbinden und bei Kenntnisnahme gegen diese vorzugehen. Betroffene können erwirken, dass Diskriminierung, zu der im Betriebsalltag ebenso Mobbing gehört, sofort aufgehoben wird.
Ferner haben sie in begründeten Fällen Anspruch auf Schadensersatz und Abfindungen, zum Beispiel, wenn sie aufgrund einer Diskriminierung die gewünschte Stelle nicht erhalten haben oder wenn Personen mit Migrationshintergrund das Nachsehen haben, weil nur Muttersprachler erwünscht sind. Eine solche Einschränkung ist nach dem AGG in der Stellenausschreibung inzwischen verboten.
Der Gender Gap bleibt Realität
Dass Frauen und Männer im Arbeitsleben gleichgestellt sind, ist heute selbstverständlich. Nicht selbstverständlich sind hingegen die Auswirkungen tradierter Vorurteile, denn noch immer liegt der Gender Pay Gap in Deutschland bei 18 %, wenngleich sich die Schere von Jahrzehnt zu Jahrzehnt weiter schließt.
Oft sind sich Arbeitgeber einer geschlechtsbezogenen Diskriminierung gar nicht bewusst, was sich mit Erkenntnissen moderner Hirnforschung deckt, nach denen 90 % aller menschlichen Entscheidungen auf unbewussten Faktoren basieren.
Welche Rechte haben Frauen?
Frauen, die gegenüber ihren männlichen Kollegen deutlich weniger verdienen, obwohl sie dieselbe Position bekleiden, haben laut dem Experten-Team der Kanzlei rightmart gute Aussicht auf Erfolg. So gab das Bundesarbeitsgesetz der Klage einer Betroffenen statt und entschied, dass sich nach $ 22 AGG die gleiche Qualifikation und dasselbe Aufgabenfeld in der Bezahlung widerspiegeln müssen.
Schwangere Frauen dürfen des Weiteren nicht aufgrund ihrer Schwangerschaft benachteiligt werden. Eine entsprechende Frage im Vorstellungsgespräch ist unzulässig und bei einer Schwangerschaft genießen Beschäftigte einen erweiterten Kündigungsschutz sowie einen Schutz vor Einkommensminderung.
Eine Einstellung nach Geschlecht ist ferner nur in begründeten Ausnahmefällen zulässig, wenn „das Geschlecht aufgrund der Art der Tätigkeit eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung” darstellt ($ 8 AGG). Typische Beispiele sind Erzieherinnen im Mädchenpensionat und die Anstellung als Frauenärztin in einer Praxis für Frauen.
Gescheitert war ein Mädchen nach einer von ihrer Mutter unterstützten Anzeige mit ihrem Gesuch, in einem Knabenchor Aufnahme zu finden.
Der Zeitgeist ist günstig für Diskriminierungsopfer
Das AGG ist mit Blick auf den Rechtsschutz bei Diskriminierung sehr weitgehend und auch äußerst fortschrittlich, wenn man sich die dem Menschen innewohnende Neigung zur Homogenität und Konformität vergegenwärtigt. Diese Tendenz weist zugleich auf das Problem eines starken Beharrungsvermögens von patriarchalischen und anderen atavistischen Strukturen hin, zumal eine reaktionäre Gegenbewegung viele Fortschritte wieder zunichtemachen könnte.
Überwunden werden können unterdrückerische Strukturen nur, wenn sich Betroffene bei solchen Konflikten konsequent wehren, um eine Kultur zu schaffen, in der die Gleichberechtigung für alle uneingeschränkte Realität ist.

