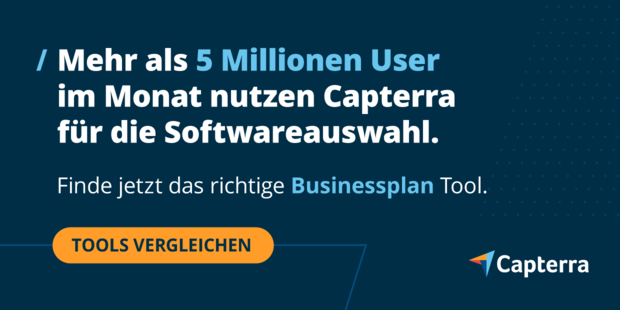Aktuelle Events
Anbieter-Check: Businessplan-Software
Acht Businessplan-Tools unter die Lupe genommen: Was sind die Stärken der jeweiligen Softwarelösung und mit welchen Extras unterstützen die Anbieter Gründer*innen bei der Businessplanerstellung?

Wer sich selbständig machen oder ein eigenes Unternehmen gründen will, stößt früher oder später fast zwangsläufig auf das Thema Businessplan – manchmal eher unfreiwillig, weil der Businessplan für einen Fördermittel- oder Kreditantrag oder für das Jobcenter zwingend benötigt wird. Auch neue Geschäftspartner oder Lieferanten möchten häufig einen Businessplan sehen. Doch der Businessplan ist sehr viel mehr als nur eine lästige Pflicht: Er hilft dir zu erkennen, ob deine Geschäftsidee oder dein Unternehmenskonzept realistisch und umsetzbar ist, unterstützt dich bei der Planung der nächsten Schritte und zeigt auf, woran du bei der Finanzierung denken musst.
Dein Businessplan besteht grob gesagt aus zwei Teilen: Zuerst beschreibst du deine Geschäftsidee, dann geht es um die Finanzplanung. Der erste Teil umfasst Informationen zur anvisierten Zielgruppe, deine Pläne für Marketing und Vertrieb sowie die möglichen Risiken, die auftreten könnten. Was ist dein Alleinstellungsmerkmal, was qualifiziert dich für die Gründung, welchen Mehrwert bietet dein Produkt und wie sieht die Nachfrage aus? Du betrachtest die aktuelle Marktsituation und die erwartete Konkurrenz, analysierst die Stärken und Schwächen deines Unternehmens und deckst Potenziale und mögliche Schwachstellen auf.
Im zweiten Teil analysierst du, wie dein Vorhaben finanziert werden kann und welche Rendite du erwartest. Du erstellst einen Liquiditäts- und Rentabilitätsplan für die ersten Jahre, stellst Prognosen auf und legst Ziele fest. Am Ende umfasst ein Businessplan meist 10 bis 50 Seiten.
Wie du siehst, ist ein Businessplan ziemlich komplex und es gibt einiges zu beachten. Außerdem sollte er professionell aussehen und idealerweise mit Grafiken und Diagrammen anschaulich gestaltet sein, sodass du potenzielle Geldgeber, Banken und Geschäftspartner überzeugen kannst. Daher lohnt es sich, nicht einfach drauf loszuschreiben, sondern dich von Businessplan-Software unterstützen zu lassen, die dich Schritt für Schritt durch den Prozess führt, hilfreiche Informationen bereitstellt, deine Eingaben prüft, automatisch Berechnungen durchführt und Zahlen grafisch aufbereitet.
Wir haben uns acht Businessplan-Tools näher angesehen und verglichen. Sie sind allesamt DSGVO-konform und haben ein Suchvolumen von mindestens 100 durchschnittlichen Sessions pro Monat in Deutschland. Unter den Anbietern gibt es auch einige deutsche, die wir separat vorstellen.
LaunchPlan
LaunchPlan richtet sich an kleine Unternehmen, Entrepreneure und Start-ups und führt dich online durch die Erstellung deines Businessplans – von der Executive Summary bis hin zur Finanzanalyse. In einem Business Model Canvas kannst du die wichtigsten Aspekte deines Unternehmens und der geplanten Wertschöpfungsprozesse auf einer Seite darstellen und beispielsweise potenziellen Investoren präsentieren. LaunchPlan erhebt keine Gebühren für zusätzliche Nutzer, sodass auch größere Teams gemeinsam am Businessplan arbeiten können, indem z.B. verschiedene Personen gleichzeitig an verschiedenen Teilen arbeiten. Ein Fokus des Anbieters liegt auf Finanzprognosen: Du kannst Gewinn und Verlust, Bilanzen und Zahlungsströme modellieren und in Grafiken darstellen. Nach der 14-tägigen kostenlosen Testversion steht LaunchPlan ab 12 US-Dollar pro Monat bei jährlicher Zahlung zur Verfügung. LaunchPlan ist nur auf Englisch verfügbar.
LivePlan
Auf LivePlan stehen dir über 500 Beispiel-Businesspläne für verschiedene Branchen zur Verfügung, sodass du einen Eindruck davon bekommst, wie dein fertiger Businessplan aussehen könnte. Videoanleitungen und Definitionen wichtiger Begriffe helfen dir herauszufinden, was in die einzelnen Abschnitte des Businessplans gehört. In LivePlan kannst du Finanzberichte und Budgets mit entsprechenden Prognosen erstellen, und das per Drag-and-Drop-Oberfläche. Tabellen und Grafiken werden automatisch erstellt und in den Businessplan eingefügt. Außerdem hilft das Tool beim Erstellen eines einseitigen Pitches, der die Grundlagen deines Geschäftsmodells umfasst und es dir ermöglicht, Interessierten dein Geschäft zu erklären. Das Dokument kannst du bei Änderungen anpassen und als PowerPoint-Datei exportieren oder einen Link dazu teilen. LivePlan unterstützt verschiedene Währungen und Steuersätze, die geändert werden können, falls du dein Geschäft in ein anderes Land verlegst. Auch wenn die Website nur auf Englisch verfügbar ist, kannst du deinen Businessplan in mehreren Sprachen verfassen (aktuell Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Italienisch). Die Standardversion kostet 15 US-Dollar monatlich und bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen, den Pitch Builder, Beispiel-Businesspläne sowie Finanzprognosen und -berichte. In der Premium-Version für 30 US-Dollar bekommst du außerdem Benchmark-Daten der Branche, mit denen du deine Werte vergleichen kannst, sowie KPIs, Leistungs-Dashboards, Szenarien für die Finanzprognosen, einen Meilenstein-Planer und Synchronisierungsoptionen für Xero und QuickBooks.
Productboard
Bei Productboard handelt es sich nicht um ein spezifisches Businessplan-Tool, sondern um ein Produktmanagement-System, mit dem du Produkt-Roadmaps erstellen und an die Anforderungen verschiedener Stakeholder anpassen kannst. Dabei stehen dir sieben Vorlagen zur Verfügung, beispielsweise ein Release-Plan, eine Kanban-Roadmap und ein Sprint-Plan. Die Produkt-Roadmap hilft dir zu planen, was du kurz-, mittel- und langfristig umsetzen willst, Ziele und Meilensteine festzulegen und Stakeholder von deinen Plänen zu überzeugen. Falls du bereits über eigene Produkte verfügst, kannst du mit dem Tool Kundenfeedback, Anfragen und Ideen erfassen, kategorisieren und analysieren sowie geplante Schritte priorisieren. Productboard ist ab 20 US-Dollar pro Person und Monat verfügbar. Die Versionen Pro (50 Dollar), Scale (100 Dollar) und Enterprise (Preis auf Anfrage) bieten zusätzliche Funktionen, z.B. zur Kundeninteraktion und Verwaltung mehrerer Produktveröffentlichungen sowie benutzerdefinierte Rollen und Berechtigungen. Productboard ist nur auf Englisch verfügbar.
Deutsche Produkte
Wenn du keine englischsprachige Businessplan-Software nutzen möchtest oder speziell auf Deutschland bezogene Empfehlungen wünschst, findest du im Folgenden einige deutsche Tools. Im Vergleich zu LivePlan bieten einige davon weniger umfangreiche visuelle Funktionen, dafür aber konkrete Informationen zur Unternehmensgründung in Deutschland. Die meisten dieser Tools sind kostenlos.
Gründerplattform (BMWi & KfW)
Mit dem Businessplan-Tool der Gründerplattform des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) kannst du kostenlos einen Businessplan mit Finanzteil erstellen. Die gemeinsam mit Fachleuten von Banken und Sparkassen sowie Wirtschaftsförderern erarbeitete Vorlage liefert dir ein Inhaltsverzeichnis für deinen Businessplan und Leitfragen für jedes Kapitel. Deine finanziellen Daten kannst du im Assistenten für den Finanzteil eingeben und bekommst Informationen zu den gängigsten Fixkosten sowie Rechnungstools für Kreditzinsen und -tilgungen. Im Schnellcheck kannst du den Plan automatisch auf sieben Kriterien prüfen lassen. Der fertige Businessplan steht als PDF-Download zur Verfügung. Auf der Plattform hast du außerdem kostenlos Zugriff auf reale Businessplan-Beispiele von erfolgreich finanzierten Gründungen aus verschiedenen Branchen, an denen du dich orientieren kannst, wenn du nicht sicher bist, was du schreiben sollst.
Lexware Businessplan / Lexrocket
Auch Lexrocket, die Gründer- und Start-up-Förderinitiative von Lexware, bietet ein kostenloses Online-Tool zum Erstellen eines Businessplans, der üblicherweise die ersten drei Jahre deines Unternehmens abdeckt. Lexrocket will dich dabei unterstützen, deine Finanzen von Anfang an im Blick zu haben und Entscheidungen unter anderem zu Rechtsform, Marketing und Personal zu treffen. Dabei orientiert sich das „expertengeprüfte Tool“ an den Empfehlungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und richtet sich an alle Branchen. Lexrocket führt dich schrittweise durch den Prozess und hilft dir, per SWOT-Analyse die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken deiner Geschäftsidee zu ermitteln. Dank Cloud-Technik kannst du auch von Mobilgeräten aus auf deinen Businessplan zugreifen und unterwegs weiterarbeiten, bevor du den fertigen Plan als PDF-Datei exportierst.
SmartBusinessPlan
SmartBusinessPlan will dir die Businessplan-Erstellung leicht machen und bietet Assistenten für verschiedene Aspekte, beispielsweise einen Personalplaner mit Lohnrechner für das Einstellen von Mitarbeiter*innen und einen Kreditrechner für die Bankfinanzierung. Mit deinen Angaben wird automatisch ein Finanzplan für die nächsten drei Jahre erstellt, in dem du auch nachträglich Zahlen verändern und die Auswirkungen auf Liquiditätsplanung und Ertragsvorschau überblicken kannst. Der Finanzplan umfasst Jahrestabellen und einen Anhang mit Details auf Monatsebene, und du kannst in jedem Kapitel Diagramme einfügen. Zur Unterstützung stehen 30 Businessplan-Beispiele zur Verfügung. Du kannst gemeinsam mit anderen am Businessplan arbeiten und ihn auf diese Weise lektorieren lassen oder über Kommentare interagieren. SmartBusinessPlan bietet für sieben Tage eine kostenlose Testversion, die Vollversion kostet 149 Euro jährlich bei einmaliger Zahlung oder 49 Euro/Monat im monatlich kündbaren Abonnement. Alternativ gibt es eine kostenfreie Businessplan-Vorlage im Word-Format sowie Muster-Businesspläne zum Download. Auch einen Businessplan-Crashkurs mit Checkliste findest du auf der Website, genauso wie Tipps für Beratungsangebote, Infos zu nützlichen Datenquellen wie Branchenverbänden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oder Genossenschaftsbanken sowie Links zu Businessplan-Wettbewerben.
Unternehmerheld
Unternehmerheld bündelt verschiedene Tools für die Gründung, darunter neben der Businessplan-Software unter anderem einen Gründertest zur Auswertung deiner Erfolgsfaktoren, ein Business Model Canvas zur Geschäftsmodellentwicklung, eine CRM-Software und Tools für Finanz- und Liquiditätsplanung, Online-Buchhaltung, Kundenverwaltung und Angebotserstellung (teils kostenpflichtig). Die Website empfiehlt, zunächst mit dem Business Model-Canvas-Tool ein Geschäftskonzept auf die Beine zu stellen und anschließend die Inhalte in das Businessplan-Tool zu übernehmen, um einen detaillierten Geschäftsplan zu erstellen. Das Tool unterstützt dich mit Hilfestellungen, Leitfragen und Beispielen, ermöglicht die Arbeit im Team und ist kostenlos nutzbar. Allerdings betrifft das nur den ersten Teil deines Businessplans: Den Finanzplan erstellst du mit einem separaten Modul, das ab 39 Euro für einen Monat verfügbar ist (zwei Monate für 59 Euro, drei Monate für 79 Euro).
Unternehmenswelt
Das webbasierte Businessplan-Tool von Unternehmenswelt ist kostenlos nutzbar und hilft mit praxiserprobten Formulierungen dabei, einen deutschsprachigen Businessplan zu konzipieren und zu strukturieren. Nachdem alle nötigen Informationen im Onlineformular eingegeben wurden, prüft das Team von Unternehmenswelt die Angaben auf Plausibilität, gibt gegebenenfalls Änderungshinweise und informiert dich, sobald der Businessplan zum Download bereitsteht. Die Website bietet auch ohne Anmeldung auf verschiedene Branchen zugeschnittene ausführliche Informationen darüber, was alles in deinen Businessplan gehört und was du beachten solltest. Beispielsweise findest du so Wissenswertes zu verschiedenen Rechtsformen und benötigten Genehmigungen oder auch zu den häufigsten Fehlern, die man beim Schreiben eines Businessplans machen kannst.
Hier findest du die wichtigsten Fakten aus unserem Anbietercheck im Überblick:
Die Autorin Ines Bahr ist International Senior Content Analyst bei Capterra, der unabhängigen Online-Ressource für Business-Software-Käufer, www.capterra.com.de
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Gaming & digitale Medien – eine Perspektive für Start-ups?
Diese Voraussetzungen sollten Gründerinnen und Gründer von Start-ups in der Gamingbranche oder der Gestaltung digitaler Medien mitbringen, um erfolgreich zu sein.

Digitale Start-ups verbinden attraktive Zukunftsperspektiven mit einem geringen Startkapital. Für die digitale Generation aktueller Schul- und Universitätsabgänger stellt sich die Frage, ob ein Einstieg in die Gamingbranche oder die Gestaltung digitaler Medien für die Gründung eines Start-ups ausreichen kann. Solche Perspektiven sind gegeben, die neben ausreichend Kreativität eine fundierte Ausbildung in Computertechnik und Business gleichermaßen voraussetzen.
Indie-Games – eine Perspektive für Entwickler?
Noch vor einigen Jahren war die Gamingbranche als Perspektive für Gründer eher unattraktiv. Die großen, internationalen Studios dominierten die Szene, wobei für Triple-A-Titel längst Tausende von Entwicklern an unterschiedlichen Standorten benötigt wurden. Unter dem Zeit- und Kostengrund vieler Studios sowie der Entlassungswelle der letzten Jahre ist es für immer mehr Developer uninteressant, auf die Anstellung in einem der großen Softwarehäuser zu hoffen.
Die unabhängige Entwicklung von digitalen Medien oder Spielen bleibt jedoch beliebt und kann zur Basis eines Start-ups werden. Immer mehr Gamer wenden sich von den überteuerten, großen Marken der Szene ab und vertrauen auf kleinere Entwickler mit mehr Freiheiten bei der Umsetzung. Selbst die großen Gaming-Plattformen halten regelmäßig eine Auswahl beliebter und neuer Indie-Games für Millionen Nutzer bereit.
Unabhängig von Größe und Art eines Studios bleibt die Gamingbranche international und setzt verschiedene Skills vom Development bis zum erfolgreichen Marketing voraus. Dies alles lässt sich längst in speziell abgestimmten Studiengängen erlernen.
Spielentwicklung der neuesten Generation als Studiengang
Studiengänge wie Games & Immersive Media an der Hochschule Furtwangen erlauben es, einen Bachelor im Gaming-Umfeld zu erlangen und alle relevanten Fähigkeiten für den zukünftigen Berufsweg zu gewinnen. Neben Computer Science und Anwendungen im spielerischen Bereich nehmen Business, Design und Medien als zweiter Bereich einen wesentlichen Stellenwert im Studium ein.
Diese Kombination des bilingualen Studiengangs ergibt Sinn. Schließlich ist nicht jeder kreative Programmierer und Spieleentwickler ein Geschäftsmann, genauso wenig wie Marketer gerne stundenlang mit Quellcode arbeiten. Moderne Studiengänge wie dieser führen beide Welten zusammen und sorgen für eine fundierte Ausbildung, um tiefe Einblicke in beide relevanten Arbeitsfelder zu gewinnen.
Starke Unterstützung für zukünftige Start-ups
Die Hochschule Furtwangen geht mit ihrer Unterstützung weit über den reinen Studiengang hinaus. Bewusst wird angehenden Start-ups unter die Arme gegriffen, die ihre ersten Schritte ins Gaming-Business mit kreativen Spielen und Studienprojekten gehen möchten.
Neben einer umfassenden Beratung auf dem Weg zum eigenen Business werden ein Support für Fördermittel sowie Räumlichkeiten für das gemeinschaftliche Arbeiten an Spielen oder digitalen Medien geboten. Viele Formalitäten und Unsicherheiten, die sich bei Start-ups unabhängig von Branche und Geschäftsfeld ergeben, werden so seitens der Hochschule kompetent und professionell unterstützt.
Für den Einstieg sind Kenntnisse im Gaming-Bereich ideal, die über die reine „Freude am Zocken“ hinausgehen. Kreativität in der Planung und Umsetzung eigener Projekte sollte nachgewiesen werden – anders als die zwingende Notwendigkeit, eine Programmiersprache zu beherrschen.
Sichtbarkeit im digitalen Umfeld entscheidend
Wie bei allen Produkten entscheidet weniger die tatsächliche Qualität, sondern die Sichtbarkeit und eine wirkungsvolle Werbung über Erfolg von Misserfolg von Games. Gerade das Marketing für digitale Produkte ist wegen der hohen Konkurrenz und einer Fülle an Informationen in der digitalen Welt eine immense Herausforderung. Hier eine fachkundige Unterstützung von Anfang an zu erhalten, bewahrt Entwickler und kreative Köpfe davor, grundlegende Fehler zu begehen und frühzeitig den Traum vom Gaming-Job zu begraben.
Außenbereiche in der Gastro gestalten: Diese Details werden 2026 wichtig
Erfahre, welche Details 2026 für Außenbereiche in der Gastronomie zählen und Trends prägen.

Im Jahr 2026 werden Außenbereiche in der Gastronomie zu wichtigen Markenbotschaftern. Gäste erwarten mehr als bequeme Sitzplätze: Sie suchen emotionale Erlebnisse, nachhaltige Designs und ein stimmiges Ambiente. Nach Jahren des Wandels hat sich das Verhalten der Gäste spürbar verändert.
Der Fokus liegt auf Authentizität, Wohlgefühl und einem hochwertigen Gesamteindruck. Restaurants, Cafés und Bars nutzen ihre Terrassen zunehmend als Bühne für Stilbewusstsein und Gastfreundschaft. Studien zeigen, dass für viele Gäste der Außenbereich ein entscheidendes Auswahlkriterium ist. Terrassen mit recyceltem Holz, stimmungsvoller Beleuchtung und begrünten Wänden stehen für diese Entwicklung. Die wachsende Bedeutung von Wetterschutz, Lichtkonzepten und Begrünung verdeutlicht, dass der Außenbereich längst nicht mehr Nebenschauplatz ist, sondern zentraler Bestandteil des gastronomischen Erfolgs. 2026 markiert damit eine neue Ära der Freiluftgastronomie – funktional, ästhetisch und emotional zugleich. Die folgenden Abschnitte zeigen, worauf Verantwortliche achten sollten.
Wetter- und Klimaschutz: Komfort bei jedem Wetter
Ganzjährige Nutzbarkeit wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor gastronomischer Außenräume.
- Innovative Überdachungen, langlebige Marktschirme, Windschutzsysteme und moderne Heizlösungen schaffen Behaglichkeit bei wechselnden Wetterbedingungen.
- Glasdächer mit UV-Filtern, textile Pergolen oder transparente Windschutzwände verbinden Schutz mit Offenheit.
- Elektrische Infrarotheizungen verlängern die Freiluftsaison und reduzieren Energieverluste.
- Mobile Heizlösungen und wetterfeste Bodenbeläge sichern Funktionalität bei Regen und Kälte.
- Automatische Luftzirkulationssysteme verhindern sommerliche Überhitzung und steigern die Energieeffizienz.
Entscheidend ist die Balance zwischen technischer Leistungsfähigkeit und optischer Leichtigkeit. So werden Außenbereiche zu wandelbaren Räumen, die unabhängig von Jahreszeit und Wetter hohen Komfort bieten – ein klarer Wettbewerbsvorteil im anspruchsvollen Gastronomiemarkt.
Materialwahl und Möblierung: Wenn Langlebigkeit und Stil aufeinandertreffen
Die Auswahl der Materialien prägt sowohl das Erscheinungsbild als auch die Langlebigkeit eines gastronomischen Außenbereichs. Robuste Metalle wie Aluminium oder Edelstahl, kombiniert mit wetterfestem Teakholz, setzen ästhetische Akzente und sorgen für Beständigkeit.
Hochwertige Textilien aus Acrylgewebe ergänzen das Gesamtbild: Sie sind pflegeleicht, widerstandsfähig und schützen vor dem Ausbleichen durch Sonnenlicht. Besonders gefragt sind langlebige Sonnenschirme, die Schatten spenden und Design mit Funktion verbinden. Modelle mit integrierter Beleuchtung oder komfortabler Öffnungsmechanik erhöhen den Nutzungskomfort.
Modulare Loungemöbel und ergonomische Sitzlandschaften prägen 2026 den Trend zu Flexibilität und Wohlbefinden.
Farben wie warmes Taupe und gedecktes Grün schaffen visuelle Ruhe und unterstreichen die natürliche Anmutung. So entsteht die Basis für harmonische, witterungsbeständige und zugleich stilvolle Außenbereiche.
Nachhaltigkeit als Schlüsselthema: Umweltbewusste Gestaltungskonzepte im Fokus
Nachhaltigkeit ist 2026 kein Zusatz mehr, sondern die Grundlage jeder gelungenen Außengestaltung. Viele Gastronomiebetriebe setzen auf recycelte Materialien, regionale Pflanzen und eine ressourcenschonende Planung mit kurzen Transportwegen.
Bambus, zertifiziertes Holz und recyceltes Aluminium gelten als bevorzugte Werkstoffe. Begrünte Pergolen und Dachgärten verbessern das Mikroklima und binden Feinstaub. Energieeffiziente LED-Beleuchtung reduziert Stromverbrauch und Wartungsaufwand. Neben der Materialwahl spielt auch der Umgang mit Wasser eine zentrale Rolle: Regenwasserspeicher und automatische Bewässerungssysteme unterstützen ein ökologisches Gleichgewicht. Moderne Lösungen rund um Geschäftsideen, die unter anderem aus dem Bereich der KI stammen, könnten hier in Zukunft noch weiter relevant werden.
Heimische Pflanzen wie Lavendel oder Ziergräser schaffen ergänzend natürliche Rückzugsorte und unterstreichen die ästhetische Wirkung nachhaltiger Gestaltung. Nachhaltigkeit bedeutet bewusste, umweltgerechte Planung – ästhetisch, zukunftsorientiert und wirtschaftlich sinnvoll.
Beleuchtungskonzepte: So entsteht Atmosphäre durch Licht
Beleuchtung entscheidet über Stimmung und Aufenthaltsqualität im Außenbereich. 2026 liegt der Fokus auf atmosphärischem Licht, das Funktion und Emotion miteinander verbindet und auf detailreichen Akzenten.
- Warmweiße LED-Leisten, dezente Spots oder laternenartige Leuchten schaffen Struktur und Tiefe. Indirekte Beleuchtung – über reflektierende Flächen geführt – betont architektonische Elemente und sorgt für eine angenehme Lichtwirkung.
- Farblich variable und flexibel steuerbare Systeme ermöglichen eine Anpassung an Tageszeit und Anlass.
- Solarleuchten gewinnen an Bedeutung, da sie Nachhaltigkeit mit hoher Flexibilität verbinden und den Energieverbrauch deutlich reduzieren.
- Lichtinseln an Tischen und Wegen fördern Orientierung und Sicherheit.
Am Abend wird das Zusammenspiel von Helligkeit und Schatten selbst zum Gestaltungselement. Ein durchdachtes Beleuchtungskonzept schafft Atmosphäre und unterstreicht den Charakter des gastronomischen Außenbereichs.
Flexibilität und Modularität: So praktisch sind anpassungsfähige Außenkonzepte
Flexibilität wird 2026 zur Grundvoraussetzung moderner Außenkonzepte. Saisonale Veränderungen, wechselnde Wetterbedingungen und unterschiedliche Gästezahlen erfordern wandelbare Strukturen.
Modulare Möbel, klappbare Trennelemente und mobile Theken ermöglichen schnelle Umgestaltungen. Design und Funktion greifen dabei nahtlos ineinander. Flexible Bodenmodule, frei positionierbare Lichtlösungen und rollbare Pflanzenkübel erleichtern den Umbau zusätzlich.
Der Begriff des dynamischen Außenraums beschreibt Bereiche, die sich je nach Nutzungssituation verändern lassen. Temporäre Überdachungen und anpassbare Windschutzlösungen schaffen weitere Freiräume.
So steht Wandlungsfähigkeit nicht nur für Praktikabilität, sondern auch für kreative Gestaltungsfreiheit, die Außenbereiche lebendig, vielseitig und zukunftssicher macht.
Pflanzen und Begrünung: Natürlichkeit als Gestaltungselement
Begrünung ist 2026 mehr als Dekoration – sie wird zum zentralen Designelement gastronomischer Außenräume. Vertikale Gärten, bepflanzte Trennwände und saisonal wechselnde Blühflächen schaffen natürliche Strukturen und verbessern das Mikroklima. Besonders urbane Standorte profitieren von dieser grünen Aufwertung. Pflanzen wie Lavendel, Gräser oder Olivenbäume verbinden mediterrane Leichtigkeit mit robuster Alltagstauglichkeit.
Auch Nutzpflanzen wie Kräuter, Minze oder essbare Blüten gewinnen an Bedeutung und verleihen dem Außenbereich Authentizität. Moderne Begrünungssysteme erleichtern Pflege und Bewässerung und machen grüne Konzepte dauerhaft praktikabel. Begrünung fördert Biodiversität, vermittelt Ruhe und schafft eine einladende Atmosphäre. So wird der Außenbereich zur kleinen Oase, in der Natur, Design und Gastlichkeit harmonisch zusammenfinden.
Technologische Innovationen: Smarte Lösungen im Außenbereich werden immer beliebter
Technologie prägt 2026 die Gestaltung gastronomischer Außenbereiche nachhaltig. Digitale Lösungen ermöglichen einen optimierten Betrieb und steigern zugleich den Gästekomfort.
- Smarte Heizsysteme mit Bewegungssensoren
- automatisierte Schirmsteuerungen
- appbasierte Lichtkonzepte
machen Abläufe effizienter und energiesparender. Vernetzte Systeme passen Beleuchtung, Temperatur und Beschattung automatisch an Wetter und Tageszeit an. Digitale Reservierungslösungen zeigen Sitzplatzverfügbarkeiten in Echtzeit und erleichtern die Planung.
USB-Ladepunkte an Tischen und kabellose Soundsysteme erweitern die Funktionalität und erhöhen den Komfort. So ergänzt moderne Technik energieeffiziente Konzepte und verleiht Außenbereichen ein zeitgemäßes, hochwertiges Erscheinungsbild. Das Zusammenspiel von Technik und Design macht smarte Außenräume zukunftsfähig und sorgt für ein stimmiges Gästeerlebnis – vom frühen Abend bis in die Nacht.
Farben und Designs: Was liegt 2026 im Trend?
Farb- und Designtrends prägen 2026 die Atmosphäre gastronomischer Außenflächen. Natürliche Töne wie Sand, Oliv und Terrakotta dominieren, während Akzente in Ockergelb oder Petrol Frische und Tiefe verleihen.
Strukturen gewinnen an Bedeutung: Geflochtene Texturen, matte Oberflächen und handwerkliche Details vermitteln Authentizität. Organische Formen und modulare Gestaltungskonzepte setzen auf Leichtigkeit und Flexibilität.
Auch die Einbindung lokaler Materialien stärkt die regionale Identität und verleiht Außenbereichen Charakter. Farbkonzepte folgen dem Prinzip „Weniger ist mehr“: Feine Kontraste zwischen warmen und kühlen Nuancen schaffen Ruhe und Orientierung. Biophiles Design, das Natur und Architektur verbindet, sowie der Japandi-Stil – eine Verbindung aus japanischem Minimalismus und skandinavischer Klarheit – prägen die Ästhetik.
Das Ergebnis sind Außenbereiche mit visueller Klarheit, zeitloser Eleganz und stilistischer Beständigkeit.
Darum ist es wichtig, das Thema Geräuschmanagement nicht zu unterschätzen
Akustik wird 2026 zu einem entscheidenden Faktor für das Wohlbefinden in gastronomischen Außenbereichen, besonders in urbanen Lagen. Lärmreduktion und gezielte Klanggestaltung – also die bewusste Steuerung von Schall und Nachhall – verbessern oft spürbar die Aufenthaltsqualität.
Schalldämpfende Materialien wie Akustikpaneele aus recycelten Fasern oder begrünte Wände kommen dabei vermehrt zum Einsatz.
Auch schallabsorbierende Textilien, gepolsterte Möbel und bepflanzte Flächen wirken geräuschmindernd.
So entstehen Rückzugsorte mitten im städtischen Trubel. Dezente Hintergrundmusik schafft Balance, ohne Gespräche zu überlagern. Das Ergebnis sind entspannte Außenbereiche, in denen Kommunikation mühelos möglich bleibt. Akustisches Design wird damit zu einem zentralen Bestandteil moderner Gastronomiearchitektur – funktional, ästhetisch und wohltuend zugleich.
KI-Trends 2026: Reifer, realer, relevanter
2026 tritt KI in eine neue Phase ein: weniger Hype, mehr Haltung. Expert*innen aus Technologie, Kommunikation und Mittelstand zeigen, wie künstliche Intelligenz Prozesse transformiert, Entscheidungen präziser macht und Marken stärkt – aber auch neue Risiken schafft, von Voice-Cloning bis Abhängigkeiten großer Plattformen. Klar wird: KI entfaltet ihr Potenzial dort, wo Unternehmen sie verantwortungsvoll einsetzen, Transparenz schaffen und menschliche Kompetenz stärken.

Zwischen Dynamik und Verantwortung: KI braucht gemeinsame Sichtweisen

„KI schafft keine perfekten Lösungen auf Knopfdruck, sondern eröffnet neue Wege, Herausforderungen besser zu bewältigen. Die größten Chancen liegen darin, Wissensverlust zu vermeiden, Reibungsverluste zu reduzieren und individueller auf Menschen einzugehen – im Gesundheitswesen genauso wie in HR, Bildung und Produktion. Gleichzeitig besteht die größte Herausforderung darin, eine gemeinsame Sichtweise auf KI zu entwickeln: Alle reden darüber, aber oft über völlig Unterschiedliches. Das gelingt nur über kleine Schritte, viel Kommunikation und eine Annäherung auf Augenhöhe. Zugleich zeichnet sich ein klarer Trend ab: die Fragmentarisierung der KI-Landschaft und eine problematische Abhängigkeit von US-Anbietern, die neue, eigene Handlungswege erfordert. Wer diese Dynamik versteht und verantwortungsvoll gestaltet, erschließt das Potenzial von KI von automatisierten medizinischen Leistungen über effizientere Produktionsprozesse bis hin zu deutlich schnelleren Innovationszyklen.“
NRW.BANK wird erster „InvestEU Implementing Partner“ in Deutschland
Der Neue Tech&Scale-Fonds ermöglicht Eigenkapitalinvestments von bis zu 200 Mio. Euro in Scale-ups.

Über den neuen Fonds „NRW.Venture EU Tech&Scale“ kann die NRW.BANK künftig bis zu 30 Millionen Euro pro Finanzierung in hochinnovative Scale-ups investieren – doppelt so viel wie bisher. Insgesamt sollen so bis zu 200 Millionen Euro zusätzlich für Investitionen in junge Deep Tech- und Wachstumsunternehmen, die einen Standort in NRW haben, bereitgestellt werden. Ein entsprechender Vertrag wurde jetzt in Brüssel zwischen der NRW.BANK und der EU-Kommission unterzeichnet – erste Finanzierungen sind ab Ende des ersten Quartals 2026 möglich.
Im Fokus von NRW.Venture EU Tech&Scale werden innovative und kapitalintensive Scale-ups in fortgeschrittenen Finanzierungsphasen stehen, insbesondere aus den Bereichen DeepTech, GreenTech, Industrie 4.0, Biotechnologie, Medizintechnik und digitale Lösungen. Scale-ups sind stark wachsende hochinnovative Unternehmen, die die Start-up-Phase hinter sich gelassen haben, sich in einer Wachstumsphase befinden und hierfür einen großen Kapitalbedarf haben.
„Große Wachstumsfinanzierungen für Scale-ups sind bei uns in Deutschland immer noch die Ausnahme. Investoren sind risikoaverser als beispielsweise in den USA oder China – die investierten Volumen sind kleiner. In der Folge werden hochinnovative Unternehmen immer noch eher früh verkauft – oft an ausländische Käufer – was gravierende Effekte für den Standort Deutschland und seine Wettbewerbsfähigkeit hat. Das wollen wir ändern“, sagt Gabriela Pantring, designierte Vorstandsvorsitzende der NRW.BANK. „Mit unserem neuen Tech&Scale-Fonds schließen wir gemeinsam mit der EU-Kommission eine entscheidende Finanzierungslücke und sorgen dafür, dass skalierende Tech-Unternehmen langfristig in Nordrhein-Westfalen und damit in Europa wachsen können.“
Mona Neubaur, Stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin: „Die InvestEU-Partnerschaft der NRW.BANK ist ein industrie- und innovationspolitischer Meilenstein. Wir stärken damit gezielt jene Scale-ups, die für technologische Souveränität, Wertschöpfung und gute Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen und Europa entscheidend sind. Dass dieser Schritt gelingt, ist auch Ergebnis unseres beharrlichen Einsatzes für verlässliche Rahmenbedingungen und starke Finanzierungsinstrumente im europäischen Binnenmarkt.“
Ausgestaltung des Fonds
Die NRW.BANK finanziert den Fonds aus eigenen Mitteln und damit haushaltsunabhängig. Mit der EU-Kommission teilt sie sich das Risiko von möglichen Ausfällen zu je 50 Prozent (pari-passu). Gleichzeitig partizipieren beide Seiten gleichwertig an möglichen Erlösen, beispielsweise durch einen Exit.
Durch die Risikoteilung steigt das maximal mögliche Investitionsvolumen je Scale-up von derzeit 15 auf künftig 30 Millionen Euro. Der gesamte Investitionsrahmen des Programms beläuft sich auf 200 Millionen Euro, wobei entsprechend 100 Millionen Euro durch die EU-Garantie abgesichert sind.
Über das Programm wird die NRW.BANK im Direktgeschäft offene Beteiligungen eingehen oder Wandeldarlehen vergeben. Investitionen erfolgen – wie auch in anderen Fällen – jeweils mit einem oder mehreren Co-Investoren. Durch den Kapitaleinsatz hebelt die Förderbank so auch weiteres Kapital.
Der Start ist für das erste Quartal 2026 geplant.
Was ist InvestEU?
Das Programm InvestEU stellt der Europäischen Union eine entscheidende langfristige Finanzierung zur Verfügung, indem erhebliche private und öffentliche Mittel zur Unterstützung einer nachhaltigen Erholung mobilisiert werden. Sie trägt auch dazu bei, private Investitionen für die politischen Prioritäten der Europäischen Union wie den europäischen Grünen Deal und den digitalen Wandel zu mobilisieren. Das Programm „InvestEU“ vereint die Vielzahl der derzeit verfügbaren EU-Finanzierungsinstrumente zur Förderung von Investitionen in der Europäischen Union unter einem Dach, wodurch die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler wird. Das Programm besteht aus drei Komponenten: den Fonds „InvestEU“, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der Fonds „InvestEU“ wird über Finanzpartner durchgeführt, die mithilfe der EU-Haushaltsgarantie in Höhe von 26,2 Mrd. EUR in Projekte investieren werden. Die gesamte Haushaltsgarantie wird die Investitionsprojekte der Durchführungspartner unterstützen, ihre Risikotragfähigkeit erhöhen und somit zusätzliche Investitionen in Höhe von mindestens 372 Mrd. EUR mobilisieren.
KI-Modelle erfolgreich im Unternehmen einführen
Worauf es bei der Implementierung von KI wirklich ankommt.

Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung. Sie kann Prozesse beschleunigen, große Datenmengen sinnvoll nutzbar machen und Entscheidungen unterstützen. Doch in der Praxis zeigt sich: Moderne Technologie allein führt noch nicht zum Erfolg. Entscheidend ist ein strukturiertes Vorgehen, bei dem Ziele klar definiert, Daten sorgfältig vorbereitet und organisatorische Rahmenbedingungen von Beginn an berücksichtigt werden. „Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass am Anfang die Orientierung fehlt“, sagt Benedikt Weber, Geschäftsführer der applord GmbH. „Struktur schafft Entscheidungsfähigkeit – noch bevor über konkrete KI-Modelle gesprochen wird.“
Organisatorischer Wandel und Einbindung der Mitarbeitenden
Der Einsatz von KI verändert Arbeitsabläufe, Verantwortlichkeiten und Entscheidungswege. Mitarbeitende arbeiten verstärkt mit automatisierten Systemen zusammen, Aufgaben verschieben sich, Rollen entwickeln sich weiter. Wird dieser Wandel nicht aktiv begleitet, entstehen Unsicherheiten oder Ablehnung gegenüber neuen Technologien. Erfolgreiche Unternehmen setzen deshalb auf transparente Kommunikation und frühzeitige Einbindung der Mitarbeitenden. Sie erklären, warum KI eingesetzt wird, welche Aufgaben sie übernimmt und wo menschliche Expertise weiterhin unverzichtbar bleibt. Fehlt dieses gemeinsame Verständnis, werden neue Systeme häufig nur eingeschränkt genutzt. „KI-Projekte scheitern selten an der Technologie“, betont Weber. „Viel häufiger fehlt ein klares Bild davon, welchen konkreten Nutzen KI für Mitarbeitende und Organisation wirklich bringt.“
Auswahl der passenden KI-Lösung
Das Angebot an KI-Lösungen wächst rasant. Für Unternehmen besteht die Herausforderung darin, nicht der technischen Vielfalt zu folgen, sondern eine Lösung zu wählen, die zum eigenen Geschäftsprozess passt. Der Ausgangspunkt sollte immer ein klar definierter Anwendungsfall sein: Welche Aufgabe soll KI konkret unterstützen oder verbessern? Neben den Funktionen spielen auch Fragen der Nachvollziehbarkeit, Integration in bestehende Systeme und regulatorische Anforderungen eine Rolle. Werden diese Aspekte zu spät berücksichtigt, entstehen Lösungen, die technisch leistungsfähig sind, im Alltag aber keinen Mehrwert liefern. „Viele Unternehmen wählen KI nach dem Funktionsumfang aus und stellen später fest, dass sie nicht zum eigenen Prozess passt“, erklärt Weber. „Erfolgreich ist KI dann, wenn sie Abläufe sinnvoll ergänzt und verständliche Ergebnisse liefert.“
Datenqualität als Grundlage für verlässliche Ergebnisse
KI-Modelle sind vollständig von der Qualität ihrer Daten abhängig. In vielen Unternehmen existieren relevante Informationen zwar, sie sind jedoch über verschiedene Systeme verteilt, unterschiedlich gepflegt oder historisch gewachsen. Diese Ausgangslage erschwert nicht nur den Einsatz von KI, sondern kann zu fehlerhaften oder schwer nachvollziehbaren Ergebnissen führen. Datenmanagement ist daher keine einmalige Vorarbeit, sondern eine kontinuierliche Aufgabe. Dazu gehören klare Zuständigkeiten, regelmäßige Prüfungen und eine strukturierte Aufbereitung der Daten. „Der Aufwand für Datenqualität wird häufig unterschätzt“, sagt Weber. „Ohne geprüfte und konsistente Daten lassen sich keine stabilen und verlässlichen KI-Ergebnisse erzielen – unabhängig davon, wie gut das Modell ist.“
Schrittweise Einführung statt großer Umbruch
Statt KI sofort unternehmensweit einzusetzen, empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen. Unternehmen können so mit klar abgegrenzten Anwendungsfällen beginnen, Lösungen im Alltag testen und die Ergebnisse anhand messbarer Kriterien, wie Benutzerfreundlichkeit oder verständlicher Anleitungen, bewerten. So lassen sich Risiken reduzieren und Erkenntnisse gezielt nutzen. Pilotprojekte liefern nicht nur technische Erkenntnisse, sondern zeigen auch, wie gut KI im Arbeitsalltag akzeptiert wird. Auf dieser Basis lässt sich entscheiden, welche Lösungen ausgebaut werden sollten. „Unternehmen, die mit überschaubaren Anwendungsfällen starten, treffen langfristig fundiertere Entscheidungen“, so Weber. „Praxiserfahrungen sind dabei deutlich wertvoller als theoretische Annahmen.“
Warum DeepTechs wie planqc und infrared.city auf Österreich setzen
Warum Österreich für führende DeepTech-Entrepreneure immer attraktiver wird, erklären planqc-CEO Alexander Glätzle und Angelos Chronis, CEO von infrared.city. Welche Rolle Forschungsexzellenz, Talente und die Unterstützung der Austrian Business Agency (ABA) dabei spielen, schildern sie im Interview.

Österreich entwickelt sich rasant zu einem Hotspot für DeepTech-Technologien, getragen von einem Innovationsökosystem, das hierzulande Forschung und Entwicklung vorantreibt. Von künstlicher Intelligenz über Quantentechnologien bis zur klimaresilienten Stadtentwicklung entsteht ein Ökosystem, das in Europa Maßstäbe setzt. Österreich hat sich hier in den vergangenen Jahren weit vorne positioniert.
Forschung und Anwendung wachsen eng zusammen
Vor allem in der Quantentechnologie zählt das Land zur internationalen Spitzengruppe. Die Universität Innsbruck, das IQOQI der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die Universität Wien und das ISTA sind seit Jahren wissenschaftliche Schwergewichte und ziehen Talente wie Unternehmen gleichermaßen an.
Diese Stärke spiegelt sich auch im Start-up-Ökosystem wider: 17 Prozent aller österreichischen Start-ups werden dem DeepTech-Bereich zugeordnet, womit rund jedes sechste junge Unternehmen auf besonders forschungsintensive Technologien setzt (brutkasten berichtete). Gleichzeitig zeigt sich die hohe Reife dieser Unternehmen in der Finanzierung: Laut dem aktuellen Austrian Startup Monitor haben 36 Prozent der DeepTech-Start-ups bereits mehr als 500.000 Euro an externem Kapital aufgenommen. Für immer mehr internationale Gründer*innen und Scale-ups positioniert sich Österreich damit nicht nur als exzellenter Forschungsstandort, sondern zunehmend als strategischer Unternehmens- und Skalierungshub.
Hohe Talent- und Forschungsdichte
Eines dieser Unternehmen ist planqc, ein Spin-off des Münchner Max-Planck-Instituts. Der Quantencomputing-Hersteller holte dafür im Juli 2024 ein Series-A-Investment in Höhe von 50 Millionen Euro (StartingUp berichtete). Für den Tiroler Co-Founder und CEO Alexander Glätzle war Innsbruck nicht nur eine emotionale, sondern eine fachliche Entscheidung: Er habe hier studiert und promoviert. „In dieser Zeit erlebte ich, wie stark die Quantenforschung in Österreich ist”, erzählt er im Interview mit brutkasten.
Rund um Universität und IQOQI sei eine Community entstanden, die weltweit Maßstäbe setze. Viele Ideen und Talente, auf denen planqc heute aufbaut, stammten genau aus diesem Umfeld, sagt Alexander. “Gleichzeitig ist der Talentpool in Österreich insgesamt außergewöhnlich stark, was für ein wachsendes Quantenunternehmen wie unseres ein großer Vorteil ist“.

Diese wissenschaftliche Dichte wirkt sich unmittelbar auf die Technologieentwicklung aus. Durch die enge Vernetzung mit heimischen Forschungsgruppen könne planqc laut Alexander in Innsbruck „direkt auf eines der weltweit führenden Ökosysteme für Quantenphysik zugreifen“. Viele Mitarbeitende kenne man seit Studienzeiten, gemeinsame Projekte beschleunigten den Transfer von Laborergebnissen in industrielle Anwendungen. Dadurch verkürze sich der Weg von einem Experiment zu einem einsatzfähigen Quantencomputer erheblich – ein zentraler Faktor für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.
Kollaborationsnetzwerke
Auch infrared.city hat in Österreich seinen Ursprung. Das Unternehmen entwickelte eine Software, mit der Städte, Architekt*innen und Planer*innen Mikroklimabedingungen wie Hitze, Wind, Schatten oder thermischen Komfort in Echtzeit simulieren können. Die Technologie wurde am AIT City Intelligence Lab entwickelt – ein Umfeld, das laut CEO Angelos Chronis entscheidend war. Wien habe die idealen Voraussetzungen geboten. “Das starke Forschungsökosystem der Stadt, kombiniert mit Österreichs unterstützender Infrastruktur für DeepTech-Innovation, ermöglichte es uns, den Schritt von der akademischen Forschung zu einer kommerziellen Plattform zu vollziehen – mit fortlaufendem Zugang zu erstklassigem Fachwissen und starken Kollaborationsnetzwerken”, erklärt der gebürtige Grieche.
Mut zur Preiserhöhung
Warum Verkäufer*innen öfter über ihren Schatten springen sollten.

Viele Verkäufer*innen wissen, dass eine Preiserhöhung längst überfällig ist. Trotzdem schieben sie das Thema vor sich her. Mal scheint der/die Kund*in nicht in Stimmung, mal steht ein wichtiges Projekt an, mal ist der Zeitpunkt angeblich ungünstig. So vergeht Monat um Monat. Mit jedem Aufschub wächst der innere Druck, denn insgeheim wissen viele: Dieses Preiserhöhungsgespräch wird immer überfälliger.
Doch statt zu handeln, weichen sie aus. Warum? Weil sie Angst haben und das Notwendige lieber aufschieben. Schließlich ist es leichter, alles beim Alten zu lassen, als mutig für den eigenen Wert einzustehen. Aber wer Preise nicht anpasst, entscheidet sich nicht nur unbewusst gegen Wirtschaftlichkeit, sondern auch gegen seinen eigenen Selbstwert.
Haltung zuerst – Argumente später
Bevor jemand über höhere Preise spricht, sollte er/sie selbst von diesen überzeugt sein. Denn Kund*innen spüren sofort, ob da jemand ist, der überzeugt ist oder sich rechtfertigt. Deshalb: Vor dem Preiserhöhungsgespräch erst nachdenken, dann handeln und reden.
- Was hat sich wirklich für den/die Kund*in verändert?
- Was ist heute besser als vor einem Jahr?
- Anhand welcher Faktoren kann der/die Kund*in die Preiskorrektur nachvollziehen?
Wer darauf im Vorfeld klare Antworten hat, braucht keine Angst mehr vor dem Gespräch zu haben.
Fakten helfen gegen Nervosität
Wenn Verkäufer*innen sich in langen Erklärungen verlieren, wirkt das wie Unsicherheit. Besser: kurz, konkret, sachlich. Beispiel: „Unsere Energiekosten sind um sieben Prozent gestiegen. Trotzdem haben wir Qualität und Lieferfähigkeit stabil gehalten. Darum brauchen wir eine Anpassung.“ Das klingt ruhig, ehrlich, erwachsen. Kein Trick, kein Druck. Einfach Klartext.
Keine Rechtfertigung, sondern Information
Viele Preisgespräche scheitern schon beim Einstieg. Wer mit „Ich muss Ihnen leider mitteilen …“ anfängt, nimmt sich selbst die Autorität. Besser: „Ich möchte Sie über unsere neuen Konditionen informieren.“ Das ist geradlinig, respektvoll – und zeigt Haltung. Danach gilt: Schweigen. Einfach mal kurz warten. Auch wenn’s schwerfällt. Der/die Kund*in braucht diesen Moment, um das Gesagte zu verarbeiten. Wer sofort weiterredet, nimmt sich die Wirkung.
Wenn Widerstand kommt
Natürlich kommt der Widerstand. „Das ist zu teuer.“ „Dann gehe ich eben zur Konkurrenz.“ Das ist normal. Wirklich. Der/die Kund*in prüft, wie stabil der/die Verkäufer*in bleibt. Denn er/sie braucht das Gefühl der Sicherheit, dass die Preiserhöhung wirklich gerechtfertigt ist – und nicht nur der Gewinnoptimierung des/der Anbietenden dient.
In solchen Momenten helfen ruhige Antworten: „Ich verstehe, dass das für Sie eine Veränderung ist.“ Oder: „Ja. Auch ich hätte gern auf die Preiserhöhung verzichtet, doch unsere Kosten sind entsprechend gestiegen – und ausschließlich diese Kostensteigerung müssen wir nun weitergeben.“ Wichtig ist, dass der/die Verkäufer*in ruhig bleibt. Keine Diskussion. Kein Überzeugen um jeden Preis. Kund*innen respektieren Klarheit mehr als Nachgeben.
Angst vor Kund*innenverlust – normal, aber übertrieben
Jede(r) Verkäufer*in kennt sie. Diese innere Stimme, die sagt: Wenn ich den Preis erhöhe, bin ich raus. Aber die Realität sieht meist anders aus. Die überwiegenden Kund*innen bleiben. Nicht wegen des Preises, sondern wegen Vertrauen und Zuverlässigkeit. Ein paar Gedanken helfen:
- Wer nur wegen des Preises bleibt, bleibt nie lange.
- Wer Qualität will, bleibt bei Qualität.
- Und wer sich fair behandelt fühlt, bleibt sowieso.
Kurz gesagt: Preisgespräche verlieren nur die, die sich selbst zu klein machen.
Nach der Erhöhung – dranbleiben
Viele verschwinden nach dem Gespräch – und das möglichst schnell. Aus Scham, aus Unsicherheit oder weil sie froh sind, dass es vorbei ist. Aber genau jetzt sollte der/die Verkäufer*in präsent bleiben. Und beispielsweise von sich aus regelmäßig Kontakt mit seinem/seiner Kund*in aufnehmen. Um weiterhin Nutzen zu stiften und damit dem/der Kund*in die Bestärkung zu geben, mit dem/der richtigen Lieferant*in zusammenzuarbeiten. Es gilt: Engagement, Verlässlichkeit und Beziehungspflege verkaufen langfristig immer besser als jeder Rabatt.
Mut zur Preiserhöhung ist kein Draufgängertum. Es ist Haltung. Wer an seinen/ihren Wert glaubt, wirkt automatisch überzeugender. Kund*innen akzeptieren Preissteigerungen, wenn sie spüren: Da steht jemand, der weiß, wofür er/sie steht. Und das ist am Ende genau das, was gute Verkäufer*innen von angepassten unterscheidet.
Der Autor und Verkaufstrainer Oliver Schumacher setzt unter dem Motto „Ehrlichkeit verkauft“ auf sympathische und fundierte Art neue Akzente in der Verkäufer*innenausbildung.
Die Forschungszulage – dein Innovations-Booster
Die Forschungszulage – ein oft unterschätztes Fördermittel – avanciert 2026 zu einem noch attraktiveren Finanzierungshebel für Forschung und Entwicklung (F&E).

Die Forschungszulage ist eine steuerliche Erstattung für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen. Anders als bei Projektförderungen muss man sich nichts vorab bewilligen lassen, sondern reicht nachträglich einen Antrag für durchgeführte Arbeiten ein.
Ab 2026 wird die Forschungszulage noch attraktiver: Die Bemessungsgrundlage steigt auf 12 Millionen Euro jährlich. Bei 25 Prozent Fördersatz sind das bis zu drei Millionen Euro für größere Unternehmen. Start-ups und KMU profitieren dank erhöhter Fördersätze sogar von bis zu 4,2 Millionen Euro. Neu ist zudem eine 20-Prozent-Pauschale für Gemeinkosten, die ohne Einzelnachweis berücksichtigt wird. Das Besondere: Die Auszahlung erfolgt auch bei Verlusten oder ohne Steuerlast; für Start-ups in der Aufbauphase ein enormer Vorteil.
Wer profitiert?
Die Forschungszulage ist bewusst niederschwellig gestaltet. Du musst kein Technologie-Unternehmen haben und keine Labore betreiben. Entscheidend ist nur, dass du F&E-Arbeit leistest. Förderfähig ist, wer einen Firmensitz oder eine Betriebsstätte in Deutschland hat, steuerpflichtig ist (auch bei Verlusten!), eigenständige F&E-Projekte durchführt.
Was zählt als Forschung und Entwicklung?
Der Begriff ist breiter, als viele denken. Es geht nicht nur um Grundlagenforschung im klassischen Sinn, sondern auch um die Entwicklung neuer oder wesentlich verbesserter Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen, die Lösung technischer oder wissenschaftlicher Unsicherheiten und systematisches Arbeiten auf Basis wissenschaftlicher Methoden.
Typische Beispiele aus der Start-up-Welt
- Ein FinTech entwickelt einen KI-basierten Algorithmus für Betrugserkennung.
- Ein FoodTech optimiert Fermentationsprozesse für pflanzliche Fleischalternativen.
- Ein SaaS-Start-up programmiert eine innovative Datenbank-Architektur für Echtzeitanalysen.
- Ein MedTech entwickelt einen neuartigen Sensor für tragbare Gesundheitsgeräte.
Wichtig: Auch wenn dein Projekt am Ende scheitert, bleibt die Förderung bestehen. Es zählt der Versuch, etwas Neues zu schaffen – nicht ausschließlich der Erfolg.
Nicht gefördert werden reine Anpassungen, Routineentwicklungen oder bloße die Anwendung bekannter Verfahren.
Wie funktioniert die Beantragung?
Der Prozess läuft in zwei Schritten und ist deutlich unbürokratischer als klassische Förderprogramme.
1. Bescheinigung beim Finanzamt für Forschungszulage
Zunächst musst du nachweisen, dass dein Projekt als F&E-Vorhaben qualifiziert ist. Dafür reichst du beim zuständigen Finanzamt für Forschungszulage (bundesweit gibt es nur das in Nürnberg) folgende Unterlagen ein:
- Beschreibung des F&E-Vorhabens,
- Darlegung der wissenschaftlichen/technischen Unsicherheiten,
- Beschreibung deiner systematischen Vorgehensweise,
- Zeitplan und Budget.
Der Antrag sollte präzise sein, drei bis fünf Seiten sind zumeist ausreichend, detaillierte Kalkulationen müssen nicht einreicht werden. Das Finanzamt prüft innerhalb von drei Monaten und stellt bei positiver Bewertung eine Bescheinigung aus, die drei Jahre gültig ist.
2. Zulageantrag beim Betriebsstättenfinanzamt
Mit der Bescheinigung beantragst du die Zulage bei deinem lokalen Finanzamt. Hier werden die förderfähigen Aufwendungen berechnet:
- Löhne und Gehälter von Mitarbeitenden in F&E (inklusive Lohnnebenkosten), 60 Prozent der Auftragskosten bei externen Dienstleister*innen (z.B. Entwickler*innen, Labore, Hochschulen).
- Neu ab 2026: Zusätzlich 20 Prozent Gemeinkostenpauschale auf die Personalkosten, ohne Einzelnachweis für Miete, Strom, IT oder Verwaltung.
Diese Vereinfachung spart erheblichen Dokumentationsaufwand und macht die Forschungszulage gerade für Start-ups noch attraktiver. Die Auszahlung erfolgt in der Regel innerhalb weniger Monate nach Antragstellung.
Chancen und Stolperfallen für Start-ups
Die größten Chancen
- Liquidität in kritischen Phasen: Gerade in den ersten Jahren kämpfen Start-ups mit Cashflow-Problemen. Ab 2026 bietet die Forschungszulage noch mehr planbare Liquidität: Durch die höhere Bemessungsgrenze und die Gemeinkostenpauschale können deutlich mehr Kosten geltend gemacht werden, ohne Verwässerung von Anteilen oder zusätzlichen Schulden.
- Kombinierbar mit anderen Förderungen: Du kannst die Forschungszulage parallel zum exist Gründerstipendium, zu Investitionszuschüssen oder anderen Programmen nutzen. Lediglich bei direkten Projektförderungen (z.B. ZIM) müssen die geförderten Kosten sauber getrennt werden.
- Wettbewerbsvorteil im Fundraising: Investor*innen schätzen Start-ups, die alle verfügbaren Förderinstrumente nutzen. Die Forschungszulage zeigt, dass du strukturiert arbeitest und öffentliche Mittel effizient einsetzt.
- Weniger Bürokratie ab 2026: Die neue Gemeinkostenpauschale macht das Verfahren deutlich einfacher. Du musst nicht mehr jeden Cent für Raumkosten, Energie oder IT-Infrastruktur einzeln nachweisen, die 20 Prozent werden automatisch aufgeschlagen.
Die häufigsten Stolperfallen
- Zu späte Dokumentation: Der Klassiker – du entwickelst monatelang, aber erfasst nicht systematisch, wer wann woran arbeitet. Ohne nachvollziehbare Dokumentation lehnt das Finanzamt den Antrag ab.
Lösung: Führe von Tag eins an Projekttagebücher oder nutze digitale Tools. - Unklare Projektabgrenzung: Arbeiten deine Entwickler*innen gleichzeitig an F&E-Projekten und an Routine-Features, musst du das klar trennen können. Mische nicht alles in einen Topf.
Lösung: Definiere F&E-Projekte explizit und erfasse die Arbeitszeit getrennt. - Zu vage Projektbeschreibung: „Wir entwickeln eine App“ reicht nicht. Das Finanzamt muss verstehen, welche wissenschaftlich-technische Unsicherheit du lösen willst.
Lösung: Formuliere konkret – „Wir entwickeln einen Algorithmus zur Echtzeit-Sprachübersetzung mit minimaler Latenz unter 100 ms, was bisherige Lösungen nicht erreichen.“ - Förderfähige Kosten übersehen: Viele Start-ups berücksichtigen nur die Gehälter ihrer Entwickler*innen, vergessen aber Lohnnebenkosten oder externe Dienstleister*innen.
Lösung: Rechne alle direkten F&E-Kosten zusammen, auch anteilige Kosten für Werkstudent*innen oder Freelancer*innen. - Fristen verpassen: Die Forschungszulage kann bis zu vier Jahre rückwirkend beantragt werden.
Lösung: Wenn du 2021 bereits F&E betrieben hast, gilt die Frist bis zum 31.12.2025. - Eigenleistung unterschätzen: Gerade Gründer*innen arbeiten selbst intensiv an der Entwicklung mit, vergessen aber, ihre eigene Arbeitszeit anzusetzen.
Lösung: Auch Geschäftsführer*innengehälter sind förderfähig, wenn du direkt an F&E arbeitest.
Checkliste für deinen Einstieg
- Analysiere, welche deiner Projekte als F&E qualifizieren.
- Implementiere eine systematische Zeiterfassung für F&E-Tätigkeiten.
- Sammle alle Unterlagen zu deinem technischen Vorgehen.
- Kalkuliere deine förderfähigen Kosten (inklusive externer Dienstleister*innen).
- Stelle den Bescheinigungsantrag vor Fristablauf.
- Prüfe, ob du Unterstützung durch spezialisierte Berater der Forschungszulage benötigst.
Die Investition von einigen Tagen Arbeit kann dir fünf- bis sechsstellige Beträge einbringen. Bares Geld, das du in weiteres Wachstum, neue Mitarbeitende oder die nächste Produktversion investieren kannst.
Der Autor Markus Pöhlmann, Gründer und CEO der Banhoek Consulting GmbH, ist Experte für die Forschungszulage.
Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital
Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.
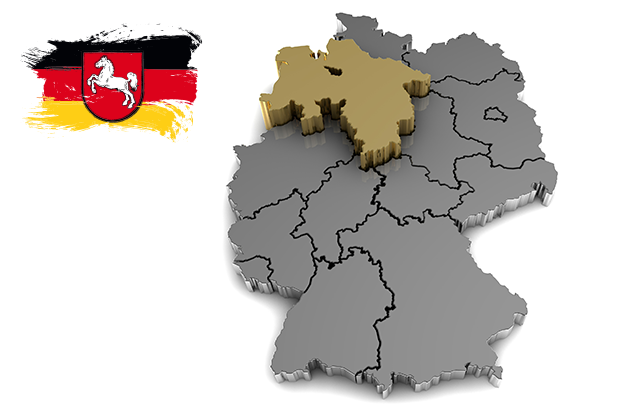
Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.
Gründer*in der Woche: Ghazaleh Madani – Seid geduldig, aber beharrlich!
Im Interview: Wie Ghazaleh Madani, Mitgründerin und CEO des BioTech-Start-ups CanChip, personalisierte Krebstherapien mithilfe ihrer Tumor-on-Chips Wirklichkeit werden lassen will.

Ghazaleh, du bist 2020 aus dem Iran nach Deutschland gekommen, hast hier mehrere Studiengänge erfolgreich absolviert und 2023 CanChip gegründet. Wie hast du diese rasante Reise gemeistert und was treibt dich an?
Meine akademische Laufbahn begann mit einem Studium der Biotechnologie im Iran, immer mit dem Ziel, zur Krebsforschung beizutragen – eine persönliche Mission, die von der Krebserkrankung meiner Mutter geprägt war. Diese Motivation blieb auch bestehen, als ich nach Deutschland kam und meinen Master in Biochemie und Molekularbiologie absolvierte.
Die Idee zu CanChip entstand, als ich meinen Mitgründer Dr. Omid Nejati traf und wir über das Potenzial von Tumoron-chip-Technologien diskutierten. Das war ein Wendepunkt: Ich erkannte, wie wir Ingenieurskunst und Biologie kombinieren können, um etwas wirklich Wirkungsvolles zu schaffen.
Was mich antreibt, ist die Möglichkeit, Patient*innen einen schnelleren und präziseren Weg zur Behandlung zu ermöglichen und letztendlich die Art und Weise zu verändern, wie wir Krebs bekämpfen.
Welche Vision verfolgst du mit CanChip?
Bei CanChip wollen wir personalisierte Krebstherapien Wirklichkeit werden lassen, indem wir die Mikroumgebung von Tumoren auf einem Mikrofluidik-Chip simulieren. Unser Ziel ist es, die Arzneimittelprüfung von Tieren auf prädiktive Modelle mit menschlichen Zellen umzustellen. Wir möchten die Plattform der Wahl für Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen werden, die bessere Werkzeuge für die Entwicklung von Krebsmedikamenten suchen. Über die Forschung hinaus ist es unsere langfristige Vision, patient*innenabgeleitete Tumore in unsere Chips zu integrieren, sodass Ärzt*innen Therapien vor ihrer Anwendung am Patient*innen in vitro testen können. Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der die Krebstherapie mit „Versuch und Irrtum“ durch Präzision und Zuversicht ersetzt wird.
Wie unterscheidet sich euer Ansatz von den bestehenden Methoden?
Traditionelle 2D-Zellkulturen und Tiermodelle können die Komplexität menschlicher Tumore oft nicht abbilden. Unsere Tumor-on-Chip-Modelle beinhalten mehrere menschliche Zelltypen – wie Krebszellen, Endothelzellen und Immunzellen – die in einer 3D-Matrix in einem dynamischen Mikroflüssigkeitssystem eingebettet sind. Diese Anordnung bildet die menschliche Tumorumgebung genauer ab als bestehende Plattformen.
Der Vorteil? Zuverlässigere Daten zur Arzneimittelwirkung, weniger Tierversuche und letztlich eine schnellere und sicherere Entwicklung von Therapien. Unser Modell ist besonders wertvoll für seltene oder therapieresistente Krebsarten wie Glioblastome. Derzeit schließen wir unsere Machbarkeitsstudien ab und bereiten uns auf Kooperationen mit pharmazeutischen Partnern vor.
Künstliche Intelligenz verändert immer mehr Bereiche. Welche Rolle spielt KI in deinem Fachgebiet?
Künstliche Intelligenz wird in der personalisierten Krebsforschung immer wichtiger, insbesondere bei unseren Organ-on-Chip-Modellen. Wir nutzen KI derzeit für die automatisierte Bildanalyse, um die Zellmorphologie und die Reaktion auf Medikamente objektiv zu bewerten. Wir werden die KI-Nutzung ausweiten, um komplexe Daten wie Genexpression und Bildgebung zu analysieren und Vorhersagemodelle für patient*innenspezifische Arzneimittelreaktionen zu erstellen. KI wird auch dazu beitragen, den Versuchsaufbau zu optimieren, beispielsweise die Zellkombinationen und die Mikrofluidik-Einstellungen. Langfristig wird KI für die präklinische Forschung und die personalisierte Medizin unerlässlich sein, indem sie Muster in der komplexen Biologie aufdeckt und die Arzneimittelentwicklung durch datengestützte Entscheidungen beschleunigt.
Die Tumor-on-Chip-Technologie ist nicht unumstritten, und der Weg zu tierversuchsfreien Arzneimittelzulassungen nicht einfach. Was sagst du den Kritiker*innen?
Es stimmt, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch immer stark auf Tierversuche angewiesen sind. Aber die Wissenschaft entwickelt sich weiter. Die Tumoron-Chip-Technologie zielt nicht darauf ab, alle bestehenden Methoden über Nacht zu ersetzen, sondern ergänzt und verbessert sie. Kritiker*innen übersehen oft die Vorteile der Reproduzierbarkeit und der ethischen Vertretbarkeit von in-vitro-Modellen mit menschlichen Zellen. Zudem sind die Regulierungsbehörden zunehmend offen für alternative Methoden, wenn diese zuverlässige Daten liefern. Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, dass unsere Chips konsistente und biologisch aussagekräftige Ergebnisse liefern können. Skepsis ist bei Innovationen normal, aber wir sehen sie als eine Einladung, uns zu verbessern und zu beweisen, dass wir zuverlässige Ergebnisse liefern können.
Ihr seid gerade dabei, eure Chips zu validieren und zu zertifizieren. Welchen Herausforderungen habt ihr euch dabei zu stellen?
Die größte Herausforderung ist die Standardisierung eines hochkomplexen biologischen Systems. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Chips reproduzierbare Ergebnisse liefern, unabhängig von Charge und Krebsart. Gleichzeitig müssen wir klare Protokolle für Qualitätskontrolle und Dokumentation entwickeln, die den regulatorischen Erwartungen entsprechen. Eine weitere Herausforderung ist die Skalierbarkeit: der Übergang von Laborprototypen zu robusten, benutzer*innenfreundlichen Plattformen für die industrielle Nutzung. Das betrifft Materialien, Automatisierung und Kostenoptimierung – und das alles bei gleichzeitiger Wahrung der biologischen Integrität.
Wann erwartest du die Zulassung und welche Aufgaben müssen bis dahin erledigt werden?
Die Zulassung ist ein mehrstufiger Prozess. Wir streben zwar keine direkte medizinische Zulassung an (noch nicht), aber unsere Chips müssen als valide Werkzeuge für die vorklinische Prüfung akzeptiert werden. In den nächsten 12 bis 18 Monaten wollen wir unter anderem Validierungsstudien veröffentlichen, die von Expert*innen geprüft wurden, wichtige pharmazeutische Kooperationen sichern und Qualitätssysteme einführen, die den ISO-Normen entsprechen.
Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden: Wir sind aktiv in Netzwerken und Konsortien tätig, um uns über die neuesten Richtlinien zu informieren. Wir hoffen, innerhalb von zwei Jahren den Status einer akzeptierten vorklinischen Prüfung zu erreichen und kurz darauf mit der Anwendung an Patient*innen beginnen zu können.
BioTech-Start-ups benötigen langfristige Unterstützung und erhebliches Kapital. Wer sind eure Unterstützer*innen und Investor*innen?
Wir haben das Glück, ein starkes Netzwerk an Unterstützer*innen zu haben. Wir erhielten frühzeitig den Newcomer of the Year 2025 German Startup Award, den Sonderpreis des Brandenburg Innovation Awards, den Jurypreis beim Female Start-Aperitivo und viele weitere Auszeichnungen, was uns half, mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Der Wissenschaftspark Potsdam hat uns mit Infrastruktur, Mentoring und einer lebendigen Start-up-Ökosystem-Umgebung unterstützt. Wir haben auch von Netzwerken wie der HealthCapital Berlin-Brandenburg profitiert. Obwohl wir derzeit selbstfinanziert sind und von Pilotstudien und Kooperationen unterstützt werden, bereiten wir uns aktiv auf eine Seed-Finanzierungsrunde vor, um unser Team zu erweitern und die Produktion zu skalieren.
Ein Blick in die Zukunft: Wie nah sind wir daran, eine wirklich personalisierte Krebstherapie für die Mehrheit der Patient*innen zu ermöglichen?
Wir sind näher dran, als wir denken. Fortschritte in der molekularen Diagnostik, der Einzelzellanalyse und der Organ-on-Chip-Technologie laufen auf ein gemeinsames Ziel hinaus. Was noch fehlt, ist die Integration, und hier sind Start-ups führend. Wir agieren schnell, wir gehen Risiken ein und schließen die Innovationslücken, die von größeren Institutionen hinterlassen werden. Personalisierte Krebstherapien werden zum Standard, wenn Plattformen wie unsere innerhalb der klinischen Fristen handlungsrelevante Ergebnisse liefern können. Wir sind davon überzeugt, dass Tumoron-Chip-Modelle innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre zu Standardwerkzeugen in der Onkologie werden und Start-ups wie CanChip diese Transformation anführen werden.
Was möchtest du anderen (BioTech-)Gründer*innen mit auf den Weg geben?
Aus wissenschaftlicher Sicht war die Gründung eines Start-ups ein großer, aber auch lohnender Schritt. Sprecht früh mit potenziellen Kund*innen. Diese Gespräche halfen uns, unser Produkt zu formen und wirkliche Bedürfnisse zu entdecken. BioTech braucht Zeit. Zellkultur, Qualitätskontrolle, Partnerschaften. alles bewegt sich langsamer als geplant.
Seid geduldig, aber beharrlich. Soft Skills wie Kommunikation, Resilienz und strategisches Denken sind genauso wichtig wie wissenschaftliche Expertise.
Vermeidet die Perfektionismusfalle: Beginnt mit dem, was ihr habt, und verbessert iterativ. Mein Rat: Baut ein starkes Team auf, bleibt fokussiert auf eure Mission und habt keine Angst vor Fehlern; sie sind Teil des Prozesses. Verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit unternehmerischem Mut. Diese Mischung kann euch wirklich voranbringen, auch in einem komplexen Bereich wie BioTech.
Ghazaleh, Danke für deine Insights
MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025
Insgesamt 60.000 Euro Preisgeld gehen an drei Gründungsteams aus Hürth, Münster und Solingen. Das sind die siegreichen Teams bei MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025.

MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW zählt mit insgesamt 60.000 Euro Preisgeld zu den bundesweit höchstdotierten Wettbewerben seiner Art. Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025 stehen fest. Die drei mit jeweils 20.000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen an die Prinoa Dental GmbH aus Solingen, die Schreinerwehr GmbH aus Hürth und die Glowkitchen Food GmbH aus Münster.
Mit dem seit 2012 jährlich ausgelobten Preis würdigt die NRW.BANK besonders erfolgreiche und zukunftsweisende Gründungen in Nordrhein-Westfalen. Schirmfrau des Wettbewerbs ist Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur. Die Preisverleihung fand in der NRW.BANK in Düsseldorf statt.
Johanna Antonie Tjaden-Schulte, Vorständin der NRW.BANK: „Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen setzen wir Impulse für die digitale und nachhaltige Transformation und unterstützen Gründende dabei, intelligente Ideen zu verwirklichen. Die Vielfalt und die Stärken der Gründungsszene werden auch bei den Preisträgerinnen und Preisträgern deutlich: Ob nachhaltige Bauweisen, digitale Zahntechnik oder moderne Ernährungskonzepte – der Erfolg aller drei Unternehmen beruht auf Mut, Innovationsgeist und einem klaren Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden. Dieses zukunftsfähige Unternehmertum würdigen wir mit MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025.“
Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur: „Herzlichen Glückwunsch und meinen Respekt an die Gewinnerteams! Sie zeigen, was möglich ist, wenn man Mut beweist und gute Ideen in die Tat umsetzt. Die vielen engagierten Gründerinnen und Gründer in Nordrhein-Westfalen übernehmen Verantwortung, schaffen neue Arbeitsplätze und machen unseren Alltag digitaler, nachhaltiger und einfach besser. Mit MUT – DER GRÜNDUNGSPREIS NRW 2025 würdigen wir dieses Engagement, denn wer gründet, gestaltet aktiv die Zukunft und stärkt NRW als attraktiven Wirtschaftsstandort.“
Die Preisträgerinnen und -träger im Überblick

Das Team von Glowkitchen Food aus Münster zeigt mit Backwaren aus nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Zutaten, dass süße Snacks und bewusste Ernährung vereinbar sind. Statt Industriezucker, Palmfett und Weißmehl kommen viel echte Frucht, Rapsöl, reichhaltiges Dinkelvollkornmehl und andere hochwertige pflanzliche Zutaten in die Backform – beispielsweise für Bananenbrot.
Amplifold sichert sich 5 Mio. Euro Seedfinanzierung
Amplifold, ein 2025 gegründetes Spin-off der LMU München, entwickelt eine ultrasensitive Signalverstärkungsplattform für Lateral-Flow-Immunoassays (LFAs).

Der globale Markt für diagnostische Schnelltests (Point-of-Care-Testing) gehört zu den am schnellsten wachsenden Segmenten im Gesundheitswesen und wird bis 2030 auf über 80 Milliarden US-Dollar geschätzt. Lateral-Flow-Tests (LFAs), zum Beispiel für Infektionen oder kardiovaskuläre Marker, sind zwar weltweit etabliert, stoßen aber bei der Sensitivität an technologische Grenzen: Aktuelle Schnelltests erreichen durchschnittlich nur bis zu 75 Prozent Genauigkeit, was häufig zu Fehldiagnosen führt und den Einsatz zeit- und kostenintensiver PCR-Labortests nötig macht.
Medizintechnologischer Durchbruch
Genau hier setzt Amplifold, ein im Jahr 2025 gegründetes Spin-off der LMU München, an: Mithilfe programmierbarer DNA-Origami-Nanostrukturen steigert das Unternehmen die analytische Sensitivität von Schnelltests um das bis zu 100-Fache. Damit wird es erstmals möglich, PCR-ähnliche Diagnostik in Echtzeit und direkt am Patienten durchzuführen – kostengünstig, ohne Labor und innerhalb weniger Minuten.
Die Plattform des Unternehmens basiert auf Erkenntnissen einer in Nature Communications veröffentlichten Studie, die zeigt, dass programmierbare DNA-Origami-Nanostrukturen die Testempfindlichkeit klassischer LFAs drastisch erhöhen können, ohne dessen Testformat oder bestehende Herstellungsprozesse zu verändern. Diese Technologie ermöglicht kostengünstigen Schnelltests die Sensitivität von gerätebasierten Tests – und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten in der dezentralen Diagnostik, Point-of-Care-Testing und globalen Gesundheitsversorgung in vielen Bereichen, darunter Kardiologie, Neurologie mit Fokus auf Schlaganfälle und Infektionsmedizin.
Die Mittel aus der Finanzierungsrunde nutzt Amplifold, um seine Technologie der Signalverstärkung in eine marktfähige industrielle Lösung zu überführen, das Produktentwicklungs- und Regulatory-Team auszubauen und die IVDR-Zulassung des ersten In-vitro-Diagnostikprodukts in Europa vorzubereiten. Zudem wird das Unternehmen in das Innovations- und Gründerzentrum für Biotechnologie (IZB) in Martinsried – eines der führenden Life-Science-Startup-Zentren Europas – umziehen und dort von der Nähe zu akademischen und klinischen Partnern profitieren.
„Lateral-Flow-Tests haben den Zugang zur Diagnostik revolutioniert, aber ihre Empfindlichkeit blieb traditionell hinter den zentralen Laborsystemen zurück. Mit der DNA-Origami-Signalverstärkung können wir viel mehr Signalgeber auf jedes Bindungsereignis eines Standardstreifens programmieren. Kostengünstige Schnelltests erreichen auf diese Weise die Sensitivität von Labor-Messgeräten, ohne dass das Grundformat verändert werden muss”, sagt Dr. Maximilian Urban, Co-Gründer von Amplifold und Haupterfinder der Kombination aus DNA-Origami-Nanotechnologie und Lateral-Flow-Assays.
Was junge Gründer vom klassischen Autohandel lernen können
Der traditionelle Autohandel ist mehr als nur ein Verkaufsort für Fahrzeuge. Für junge Gründer bietet er wertvolle Lektionen, die weit über das Geschäft mit Autos hinausgehen. Strukturierte Abläufe, persönliche Kundenbetreuung und effizientes Prozessmanagement sind nur einige der Elemente, die Start-ups adaptieren können, um schneller zu wachsen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

In diesem Artikel zeigen wir auf, wie junge Unternehmen von bewährten Strategien und Praktiken des klassischen Autohandels profitieren können – von der Kundenpflege über die Sortimentsgestaltung bis hin zu Servicequalität und Preisgestaltung. Dabei geht es nicht um Nachahmung, sondern um die intelligente Übertragung erfolgreicher Konzepte auf moderne Geschäftsmodelle.
Kundenbeziehungen als Fundament nachhaltigen Wachstums
Im klassischen Autohandel zeigt sich, wie entscheidend stabile und vertrauensvolle Kundenbeziehungen für den langfristigen Erfolg sind. Persönliche Beratung, kontinuierliche Betreuung und das Eingehen auf individuelle Bedürfnisse schaffen Vertrauen und fördern Wiederholungskäufe. Für junge Gründer ist diese Erkenntnis besonders wertvoll: Kundenbindung lohnt sich, auch wenn digitale Geschäftsmodelle andere Kanäle nutzen.
Ein zentraler Punkt ist die Verfügbarkeit von Produkten. Autohändler sichern ihre Reputation durch ein gut sortiertes Lager und schnelle Lieferoptionen. Ähnlich sollten Start-ups darauf achten, dass ihre Kunden zuverlässig bedient werden, zum Beispiel durch schnelle Lieferung für KFZ Teile. Solche Maßnahmen erhöhen nicht nur die Zufriedenheit, sondern stärken auch das Vertrauen in die Marke.
Darüber hinaus lohnt es sich, psychologische Faktoren zu berücksichtigen. Wer die Entscheidungsprozesse der Kunden versteht, kann gezielt Angebote gestalten und den Service verbessern. Prozessoptimierung lernen: Wie der Autohandel Effizienz lebt
Effizienz ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor im klassischen Autohandel. Händler strukturieren ihre Abläufe so, dass jede Phase – vom Kundenkontakt über Probefahrten bis hin zur Vertragsabwicklung – reibungslos funktioniert. Für Start-ups ist dies ein wertvolles Lernfeld: Wer Prozesse von Anfang an klar definiert und optimiert, spart Zeit, reduziert Fehler und steigert die Kundenzufriedenheit.
Standardisierte Abläufe sind hierbei entscheidend. So werden wiederkehrende Aufgaben automatisiert, Ressourcen gezielt eingesetzt und Engpässe vermieden. Diese Prinzipien lassen sich problemlos auf digitale Geschäftsmodelle übertragen, etwa in E-Commerce-Shops für Ersatzteile oder Serviceleistungen.
Darüber hinaus hilft Erfahrungswissen, Abläufe kontinuierlich zu verbessern. Wer regelmäßig reflektiert, welche Prozesse gut funktionieren und wo Optimierungspotenzial besteht, kann schnell auf Marktveränderungen reagieren.
Sortiment, Ersatzteile & Verfügbarkeit: Warum Auswahl ein Wettbewerbsvorteil ist
Ein breites und gut organisiertes Sortiment ist im Autohandel entscheidend für den Erfolg. Kunden schätzen Händler, die verlässlich die benötigten Produkte anbieten und schnell liefern können. Für junge Gründer ist das eine zentrale Lektion: Wer seine Produktpalette klar strukturiert und die Verfügbarkeit sicherstellt, schafft Vertrauen und steigert die Kundenzufriedenheit.
Besonders im Bereich Ersatzteile kommt es auf Schnelligkeit und Präzision an. Lange Lieferzeiten oder fehlende Teile führen zu Frustration und Kundenverlust. Start-ups können hier von etablierten Handelsstrukturen lernen und digitale Prozesse mit klassischer Logistik kombinieren, um Effizienz und Servicequalität zu maximieren.
Darüber hinaus lohnt es sich, auf Kundenfeedback zu achten. Wer versteht, welche Produkte besonders gefragt sind, kann sein Sortiment gezielt optimieren und Wettbewerbsvorteile aufbauen. Ein gut geplantes Sortiment wird so zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor, der Vertrauen schafft und Kundenbindung stärkt.
Preisgestaltung mit Strategie – Lektionen aus dem traditionellen Handel
Die Preisgestaltung ist im Autohandel ein strategisches Instrument, das weit über den reinen Verkaufspreis hinaus Wirkung zeigt. Händler nutzen klare Preismodelle, gezielte Rabatte und psychologische Preisanker, um den Wert ihrer Produkte zu kommunizieren und Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Für Start-ups bietet dies wertvolle Ansätze, wie sie ihre eigenen Preisstrategien entwickeln können.
Transparenz spielt dabei eine zentrale Rolle. Kunden schätzen es, wenn Preise nachvollziehbar sind und sich die Konditionen klar erklären lassen. Gleichzeitig können saisonale Aktionen, Bündelangebote oder Rabatte gezielt eingesetzt werden, um Absatz zu fördern, ohne die Markenwahrnehmung zu beeinträchtigen.
Ein weiterer Aspekt ist die Wertwahrnehmung. Der Autohandel zeigt, dass nicht der niedrigste Preis, sondern ein fairer, nachvollziehbarer Preis Vertrauen schafft. Start-ups können dies auf ihre Produkte oder Dienstleistungen übertragen: Strategische Preisgestaltung trägt direkt zur Kundenzufriedenheit und zur langfristigen Bindung bei.
Servicequalität als unterschätztes Alleinstellungsmerkmal
Servicequalität ist im klassischen Autohandel ein entscheidender Differenzierungsfaktor. Kunden erinnern sich an die persönliche Betreuung, die schnelle Problemlösung und die kompetente Beratung, oft mehr als an das Produkt selbst. Für Start-ups ist dies eine wichtige Lektion: Exzellenter Service kann ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein, selbst in gesättigten Märkten.
After-Sales-Services, wie Wartung, Ersatzteilversorgung oder Beratung bei Problemen, stärken die Kundenbindung nachhaltig. Wer proaktiv auf Anliegen eingeht und Lösungen anbietet, baut Vertrauen auf und erhöht die Wahrscheinlichkeit von Folgegeschäften. Dabei ist Konsistenz entscheidend – ein einmal positiver Eindruck reicht nicht; Service muss kontinuierlich zuverlässig sein.
Darüber hinaus bietet ein guter Service die Möglichkeit, wertvolles Feedback zu sammeln. Kundenrückmeldungen helfen, Produkte und Abläufe zu verbessern und das Angebot zielgerichtet weiterzuentwickeln. Für Gründer bedeutet dies: Service ist nicht nur Support, sondern ein aktives Instrument zur Optimierung des gesamten Geschäftsmodells.
Erfahrungswissen & Marktverständnis nutzen: Das „Bauchgefühl“ der Händler
Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor im klassischen Autohandel ist das Erfahrungswissen der Händler. Jahrelange Praxis ermöglicht es ihnen, Marktentwicklungen frühzeitig zu erkennen, Trends zu antizipieren und Entscheidungen auf Basis von Intuition und Erfahrungswerten zu treffen. Für junge Gründer bedeutet das: Lernen Sie, Daten und Praxiswissen zu kombinieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Dieses „Bauchgefühl“ entsteht durch kontinuierliche Beobachtung des Marktes, den direkten Kundenkontakt und die Reflexion eigener Erfahrungen. Wer diese Prinzipien auf sein Start-up überträgt, kann Risiken minimieren, Chancen schneller erkennen und Prozesse flexibel anpassen.
Digitale Tools und Analysen liefern zusätzlich objektive Daten, doch die Kombination aus Erfahrung und Datenanalyse schafft einen echten Wettbewerbsvorteil. Start-ups sollten daher sowohl strukturierte Auswertungen als auch qualitative Beobachtungen in ihre Entscheidungen einbeziehen, um ein tiefes Marktverständnis aufzubauen.
Fazit: Tradition trifft Innovation
Der klassische Autohandel bietet jungen Gründern wertvolle Einblicke, die weit über den Verkauf von Fahrzeugen hinausgehen. Kundenorientierung, Prozessoptimierung, strategische Preisgestaltung, Sortiment und Servicequalität sind Kernbereiche, in denen Start-ups von etablierten Strukturen lernen können.
Die zentrale Erkenntnis lautet: Traditionelles Wissen muss nicht kopiert, sondern intelligent auf moderne Geschäftsmodelle übertragen werden. Wer die Prinzipien des Autohandels versteht und mit digitalen Tools, innovativen Prozessen und einer klaren Strategie kombiniert, verschafft sich einen klaren Wettbewerbsvorteil.
Nutzen Sie diese Lektionen, um Ihr Start-up effizienter, kundenorientierter und langfristig erfolgreich zu gestalten. Ob es um Produktverfügbarkeit, die schnelle Lieferung für KFZ Teile oder Servicequalität geht – eine durchdachte Umsetzung traditioneller Handelsprinzipien schafft Vertrauen, steigert die Kundenzufriedenheit und legt den Grundstein für nachhaltiges Wachstum.
Freelancer-Kompass 2026: 43 % der Freelancer*innen ohne gesicherte Projekt-Auslastung
Die erste Erhebung des Freelancer-Kompass 2026 unterstreicht die wachsende Unsicherheit in der Projektlandschaft und zeigt deutliche Rückgänge der Auftragslage in mehreren Branchen.

Die wirtschaftliche Unsicherheit unter Freelancer*innen spitzt sich weiter zu: 43 Prozent haben derzeit keine gesicherte Auslastung für die kommenden Monate. Die Hälfte gibt zudem an, dass sich die Auftragslage im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert hat. Das zeigen die Ergebnisse der ersten und aktuellen Erhebungswelle für den Freelancer-Kompass 2026 von freelancermap. Seit mehr als zehn Jahren liefert Deutschlands größte Freelancer-Plattform umfangreiche Daten zur Selbständigkeit im deutschsprachigen Raum. Für die kommende Ausgabe des Freelancer-Kompass ermöglichen erstmals mehrere kurze Umfragen ein detaillierteres Bild des Ist-Zustandes.
Die Auslastungsangaben der Selbständigen verdeutlichen, wie angespannt die aktuelle Projektsituation ist. Zwölf Prozent der Befragten haben eine gesicherte Auftragslage bis zu einem Monat, jeder Fünfte hat Projekte für die nächsten zwei bis drei Monate sicher, 13 Prozent für vier bis sechs Monate. Für einen Großteil der Freelancer*innen bleibt eine langfristige Planung daher unmöglich.
Weniger Aufträge in mehreren Branchen
Die angespannte Situation zeigt sich auch beim Blick auf die Branchen. In mehreren Sektoren melden Freelancer*innen einen spürbaren Rückgang der Nachfrage. Insbesondere betroffen ist die gegenwärtig krisenbehaftete Automobilbranche. 32 Prozent der Befragten geben an, das sie hier einen Rückgang der Aufträge verzeichnen. Im Sektor IT/Software sind es 23 Prozent und in der Industrie, dem Maschinenbau sowie im Bereich Banken/Finanzwesen jeweils zwölf Prozent.
„Wenn in so vielen Branchen Aufträge zurückgehen und fast die Hälfte der Freelancer keinerlei Planungssicherheit hat, ist das längst kein individuelles Risiko mehr, sondern ein strukturelles“, sagt Thomas Maas, CEO von freelancermap. „Freelancer stehen für Flexibilität und Expertise. Doch genau diese Menschen geraten zunehmend unter Druck, weil wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen ihnen ihre Arbeit erschweren. Branchenrückgänge, kurze Auslastungshorizonte und operative Hürden in Projekten wirken zudem zusammen. Das trifft nicht nur einzelne, sondern prägt den Markt insgesamt.“
Herausfordernde Zusammenarbeit
Zu den häufigsten Auftraggebern zählen überwiegend größere Unternehmen. So arbeiten 60 Prozent der Befragten mit dem Mittelstand zusammen und 58 Prozent mit Konzernen. Dahinter folgen Agenturen und Beratungen (27 Prozent) sowie Start-ups (21 Prozent). In der täglichen Projektarbeit und Zusammenarbeit begegnen Freelancer*innen mehreren Schwierigkeiten, die ihre Arbeitsweise erschweren. Besonders häufig genannt werden unklare Anforderungen (55 Prozent), verzögerte Rückmeldungen (47 Prozent) sowie fehlende Entscheidungen (42 Prozent).
Beim Blick auf den Arbeitsort zeigt sich, dass ein überwiegender Teil der Selbständigen (71 Prozent) aus dem Homeoffice arbeitet. 22 Prozent arbeiten hybrid. Nur jeder Zwanzigste (5 Prozent) arbeitet bei dem Kunden / der Kundin vor Ort. Die Möglichkeit einer Workation nutzen zwei Prozent der Befragten.
Rahmenbedingungen ausschlaggebend
Freelancer*innen lehnen Projekte vor allem dann ab, wenn grundlegende Rahmenbedingungen nicht stimmen. Am häufigsten wird ein zu niedriger Stundensatz genannt (70 Prozent). Ebenfalls stark vertreten ist die Aussage, dass das Projekt nicht zu den eigenen Fähigkeiten passt (62 Prozent). Besteht nicht die Möglichkeit, remote zu arbeiten, ist dies für knapp die Hälfte (49 Prozent) ein Ausschlusskriterium.
„Freelancer bringen viel Erfahrung, Tempo und Spezialisierung in Projekte ein. Doch das gelingt nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen“, sagt Thomas Maas. „Unklare Anforderungen oder fehlende Entscheidungen kosten alle Beteiligten Zeit. Gute Zusammenarbeit entsteht dort, wo Unternehmen klare Ansprechpartner, klare Ziele und klare Prozesse schaffen.“
Zum Freelancer-Kompass und der Methodik
Seit über zehn Jahren liefert der Freelancer-Kompass die umfassendste Datengrundlage zur Selbständigkeit im deutschsprachigen Raum. Die Studie beleuchtet Arbeitsbedingungen, Preis- und Einkommensentwicklungen, Akquise-Strategien, Zufriedenheit sowie fachliche und strukturelle Herausforderungen – und berücksichtigt dabei stets auch die Perspektive der Unternehmen.
Für die kommende Ausgabe 2026 wurde die Methodik erstmals weiterentwickelt: Statt einer einmal jährlich erhobenen Großumfrage mit über achtzig Fragen setzt freelancermap nun auf mehrere thematische Erhebungswellen, die ein noch präziseres Bild der aktuellen Situation von Freelancer ermöglichen. Die hier genannten Ergebnisse stammen aus der ersten Befragung, die vom 17. November bis 3. Dezember 2025 unter mehr als 1.300 Teilnehmenden durchgeführt wurde.
Der vollständige Freelancer-Kompass 2026 erscheint Anfang März und fasst alle Befragungswellen zusammen.