Aktuelle Events
Schutz vor teuren Abo-Fallen
Recht für Gründer: Das sollten Sie vor einem Online-Vertragsabschluss beachten, um Abo-Fallen zu vermeiden.

Im realen Leben können Verträge schriftlich oder mündlich abgeschlossen werden. Im Internet sieht das jedoch leider ganz anders aus. Dort können Vereinbarungen auch per E-Mail oder auch durch das (versehentliche) Anklicken von Werbebannern zustande kommen. Suchen Verbraucher im Internet nach Routenplanern oder Kochrezepten, wollen sie sich „gratis“ oder „kostenlos“ ihren Stammbaum erforschen oder ihre Lebenserwartung berechnen lassen, ist spätestens dann die Verzweiflung groß, wenn die erste Rechnung ins Haus flattert oder ungeahnt Geld vom Konto abgebucht wird. Alle diese Angebote haben eines gemeinsam: Sie sehen aus, als wären sie kostenlos, sind aber für Verbraucher oftmals eine teure Abo- oder Vertragsfalle.
Abofallen sind keine Seltenheit!
Laut Statista sind bereits 13 Prozent aller deutschen Internetnutzer auf eine Abofalle im Internet hereingefallen. 61 Prozent gaben an, über Abofallen im Netz Bescheid zu wissen. Dabei können sich die in Rechnung gestellten Beträge bis auf einen dreistelligen Betrag pro Monat belaufen. Meist reagieren die Unternehmen auf Kündigungen oder E-Mails überhaupt nicht, bis ein Schreiben des Inkassobüros oder einer Anwaltskanzlei ins Haus flattert. Tausende Nutzer tappen täglich in derartige Fallen und nur die wenigsten Betroffenen wehren sich gegen diese Geschäftemacherei. Aus Unkenntnis oder aus Angst vor den in den Rechnungen angedrohten Konsequenzen, zahlen sie den geforderten Betrag, um die Sache zu klären und abzuhaken. Dass bei versteckten Preisangaben jedoch oftmals nichts bezahlt werden muss, wissen leider nur die wenigsten Verbraucher.
Sie können jedoch schon vorher erkennen, ob es sich beim gewünschten Dienst um eine Abofalle handelt oder nicht: hier einige wichtige Kritierien.
Vorsicht bei kostenlosen oder günstigen Testabos!
Beim Verbraucher sollten schon hier sämtliche Alarmglocken läuten, denn im Internet ist selten etwas kostenlos. Egal, ob kostenlose Geschenke, Boni, Rabatte oder Preisnachlässe – irgendwo dabei ist immer ein Haken. Ein Blick in das Impressum des Anbieters lohnt sich allemal, denn wenn hier nur ein Postfach als Adresse angegeben ist bzw. das Unternehmen im Ausland sitzt, ist Vorsicht angebracht. Denn Abzocker haben Angst vor der deutschen Justiz und vor dem deutschen Finanzamt und verstecken sich daher gerne in der Anonymität. Besonders beliebte Länder sind Dubai, Großbritannien, Schweiz, British Virgin Islands und Rumänien.
Auf den Bestell-Button achten
Egal, ob es sich um den Kauf eines Abos, einer Dienstleistung oder eines Produkts handelt, seit dem 1. August 2012 bestimmt die sogenannte Button-Lösung (BGB §312g Abs.2), dass Anbieter von Online-Diensten ihr Angebot so gestalten müssen, dass Nutzer klar erkennen können, dass sie kostenpflichtig etwas bestellen. Ein Vertrag kommt also nur zustande, wenn diese Informationen erteilt wurden und wenn der Verbraucher ausdrücklich bestätigt, dass er sich zur Zahlung verpflichtet. In Onlineshops erfolgt dies in der Regel über einen speziellen, gut lesbaren Bestell-Button mit der Aufschrift „kostenpflichtig bestellen“, „zahlungspflichtig bestellen“ oder „kaufen“.
Versteckte Kosten und Preisangaben
Seriöse Anbieter informieren ihre Kunden klar und deutlich über Kosten, die bei der Nutzung ihrer Dienste anfallen. Ist die Kostenpflicht allerdings für den Verbraucher nicht klar ersichtlich bzw. nur in den AGBs enthalten oder im Kleingedruckten versteckt, handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Abzocke.
Frage nach persönlichen Daten im Anmeldeformular
Abzocker im Internet folgen meist einer altbewährten Masche. Sie locken mit großen Versprechungen und bunten Grafiken, die ablenken sollen. Hier werden Verbraucher angehalten, private Daten in ein Anmeldeformular einzutragen. Vor allem wenn es sich dabei um intime Angaben wie Geburtsdatum, Telefonnummer, Anschrift oder sogar Kontodaten für ein scheinbar kostenloses Angebot handelt, ist Vorsicht angebracht. Denn darum geht es letztendlich: Die Betrüger brauchen den Namen und die Anschrift, an welche sie später ihre fragwürdige Rechnung schicken können.
Bitten um Bestätigung der AGBs
Zum Abschluss des vermeintlich „kostenlosen“ Dienstes werden Verbraucher oftmals gebeten, die nicht weiter ausgeführten AGBs, „Kundeninfos“, „Verbraucherinformationen“ oder ein „Werbe-Einverständnis“ zu bestätigen. Doch in denen wird regelmäßig die vermeintliche Kostenpflicht versteckt. Daher: Niemals etwas bestätigen, was nicht vorher gründlich und ausführlich durchgelesen wurde. Das gilt vor allem auch für das nervige Kleingedruckte.
Die miesesten Tricks der Betrüger
Suchmaschinen
Oftmals gestalten diese Anbieter ihre Webseiten seriös mit harmlos aussehenden Internetadressen. Sie sorgen dafür, dass diese Webseiten möglichst weit oben von den Suchmaschinen gerankt werden. Darüber hinaus buchen die Anbieter Werbung, vor allem bei Google. Suchen Verbraucher dort nach einer Software oder einem bestimmten Angebot, stoßen sie zuerst auf das Angebot der kriminellen Webseiten-Betreiber.
Tests und Gewinnspiele
Mit vermeintlich attraktiven Gewinnspielen und scheinbar kostenlosen Testangeboten werden Verbraucher zum Klicken angeregt. Dabei ist allerdings nicht auf den ersten Blick ersichtlich, welche Kosten dafür anfallen. bzw. diese werden bewusst verschleiert.
Spam und Werbe-E-Mails
Werbe-E-Mails sind lästig und meist auf den ersten Blick als solche erkennbar. Inzwischen ist Spam aber oftmals nicht mehr eindeutig zu erkennen und ähnelt E-Mails von seriösen Anbietern, sodass sie leicht verwechselt werden können. In diesen Nachrichten kann z.B. stehen, dass der Empfänger etwas gewonnen hätte, aber vorher aufgefordert wird, eine Bearbeitungsgebühr zu bezahlen. Nachdem aber gezahlt wurde, erhält man keinen Gewinn. Es kann aber auch sein, dass Verbraucher in diesen Mails aufgefordert werden, auf einen externen Link zu klicken, der sie dann auf eine unseriöse Seit lockt.
Illegale Filmdienste
Eine weitere Masche der Abzocker ist es, sich bei beliebten Filmseiten einzuklinken. Dort ködern sie ahnungslose Nutzer mit normalerweise kostenfreier Video-Abspielsoftware. Klicken sie dann weiter, werden sie auf eine unseriöse Webseite weitergeleitet, wo sie aufgefordert werden, ihre Kontaktdaten einzugeben.
Einkaufsgutscheine
Als Filial-Tester des deutschen Lebensmittelhandels REWE locken derzeit Betrüger die Verbraucher über Messenger, wie z.B. WhatsApp, oder per E-Mail in die Abofalle. Als Belohnung lockt dafür ein Einkaufsgutschein, z.B. von Rewe. Der Trick ist simpel: Der Nutzer wird dabei gebeten, zuerst an einer Umfrage teilzunehmen, um dann den Warengutschein zu erhalten. Klicken ahnungslose Verbraucher auf den irreführenden Link, landen sie auf einer nahezu perfekt kopierten Internetseite im REWE-Design. Geben sie ihre Adresse ein, um den Gutschein zu erhalten, hat die Abofalle zugeschnappt. Bei WhatsApp werden die Nutzer ähnlich wie bei einem Kettenbrief gebeten, die Aktion erst an zehn weitere WhatsApp-Kontakte zu schicken, bevor sie den Einkaufsgutschein erhalten.
Was tun, wenn die Falle zuschnappt?
Viele Verbraucher tappen dennoch in eine Abofalle und wissen dann oftmals nicht, was zu tun ist. Auf jeden Fall sollten sie sofort handeln und sich entweder an einen darauf spezialisierten Anwalt wenden oder ein Online-Vermittlungsportal für Rechtshilfe kontaktieren, die sich dieser Problematik vertrauensvoll annehmen. Auch Verbraucherzentralen sind eine gute Anlaufstelle, um sich Rat zu suchen. Darüber hinaus besteht zu jedem abgeschlossenen Vertrag im Internet ein gesetzliches Widerrufsrecht. Zu beachten dabei ist, dass der Widerruf in Textform erfolgen muss, am besten per Einschreiben/Rückschein, damit der Zugang auch bewiesen werden kann. Um später einen Nachweis zu haben, sollte der gesamte Schriftverkehr kopiert und aufbewahrt werden.
Der Autor Helmut Ablinger ist Gründer des Legaltech-Start-ups JAASPER, das Rechtsberatung vermittelt.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung
Recht für Gründer*innen: Wie das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung Unternehmen neue Perspektiven in schwierigen Zeiten aufzeigen kann.

Start-ups stehen in einer immer komplexeren und dynamischeren Wirtschaftswelt vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Globalisierte Märkte, technologische Umwälzungen, volatile Lieferketten und unerwartete Krisen erhöhen den Druck, flexibel zu agieren und Strategien kontinuierlich anzupassen. Gerät ein Jungunternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten, erscheint der Weg in die Insolvenz oft unausweichlich. Dabei wird dieser Begriff häufig mit dem Ende assoziiert – Betriebsschließungen, Entlassungen und der Verlust von Jahren harter Arbeit.
Die Insolvenz in Eigenverwaltung eröffnet eine Alternative, die statt Stillstand neue Möglichkeiten offeriert. Dieses Verfahren schafft nicht nur den Raum für eine aktive Neuausrichtung, sondern bietet die Chance, Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten. Im Unterschied zur klassischen Regelinsolvenz, bei der ein(e) externe(r) Insolvenzverwalter*in die vollständige Kontrolle übernimmt, bleibt die operative Leitung bei Schutzschirm und Eigenverwaltung in den Händen der Geschäftsführung. In diesem Zuge gewährleistet ein(e) Sachverwalter*in die gerichtliche Kontrolle zum Schutz der Interessen der Gläubiger*innen und zur Sicherstellung der Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben. Dieses Modell vereint unternehmerische Handlungsfreiheit mit gerichtlicher Aufsicht und ermöglicht eine individuell angepasste Sanierung, bei der nicht die Zerschlagung, sondern die langfristige Stabilisierung und Wettbewerbsfähigkeit des Start-ups im Fokus stehen.
Präzise Vorbereitung als Schlüssel
Die Insolvenz in Eigenverwaltung setzt eine sorgfältige Planung und Vorbereitung voraus. Bereits bei der Antragstellung braucht es ein schlüssiges Konzept, das die Ursachen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten klar analysiert und realistische Lösungsansätze präsentiert. Eines der zentralen Elemente ist dabei der Sanierungsplan. Er legt dar, wie der Betrieb finanzielle Stabilität erreichen, die Liquidität sichern und die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen kann. Neben Kostensenkungen und der Optimierung von Prozessen umfasst der Plan häufig auch Maßnahmen wie die Neuausrichtung des Geschäftsmodells oder die Fokussierung auf profitablere Kernbereiche. Ergibt eine gerichtliche Prüfung, dass das Management in der Lage ist, den Betrieb erfolgreich zu führen, und erscheint der Sanierungsplan glaubwürdig und realistisch, erfolgt eine Genehmigung des Verfahrens. Unternehmen, die hier frühzeitig eine Restrukturierungsberatung hinzuziehen, erhöhen ihre Erfolgsaussichten deutlich. Denn das Expert*innenwissen trägt stark dazu bei, mögliche Schwächen des Konzepts zu identifizieren und die Anforderungen des Insolvenzgerichts genau zu erfüllen.
In der Krise aktiv gestalten, statt aufzugeben
Nach der Anmeldung des Insolvenzverfahrens tritt der sogenannte Schutzschirm beziehungsweise die vorläufige Eigenverwaltung in Kraft, die das Start-up vor Zwangsvollstreckung durch Gläubiger*innen schützt. Mit diesem rechtlichen Rahmen verschafft sich die Geschäftsführung den notwendigen Spielraum, um geplante Restrukturierungsmaßnahmen umzusetzen. In dieser Phase steht nicht nur die kurzfristige Sicherung der Liquidität im Vordergrund, sondern auch die strategische Neuausrichtung des Unternehmens. Zudem schafft der Schutzschirm eine konstruktive Verhandlungsbasis mit den Gläubiger*innen.
Langjährige Partner*innen schätzen es eher, wenn die Gründer*innen aktiv an einer Lösung arbeiten, statt passiv auf eine Regelinsolvenz zuzusteuern. Damit stärken sie das Vertrauen und erleichtern Verhandlungen über Stundungen, Forderungsschnitte oder andere Maßnahmen, die für den Sanierungsprozess notwendig sind.
Individuell statt standardisiert
Die Insolvenz in Eigenverwaltung erlaubt es Gründer*innen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und diese auf ihre spezifischen Unternehmensbedürfnisse zuzuschneiden. Im Gegensatz zur klassischen Insolvenz, bei der standardisierte Prozesse oft wenig Raum für individuelle Anpassungen lassen, eröffnen Schutzschirmverfahren und Eigenverwaltung die Möglichkeit, flexibel auf die Anforderungen des Markts und die internen Gegebenheiten zu reagieren. Zu den typischen Maßnahmen zählen beispielsweise die Reduktion von Fixkosten, die Umstrukturierung von Verbindlichkeiten und die Optimierung betrieblicher Abläufe. Häufig entscheiden sich Unternehmen auch dafür, unrentable Geschäftsbereiche aufzugeben und stattdessen ihre Ressourcen auf profitable Kernsegmente zu konzentrieren. Gleichzeitig bietet das Verfahren Raum für Innovationen und Investitionen, die langfristige Wachstumschancen eröffnen. Digitalisierung, neue Technologien und die Entwicklung zukunftsorientierter Produkte und Dienstleistungen spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Positive Effekte auf Unternehmenskultur und Motivation
Die aktive Rolle der Geschäftsführung wirkt sich nicht nur auf den Restrukturierungsprozess aus, sondern auch auf die Unternehmenskultur. Mitarbeitende erleben, dass das Management Verantwortung übernimmt und entschlossen handelt, um die Krise zu bewältigen. Dies stärkt nicht nur das Vertrauen in die Gründer*innen, sondern auch den Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft. Unsicherheiten, die in Krisensituationen häufig zu einem Rückgang der Motivation führen, lassen sich durch eine transparente Kommunikation und sichtbare Fortschritte deutlich reduzieren. Kund*innen und Lieferant*innen schätzen die Kontinuität, die durch diese Verfahren gewährleistet bleibt. Im Gegensatz zur Regelinsolvenz, bei der externe Verwalter*innen oft wenig Kenntnis über bestehende Geschäftsbeziehungen haben, bleiben in Schutzschirm und Eigenverwaltung die direkten Ansprechpartner*innen erhalten. Dies sichert den Erhalt wichtiger Kooperationen für die Zukunft.
Langfristig stabil und wettbewerbsfähig
Neben der Stabilisierung der finanziellen Lage eröffnen Schutzschirm und Eigenverwaltung strategische Chancen, die weit über die Bewältigung der akuten Krise hinausreichen. Viele nutzen diese Phase beispielsweise, um ihre Marktposition neu zu bewerten, ungenutzte Potenziale zu erschließen und sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Dazu gehören beispielsweise gezielte Weiterentwicklungen des Geschäftsmodells, die Integration neuer Technologien und die Erschließung neuer Märkte. Auch Gläubiger*innen profitieren von dieser Vorgehensweise. Statt sich mit einer möglicherweise geringen Quote zufriedenzugeben, erhalten sie durch die Eigenverwaltung die Aussicht auf eine deutlich höhere Rückzahlung ihrer Forderungen. Dieses Win-win-Prinzip zeigt, dass die Eigenverwaltung nicht nur für das Start-up, sondern auch für dessen Partner*innen eine attraktive Lösung darstellt.
Neuanfang mit Perspektive
Jungunternehmen, die frühzeitig auf die Eigenverwaltung setzen, schaffen sich den notwendigen Handlungsspielraum, um die Krise effektiv zu bewältigen. Je länger gewartet wird, desto schwieriger wird es, das Vertrauen von Gläubiger*innen, Mitarbeitenden und Geschäftspartner*innen zu erhalten. Frühzeitiges Handeln ermöglicht es, Schwachstellen gezielt zu adressieren und die Erfolgsaussichten des Verfahrens erheblich zu steigern. Erfolgreich abgeschlossene Verfahren zeigen, dass die Insolvenz in Eigenverwaltung nicht das Ende, sondern einen Neuanfang bedeuten kann. Unternehmen, die diesen Weg wählen, nutzen die Krise, um sich neu zu positionieren, ihre Strukturen zu modernisieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Mit einem klaren Plan, einer engagierten Führung und externer Unterstützung lassen sich so nicht nur kurzfristige Probleme bewältigen, sondern auch langfristige Erfolge erzielen.
Der Autor Ulrich Kammerer ist geprüfter ESUG- und StaRUG-Berater sowie Vorstand von UKMC eG – Die Unternehmer-Retter by Ulrich Kammerer.
Mindestlohn 2025 - das musst du wissen!
Was sich seit dem 1.1.2025 rund um den gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland geändert hat und was jetzt steuerrechtlich zu beachten ist.

Seit dem 1. Januar 2025 gilt ein höherer gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland. Die Erhöhung bringt nicht nur Anpassungen beim Stundenlohn mit sich, sondern wirkt sich auch auf Minijobs und spezielle Regelungen für bestimmte Personengruppen aus. Im Folgenden liest du, was der neue Mindestlohn konkret bedeutet, wer davon profitiert und wie sich die Änderungen auf die Aufzeichnungspflichten auswirken.
Mindestlohn 2025: Höhe und Bedeutung
Seit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns im Jahr 2015 wurde dieser von damals 8,50 Euro auf 12,41 Euro im Jahr 2024 schrittweise gesteigert. Zum Jahresbeginn 2025 gilt ein erhöhter gesetzlicher Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde. Dieser Betrag gilt grundsätzlich für alle Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland – unabhängig von der Staatsangehörigkeit der Arbeitnehmer*innen, dem Unternehmenssitz des Arbeitgebenden oder dem Wohnsitz des/der Beschäftigten. Damit fallen auch grenzüberschreitend tätige Arbeitskräfte und Saisonarbeitenden unter den Schutz des Mindestlohns.
Bei monatlichen Festvergütungen, Akkord- oder Stücklöhnen müssen Arbeitgebende den Stundenlohn rechnerisch ermitteln. Denn auch in diesen Fällen dürfen Arbeitgebende den Mindestlohn nicht unterschreiten.
Mindestlohn 2025: Auswirkungen auf Minijobs
Seit 2022 ist die Verdienstgrenze für Minijobs dynamisch an den Mindestlohn gekoppelt. Das bedeutet, dass mit jeder Mindestlohnerhöhung auch die Obergrenze für Minijob-Einkünfte angepasst wird. Ab Januar 2025 dürfen Minijobber*innen bis zu 556 Euro monatlich verdienen, was einer Arbeitszeit von etwa 43,3 Stunden pro Monat entspricht. Diese Anpassung sorgt dafür, dass Minijobber*innen nicht mit steigendem Mindestlohn ihre Arbeitszeit reduzieren müssen.
Für Minijobber*innen ist es besonders wichtig, die Auswirkungen des Mindestlohns auf ihre Arbeitszeit und das monatliche Einkommen im Blick zu behalten. Arbeitgebende und Arbeitnehmende sollten vor Jahreswechsel die Stunden und den Stundenlohn überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verdienstgrenze eingehalten wird und es nicht zu ungewollten Überschreitungen kommt.
Da sich mit der Erhöhung des Mindestlohns auch die Verdienstgrenzen für Minijobs und Midijobs verändern, ist es für Arbeitgebende und Beschäftigte wichtig, die aktuellen Regelungen genau zu kennen. Besonders Midijobber*innen profitieren von den neuen Einkommensgrenzen, da sie durch angepasste Sozialversicherungsbeiträge netto oft mehr verdienen.
Wer ist vom Mindestlohn ausgenommen?
Obwohl der Mindestlohn fast flächendeckend in Deutschland gilt, gibt es einige gesetzlich festgelegte Ausnahmen. Die Regelungen des Mindestlohngesetzes gelten nicht
- bei Praktikant*innen, die ein Pflichtpraktikum im Rahmen ihrer Schul- oder Berufsausbildung oder eines Studiums absolvieren,
- für Orientierungspraktika bis drei Monaten,
- für freiwillige Praktika während eines Studiums oder einer Ausbildung. Sie sind für maximal drei Monate vom Mindestlohn ausgenommen. Das gilt jedoch nur, wenn kein vorheriges Praktikumsverhältnis mit dem Unternehmen bestanden hat,
- für Personen unter 18 Jahren, die noch keine Berufsausbildung abgeschlossen haben,
- für Auszubildende, denn für sie gibt es seit 2020 spezielle Mindestausbildungsvergütungen,
- für ehrenamtlich Tätige und Langzeitarbeitslose: Letztere sind in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung vom Mindestlohn befreit.
Diese Ausnahmen berücksichtigen die besonderen Bildungs- und Berufsorientierungsbedürfnisse der jeweiligen Gruppen und sind darauf ausgelegt, zusätzliche Hürden auf dem Weg in den Arbeitsmarkt zu vermeiden.
Mindestlohn 2025: Aufzeichnungspflichten für Arbeitgebende
Ein wichtiger Bestandteil des Mindestlohngesetzes ist die umfassende Dokumentationspflicht für Arbeitgebende. Sie ist besonders wichtig für Minijobs, kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse und Beschäftigte in bestimmten Branchen mit erhöhtem Risiko für Lohnunterschreitungen, zum Beispiel im Baugewerbe, in der Fleischwirtschaft, im Gaststättengewerbe oder im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Arbeitgebende müssen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzeichnen oder aufzeichnen lassen. Die Dokumentationen sind spätestens sieben Tage nach der jeweiligen Arbeitsleistung beim Arbeitgebenden zu hinterlegen. Die Dokumentationen sind für mindestens zwei Jahre – besser vier Jahre – aufzubewahren.
Mindestlohn 2025: Bußgelder bei Verstößen
Die Pflicht zur Aufzeichnung soll die Kontrolle der Einhaltung des Mindestlohns durch den Zoll erleichtern. Arbeitgebende, die diese Vorschriften nicht einhalten, riskieren hohe Bußgelder, die bis zu 30.000 Euro betragen können. Ein Bußgeld von über 2.500 Euro kann zudem zum Ausschluss von öffentlichen Aufträgen führen. Auch Verstöße gegen den Mindestlohn sind Ordnungswidrigkeiten und streng sanktioniert. Arbeitgeber*innen, die den Mindestlohn nicht einhalten, drohen Bußgelder von bis zu 500.000 Euro.
Arbeitgebende müssen genau prüfen
Die Erhöhung des Mindestlohns bedeutet für Arbeitgebende, dass sie prüfen müssen, ob bei ihren Minijobber*innen und Geringverdiener*innen der gesetzliche Mindestlohn von 12,82 Euro eingehalten ist. Dazu sollten sie die bestehenden Arbeitsverträge prüfen lassen. Denn Fehler können schnell zu Nachforderungen von Sozialversicherungsbeiträgen und Bußgeldern führen.
Der Autor Andreas Islinger ist Rentenberater und Steuerberater bei Ecovis in München.
Gleiches Recht für alle
Obwohl es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz bereits lange gibt, wissen die wenigsten, was es damit alles auf sich hat. Und das kann sehr teuer werden. Was Sie als Arbeitgeber über das Gesetz wissen sollten.
Während Regelungen für Diskriminierungsverbote früher verstreut in verschiedenen Vorschriften und Gesetzen zu finden waren, hat das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) eine einheitliche gesetzliche Grundlage geschaffen. Darin ist sowohl der Anspruch auf Entschädigung als auch der auf Schadensersatz erstmals klar geregelt. Zur Anwendung kommt das Gesetz immer dann, wenn eine Benachteiligung oder Diskriminierung von Bewerbern, Mitarbeitern oder auch von Kunden vorliegt bzw. vermutet wird. Relevant wird das AGG für Gründer spätestens dann, wenn der erste (freie) Mitarbeiter eingestellt werden soll und eine Stellenausschreibung zu formulieren ist.
Was untersagt das AGG?
Per Gesetz verboten sind nicht nur belästigende Verhaltensweisen wie Mobbing oder sexuelle Belästigung, sondern auch jede Art von unmittelbarer und mittelbarer Benachteiligung. Unter einer unmittelbaren Benachteiligung ist zu verstehen, dass eine Person aufgrund der im AGG genannten Kriterien schlechter behandelt wird als eine andere und daher beispielsweise nicht eingestellt wird. Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn Vorschriften oder Verfahren im Unternehmen eine Person ohne sachliche Rechtfertigung benachteiligen. Was heißt das?
AGG-sichere Stellenanzeigen
Wer in einer Stellenanzeige „einen persönlichen Assistenten“ oder eine „junge Aushilfe“ sucht, begibt sich bereits auf dünnes Eis. Denn diese geschlechts- oder altersbezogenen Formulierungen sind unzulässig. Ernsthaft an der Stelle interessierte Bewerber können die Stellenausschreibung als Indiz für eine Diskriminierung sehen und innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Nichteinstellung eine Entschädigung verlangen. Diese liegt im Ermessen des Arbeitsgerichts und ist nur für den Fall auf bis zu drei Monatsgehälter gedeckelt, dass der Bewerber auch bei einer diskriminierungsfreien Auswahl nicht eingestellt worden wäre. Zwar lässt sich aus einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot kein Beschäftigungsverhältnis begründen, dennoch lohnt sich die bewusste Formulierung von geschlechtsneutralen Stellenausschreibungen. Geschlechtsneutral muss dabei nicht nur die Überschrift, sondern auch das Kleingedruckte formuliert sein.
Auf Nummer Sicher gehen Sie, wenn Sie die im Job zu erledigenden Tätigkeiten in den Mittelpunkt stellen und keine detaillierten Anforderungen formulieren. Gefährlich können selbst Formulierungen wie „stresserprobt“ oder „belastbar“ sein, da diese möglicherweise behinderte Bewerber ausschließen.
Letzter Wille zu Passwörtern und Co.
Viele Firmeninhaber regeln zwar ihren Nachlass, doch an ihr digitales Erbe denken die wenigsten. Dies birgt hohe Risiken für persönliche und unternehmerische Interessen. Welche Vorkehrungen Entscheider treffen sollten.
Die meisten Menschen verstehen ihren Nachlass rein materiell: Immobilien, Bankvermögen oder Unternehmensanteile. Sie übersehen dabei digitale Nachlasswerte wie den Zugriff auf Mail-Accounts, den Firmen-Server, Daten in einer Cloud, Inhalte sozialer Netzwerke oder Online-Konten. Ohne Zugangsrechte sind Unternehmen von vielen Informationen abgenabelt, die elementar für den Firmenerfolg sind. Es drohen weitreichende Folgen für den Betrieb, die Mitarbeiter und die Unternehmerfamilie.
Gerade Firmeninhaber sollten Vorsorge für ihren digitalen Nachlass treffen. Nur so können sie den Fortbestand des Unternehmens auch weitgehend unabhängig von ihrer Person sichern. Schließlich tragen Chefs nicht nur einen Großteil des Firmenwissens in sich, sondern besitzen meist exklusive Zugriffsrechte, Passwörter und PINs. Das digitale Erbe lässt sich per Unternehmertestament, Erbvertrag oder Vollmacht regeln. In vielen Fällen ist auch eine Kombination sinnvoll.
Das digitale Erbe per Testament regeln
Firmeninhaber sollten ihr Testament oder ihren Erbvertrag in puncto digitales Erbe auf den Prüfstand stellen und gezielt ergänzen. Gerade bei Kleinunternehmen verläuft die Grenze zwischen privaten und unternehmerischen Interessen oft fließend. Ohne klare Regelungen drohen Interessenskonflikte. Erben treten als Rechtsnachfolger des Erblassers automatisch auch in dessen Providerverträge ein und übernehmen alle Rechte und Pflichten. Damit verfügen sie grundsätzlich auch über das Zugangsrecht zu allen digitalen Daten. Sind die erforderlichen Passwörter nicht bekannt, können sie diese zurücksetzen lassen. Hierzu zählen womöglich auch der Zugang zu geschäftlich genutzten Mail-Accounts, Business-Netzwerken wie Xing oder Domain-Verträgen.
Firmeninhaber können ihren Erben auftragen, wie sie mit dem digitalen Nachlass verfahren sollen. Sie können beispielsweise für bestimmte Daten eine alleinige Nutzung für betriebliche Zwecke oder eine unverzügliche Löschung festschreiben. Eine angeordnete Testamentsvollstreckung stellt sicher, dass diese Verfügungen auch umgesetzt werden.
Allerdings kann es bei der Rechtsnachfolge zu Problemen kommen. Viele Provider prüfen zunächst, ob der Anspruch auf Datenzugang nicht mit dem Datenschutz, Telekommunikationsrecht oder Persönlichkeitsrecht kollidiert. Einige verweigern Erben jeglichen Datenzugang unter Hinweis auf ihre AGB, andere löschen bei Tod eines Kunden sogar alle Daten, wie etwa Yahoo.
Problematisch ist die Rechtsnachfolge für digitale Daten vor allem dann, wenn nicht die nächsten Angehörigen die Erben sind. In diesen Fällen wirkt der Persönlichkeitsschutz des Erblassers über den Tod hinaus. Noch gibt es hierzu keine gesicherte Rechtsprechung. Der Persönlichkeitsschutz umfasst unter Umständen auch E-Mails und Inhalte in sozialen Medien. Die Folge: Erben dürfen diese Inhalte nicht oder nur eingeschränkt nutzen.
In jedem Fall ist die Umsetzung der erbrechtlichen Verfügungen zeitraubend. Nicht selten können die Ausstellung des Erbscheins und die Kommunikation mit zumeist ausländischen Providern Monate in Anspruch nehmen. Es drohen zudem überlange Wartezeiten oder auch Pattsituationen, weil sich Erben uneins sind. Daher ist es ratsam, nicht allein auf testamentarische Verfügungen zu setzen, insbesondere wenn auch unternehmerische Interessen im Spiel sind.
Vollmacht für den Fall der Fälle
Eine schnelle und gezielte Nutzung des digitalen Nachlasses ermöglicht eine sogenannte postmortale Vollmacht. Hierbei bevollmächtigt der Firmeninhaber eine Vertrauensperson im Todesfall im Rahmen der bestehenden Providerverträge über den digitalen Nachlass zu verfügen. Der Bevollmächtigte muss nicht zu den Erben zählen, ihre Interessen aber berücksichtigen. So ist der Fortgang aller unternehmerischen Aktivitäten gewährleistet, ohne Zugangsbeschränkungen in Kauf nehmen zu müssen (siehe Infokasten „Für den Ernstfall vorsorgen“). Gleichzeitig bleiben aber alle erbrechtlichen Verfügungen gewahrt.
Von zentraler Bedeutung für mittelständische Unternehmen ist etwa der jederzeitige Zugang zum Server, zur Cloud oder zum Online-Banking. Gleiches gilt für wichtige E-Mail-Accounts, die oft Chefsache sind. Hier laufen viele Anfragen und Angebote auf. Landen Mails im verwaisten Mail-Postfach, bleiben viele Geschäftschancen ungenutzt.
Die Verantwortung des Firmeninhabers geht weit über seinen Tod hinaus. Wer das digitale Erbe mit Weitblick regelt, wahrt nicht nur den unternehmerischen Erfolg, sondern beugt auch privaten Streitigkeiten vor. Schnell werden digitale Nachlässe wie E-Mails, Fotos oder der Facebook-Account zum Zankapfel. Vorausschauende Verfügungen sorgen für klare Verhältnisse unter den Erben und sichern den Fortbestand des Unternehmens.
So gilt es für den Ernstfall vorzusorgen
Eine postmortale Vollmacht stellt im Todesfall den Zugriff auf wichtige digitale Daten sicher. So gehen Firmeninhaber am besten vor:
- Accounts auflisten: Mehrere Dutzend Accounts sind keine Seltenheit. Ratsam ist das Anfertigen einer vollständigen Liste, und zwar jeweils mit Benutzername und Kennwort. So gewinnen Vertraute einen schnellen Überblick und können gezielt tätig werden.
- Liste deponieren: Die Liste der Accounts sollte passwortgeschützt auf einem USB-Stick an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Hierfür kommen ein Banksafe oder Tresor in Frage. Man sollte die Auflistung regelmäßig kontrollieren und auf den neusten Stand bringen
- Vertrauensperson bestimmen: Firmeninhaber sollten eine Vertrauensperson als digitalen Nachlassverwalter einsetzen. Hierzu informieren sie die Person vorab über ihre Pläne und den Aufbewahrungsort der Liste
- Vollmacht erteilen: Durch eine postmortale Vollmacht lässt sich der Umgang mit digitalen Daten detailliert regeln. Hierzu sollten Firmeninhaber vorab fachlichen Rat einholen. Anschließend übergeben sie die Vollmacht an ihre Vertrauensperson.
So nutzen Sie Servicemails rechtssicher für Ihre Werbung
Bestellbestätigungen oder Versandbenachrichtigungen per E-Mail können Ihnen als wertvolle Möglichkeit zur Werbung dienen. Wichtig ist hierbei zu wissen, dass diese Werbung nicht immer zulässig ist und es somit schneller als gedacht zu Wettbewerbsverstößen und juristischen Nachspielen kommen kann.
Marketer nutzen Transaktionsmails, um Kunden ergänzend über Produkte und Angebote zu informieren (Cross-Selling). Hintergrund: Nach einem Kauf sind die Kunden in besonderem Maße positiv gestimmt und auch für weiterführende Produkte offen. Gleiches gilt für hochwertigere und teurere Produkte (Up-Selling). Auch diese können in einer Transaktionsmail beworben und Kunden gezielt stimuliert werden. Rechtlich stellt sich aber die Frage, ob solche E-Mails überhaupt Werbung enthalten dürfen, denn Kunden müssen in den Erhalt von Werbe-E-Mails einwilligen.
Durch das Erfordernis der Einwilligung soll sichergestellt werden, dass E-Mail-Adressaten nicht aufgrund massenhafter und unerwünschter Werbung unzumutbar belästigt würden (Ausuferungsgefahr). Schließlich müssen sie sich mit jeder E-Mail befassen – selbst wenn es nur ums Löschen geht. Für Transaktions- oder Servicemails gilt dies jedoch nicht. Der Grund: Eine unzumutbare Belästigung der Empfänger kann überhaupt nicht vorliegen, da sie sich – wie erwähnt – mit diesen E-Mails befassen müssen. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie Werbung enthalten oder nicht.
Sogenannte Transaktions- oder Systemmails kommen vor allem im E-Commerce zum Einsatz. Dabei handelt es sich um automatisierte E-Mails, deren Versand durch die Kunden im Rahmen einer Transaktion angestoßen wird. Meist geht es dabei um Bestellbestätigungen, Auftragsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen oder Rechnungen. Für das Online-Marketing sind solche Servicemails deshalb interessant, weil der Kunde sich mit ihnen beschäftigen muss. Am Beispiel einer Rechnung wird das deutlich. Servicemails sind deshalb auch durch eine hohe Öffnungsrate gekennzeichnet. Experten sprechen von bis zu 80 Prozent.
Arbeitszeiten – so klappt es mit dem Gesetz
In Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten. Wie schaffen es junge Unternehmer, rechtliche Probleme damit zu vermeiden?
Früh anfangen und bis spät in die Nacht arbeiten, das Wochenende durch. Wer ein Unternehmen gründet, klotzt erst einmal ran. Überdurchschnittliche Motivation und Einsatz erwarten Gründer meist auch von ihren Mitarbeitern. Doch in Deutschland herrschen strenge Regelungen zu Arbeitszeiten, die Arbeitnehmer schützen sollen. Wie schaffen junge Unternehmer es, rechtliche Probleme zu vermeiden? Und welche Möglichkeiten haben sie zur freien Gestaltung bei den Arbeitszeiten?
Welche Regeln gelten für Gründer?
In Deutschland unterliegen Mitarbeiterverhältnisse einer starken Reglementierung, für die größere Unternehmen eigens Juristen einstellen. Sicher nicht der erste Schritt in jungen Unternehmen, doch gelten für sie in Bezug auf das Arbeitsrecht genau die gleichen Gesetze wie für DAX-Konzerne. Ausnahmeregelungen gibt es nicht. Unabhängig von der Unternehmensgröße müssen Arbeitgeber bestimmte Mindestanforderungen einhalten:
- Mitarbeiter dürfen die tägliche (8h) und wöchentliche Höchstarbeitszeit (48h) nicht überschreiten. Zeitweise bis zu 10h täglich und 60 Stunden wöchentlich ist ohne besondere Begründung möglich, wenn die Arbeitszeit in sechs Monaten durchschnittlich höchstens acht Stunden pro Tag beträgt. Solche phasenweisen Anstrengungen durch hohe tägliche Arbeitszeiten müssen also zeitnah durch weniger Arbeit wieder ausgeglichen werden.
- Arbeitnehmer müssen Pausen und Ruhezeiten einhalten. Am Stück dürfen sie maximal sechs 6 Stunden arbeiten. Wer zwischen sechs und neun Stunden am Schreibtisch sitzt, muss mindestens 30 Minuten pausieren, bei über neun Stunden mindestens 45 Minuten. Und zwischen den Arbeitszeiten müssen mindestens ununterbrochen 11 Stunden liegen (mit Ausnahmen in einzelnen Branchen und bei Bereitschaft).
- Für Sonn- und Feiertage gilt ein Beschäftigungsverbot, ebenfalls mit branchenspezifischen Ausnahmen.
Für Gründer ist es ratsam, sich mit dem Wachsen der Firma frühzeitig über die Dos und Don'ts bei Arbeitszeiten zu informieren, denn es können spürbare Strafen drohen. Die gesetzliche Grundlage kann man zunächst im Arbeitszeitgesetz nachlesen. Vorsicht jedoch vor der eigenständigen Auslegung, das kann nach hinten losgehen. Die bessere Wahl, um sich einen Überblick zu verschaffen, sind zuverlässige Internetquellen aus Fachkreisen. Wer einen konkreten Fall klären will oder generell Lösungen für sein Unternehmen schaffen möchte, wendet sich am besten an einen Fachanwalt für Arbeitsrecht.
Die typischen Fallstricke
Für Jungunternehmer ist es nicht immer leicht, im Dickicht der Vorschriften den passenden Weg zu finden und angesichts der hohen eigenen Motivation für die Firma alle gesetzlichen Vorschriften zu befolgen.In der Praxis bekommen Gründer deshalb meist aus zwei Gründen Probleme:
1. Das Unternehmen versucht das Arbeitszeitgesetz zu umgehen, indem es Beschäftigte nicht als Arbeitnehmer einstuft, für die das Gesetz ausschließlich gilt. Das passiert häufig mit freien Mitarbeitern, die eigentlich normale Angestellte und somit scheinselbständig sind. Oder Mitarbeiter werden als leitende Angestellte ausgewiesen, weil für diese nicht alle Regelungen des Arbeitszeitgesetzes relevant sind. So entstehen auf einmal Teams, die ausschließlich aus leitenden Angestellten bestehen. Ob jemand jedoch in diese Kategorie fällt, entscheidet nicht der Arbeitgeber selbst durch die Vergabe einer Jobbezeichnung. Den Status bestimmen vielmehr Kriterien wie zum Beispiel die Weisungsgebundenheit des Mitarbeiters.
Gründer, die sich von diesem vermeintlichen Schlupfloch locken lassen, laufen Gefahr nachträglich Sozialabgaben und Steuern zahlen zu müssen. Und noch schlimmer: Der Beschäftigte könnte über seinen Arbeitnehmerstatus klagen.
2. Mitarbeiter machen zu viele Überstunden. Wer die Vorschriften zu den Arbeitszeiten in seiner Belegschaft missachtet, dem drohen Bußgelder, Nachzahlungen an den Arbeitnehmer und sogar Freiheitsstrafe.
Also Achtung, denn die Folgen sind ernst für Gründer! In der Regel haben junge Unternehmen keine finanziellen und zeitlichen Ressourcen für finanziellen Ahndungen oder kräftezehrende Gerichtsverfahren. Doch es gibt eine vollkommen legitime Möglichkeit, um nicht in die Falle zu tappen: Wer ganz legal Freelancer beschäftigt statt Mitarbeiter an sich zu binden, schafft sich viele Freiheiten vor allem in der Gründungsphase.
Homeoffice als Alternative?
Arbeiten von zuhause und nach individuellen Zeitvorstellungen, das ist längst keine Ausnahme mehr. In vielen Branchen ist Arbeiten im Homeoffice gut umsetzbar und sowohl für den Arbeitgeber als auch den Arbeitnehmer mit vielen Vorteilen verbunden. Doch auch hier gelten Vorschriften für den Arbeitsschutz, auch wenn die Einhaltung schwerer zu kontrollieren ist. Arbeitnehmer, die zum Beispiel am Nachmittag ihr Kind versorgen und dann abends bis spät arbeiten, laufen Gefahr, die Ruhezeiten nicht einzuhalten. Und die Verantwortung liegt auch hier beim Arbeitgeber. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter im Homeoffice beschäftigen, können sich aber absichern, indem sie
- eine Regelung zur Zeiterfassung finden,
- mit dem Mitarbeiter eine Vereinbarung über Arbeitsumfang und Ruhezeiten treffen und
- über feste Arbeitstage und Kernarbeitszeiten. Das erleichtert die Erreichbarkeit für Emails und Anrufe. Denn: Arbeit zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gilt per Gesetz als Nachtarbeit.
Flexiblere Arbeitszeitmodelle – sind Anpassungen des Gesetzes in Sicht?
Mancher mag sich fragen, wie das deutsche Arbeitszeitgesetz eigentlich mit dem Geist in Start-up-Unternehmen zusammenzubringen ist. Tatsächlich stammt es aus dem Jahr 1994, und seither hat sich die Arbeitswelt stark verändert. Eine Modernisierung des Arbeitszeitgesetzes tut daher auch aus anwaltlicher Sicht dringend Not, um es ins digitale Zeitalter zu überführen und an die Bedürfnisse von New Work und einen veränderten Arbeitsmarkt anzupassen. Im vergangenen Jahr gab es dazu Anregungen von Parteien, doch im Bundestagsausschuss kam es dann zu keiner Einigung.
Beispielsweise diskutierten die Politiker, die deutschen Regelungen an die Europäische Arbeitszeitrichtlinien anzugleichen. Konkrete Ideen sind, statt tägliche Höchstarbeitsstunden wöchentliche Grenzen bei der Arbeitszeit einzuführen. Alternativ könnten die täglichen Höchstgrenzen erhöht werden, ohne gleichzeitig die wöchentliche Arbeitszeit hochzuschrauben. Beide Ansätze verhindern die dauerhafte Überlastung von Mitarbeitern. Und sie erhöhen die Flexibilität für Betriebe, zum Beispiel wenn es in Phasen kurzzeitig viel zu tun gibt. Noch scheinen nicht alle Bundestagsfraktionen bereit für den Wandel zu sein. Klar ist aber: Früher oder später wird es Änderung beim Arbeitszeitgesetz geben müssen, um dem digitalen Zeitalter zu gerecht zu werden.
Weniger Stunden, mehr Produktivität – möglich für Gründer?
Die engen Grenzen des Arbeitszeitgesetzes werden von Gründern nicht selten als hinderlich empfunden. Doch es gibt auch ganz andere Ansätze, die dem Pioniergeist von jungen Unternehmen entgegen kommen könnten. Beispiel Sechsstundentag: Menschen, die weniger arbeiten, sind deutlich produktiver und gleichzeitig weniger anfällig für Fehler und Krankheiten. Das zeigen zahlreiche Versuche mit einem Sechsstundentag in Unternehmen und Einrichtungen in Schweden. Die zunächst höheren Kosten zahlten sich dabei schnell durch die gesteigerte Produktivität und zufriedenere Mitarbeiter aus. Ist das vereinbar mit dem deutschen Recht? Ja, denn es gibt keine gesetzliche Mindestarbeitszeitdauer, geregelt ist nur die Höchstdauer. Arbeitgeber sind also frei, ob sie ihre Angestellten 8 Stunden oder eben weniger arbeiten lassen.
Fazit
An der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes führt auch für Gründer kein Weg vorbei. Vermeintliche Hintertüren des Gesetzes auszunutzen, birgt erhebliche Gefahren mit empfindlichen Folgen für Unternehmen und Verantwortliche. Es gibt jedoch auch innerhalb der Grenzen legitime Möglichkeiten, die Arbeitszeit für Mitarbeiter flexibler zu gestalten und ihre Motivation und den Enthusiasmus für das Unternehmen zu unterstützen. Und nicht zuletzt besteht Aussicht darauf, dass das Arbeitszeitgesetz in absehbarer Zukunft auch den Gegebenheiten des digitalen Zeitalters angepasst wird.
Die Autorin Franziska Hasselbach ist Rechtsanwältin bei der auf Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei Hasselbach in Köln, Frankfurt und Bonn.
Gewerberaum mieten
Der Mietvertrag über Gewerberaum weicht von den Regelungen des Wohnraummietvertrages ab. Hauptunterschied: Dem Gewerberaummietvertrag sind grundsätzlich keine gesetzlichen Schranken gesetzt. Daher sind vielfältige Ausgestaltungen im Gewerbemietrecht möglich, sofern die Vertragsparteien darüber Einigkeit erzielen. Es gilt umso mehr der stets aktuelle Grundsatz nach Friedrich Schiller: "Drum prüfe wer sich (ewig) bindet."
Denn der Gründer verliert als Gewerbetreibender oder auch als Freiberufler den Schutz des Verbraucherrechts, wenn er im Sinne seines Unternehmens handelt. Andererseits eröffnen sich jedoch für beide Vertragsparteien im Gewerbemietrecht flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten. Über Inhalt und Abschluss des Mietvertrages entscheidet im Fall der Gewerberaummiete damit in gleichem Maße die Sympathie, die Marktsituation wie auch das Verhandlungsgeschick der Vertragspartner bzw. deren jeweiliger Interessenvertreter.
Definition: Wohnraum und/oder Gewerberaum?
Die Abgrenzung, ob es sich um einen Mietvertrag über Wohnraum oder Gewerberaum handelt, kann schwierig werden, wenn die vermieteten Räume zugleich zu Wohn- und Betriebszwecken genutzt werden sollen. Gerade bei Gründern und insbesondere bei Freiberuflern fällt die klare Abgrenzung des Gewerbemietrechts zum privaten Mietrecht oft nicht leicht.
Typische Beispiele im freiberuflichen Bereich sind der Arzt oder Steuerberater, der vorn in den Räumlichkeiten seine Praxis bzw. sein Büro einrichtet und den hinteren Teil der Räume als privaten Wohnraum nutzt. In erster Linie kommt es darauf an, was nach dem übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien – wie er im Vertrag festgelegt wird – den Schwerpunkt des Vertrages bilden soll. Soll also ein Wohnraum- oder Gewerberaummietverhältnis begründet werden?
Zweckentfremdung von Wohnraum kann teuer werden.
Die Fälle sind jedoch nicht immer so klar: wie im Beispiel eines Online-Händlers, der aus seiner Wohnung kurzerhand ein Warenlager macht. Besonders im letztgenannten Beispiel droht allerdings die außerordentliche fristlose Kündigung, da die Aufnahme eines Gewerbebetriebes in einem Wohnraum ohne die Zustimmung des Vermieters die Rechte des Vermieters erheblich verletzt. Man spricht in diesem Fall von einer Zweckentfremdung durch den Mieter.
Zudem drohen ordnungsrechtliche Sanktionen: In Zeiten immer knapper werdenden Wohnraums haben die Städte und Kommunen ihre Bußgelder teilweise drastisch erhöht. Bis zu 100.000 Euro sind beispielsweise nach dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz des Landes Berlin für diese Ordnungswidrigkeit durch den Verursacher zu entrichten. Wird dem Vermieter eine Zweckentfremdung seiner Mietsache bekannt, wird er diese schnellstens unterbinden wollen, um seine Haftung zu vermeiden, und da ist die außerordentliche fristlose Kündigung meist das Mittel der Wahl.
Doch so weit muss es nicht kommen: Wer die eventuell negative Reaktion seines Vermieters nicht scheut, kann auf Verständnis hoffen und diesen fragen. Lässt sich der Vermieter ein, sollte das gemeinsam gefundene Verständnis schriftlich fixiert werden. Zur rechtssicheren Formulierung sollte ein Anwalt hinzugezogen werden.
Vertragslaufzeit im Gewerbemietrecht: endlos?
Mietverträge über Gewerberaum werden häufig auf Zeit geschlossen (3, 5 oder mehr Jahre). Nach der Konzeption des Gesetzgebers ist eine Beendigung vor Ablauf der vorbestimmten Zeit nur schwer möglich. Bei einem auf unbestimmte Zeit geschlossenen Gewerberaummietvertrag kann jedoch zum Ende eines jeden Quartals ohne Angabe eines Grundes unter Einhaltung der Kündigungsfrist (regelmäßig 6 Monate) gekündigt werden.
Die Vor- und Nachteile beider Regelungsmöglichkeiten sollten frühzeitig abgewogen werden. Gemeinsam mit einem Berater können die verschiedenen Konzepte zu bedarfsgerechten, flexiblen Regelungen besprochen werden. Soll der Mietvertrag ein vorbestimmtes Ende haben, so ist die Formvorschrift des § 550 BGB zu berücksichtigen. Diese Vorschrift ordnet für Zeitmietverträge zwingend die Schriftform an. Wird bei Vertragsabschluss hiergegen verstoßen, so gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Wer trägt Rechte und Pflichten beim Gewerbemietvertrag?
Im Hinblick auf die gesetzlichen Mängelrechte können diese durch beide Vertragspartner einvernehmlich ausgeschlossen werden. Mit den sogenannten "Dach-und-Fach-Klauseln" kann es sogar noch einen Schritt weiter gehen: Dem Mieter kann vertraglich die Pflicht auferlegt werden, für die Instandsetzung und Instandhaltung des Gewerberaumes verantwortlich zu sein. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, macht sich der Mieter gegenüber dem Vermieter schadensersatzpflichtig. Dies hat die Rechtsprechung dann als zulässig angesehen, wenn dem Mieter im Gegenzug weitreichende Rechte ähnlich eines Eigentümers eingeräumt werden.
Wenn der Mieter durch den Vermieter also z.B. das Recht eingeräumt bekommt, erhebliche bauliche Veränderungen nach seinen eigenen, für den Gewerbebetrieb vorteilhaften Wünschen vorzunehmen, dann kann er grundsätzlich auch dazu verpflichtet werden, diese wirtschaftlich zu unterhalten. Gleichzeitig ist es möglich, von der gesetzlichen Verpflichtung des Mieters, die von ihm vorgenommenen baulichen Maßnahmen bei Beendigung des Mietverhältnisses wieder auszubauen, durch Vertrag abzuweichen.
Achtung: Mietrückstand!
Anders als im Wohnraummietrecht genießt der Mieter von Gewerberaum keinen besonderen Schutz, da dieser unter sozialen Gesichtspunkten nicht geboten ist. Dies hat letztendlich auch zur Folge, dass dem Mieter grundsätzlich auch schon bei Rückstand von weniger als einer Monatsmiete gekündigt werden kann.
Dies geht jedenfalls nach der Rechtsprechung dann, wenn besondere Umstände des Einzelfalles hinzukommen, die die Interessen des Vermieters gegenüber jenen des Mieters überwiegen lassen. Denkbar sind nach dem Bundesgerichtshof eine geringe Kreditwürdigkeit des Mieters oder eine kritische finanzielle Situation des Vermieters, die durch den Mietrückstand herbeigeführt wurde oder sie verschlimmert hat.
Abschließend lässt sich festhalten, dass Unternehmenserfolg neben wirtschaftlichem Sachverstand oft auch solide Kenntnisse der aktuellen Rechtslage erfordert. Und das fängt spätestens bei der Gestaltung des Gewerbemietvertrages an.
Der Autor, Mag. iur. Dennis Kallabis, ist als Jurist in einer Wirtschaftskanzlei in Düsseldorf tätig. Im Schwerpunkt hat er deutsches und europäisches Unternehmensrecht studiert.
Schutz vor Piraten und Raubrittern
Wer sich gegen Nachahmer schützen will, sollte überlegen, sein Produkt als Marke zu registrieren. Lesen Sie, was man bei der Markenanmeldung zu beachten hat.
Das hätte er wohl nicht geglaubt. Im Jahr 1886 erfand John Pemberton ein zuckerhaltiges Wohlfühl-Getränk gegen Depression. Pemberton verfeinerte es mit Wein, Sodawasser und Stoffen der Koka-Pflanze. Ein unvergleichlicher Aufstieg begann. Unter dem Namen Coca-Cola kennt heute fast jeder die braune Brause. Es ist die bekannteste Marke weltweit. Mit einem geschätzten Wert von 67 Milliarden US-Dollar verweist Coca-Cola Unternehmen wie Microsoft, Daimler-Chrysler oder Google auf die Plätze. Großunternehmen wie Coca-Cola, aber ebenso auch viele Existenzgründer und Mittelständler leben von der Vermarktung ihrer Ideen und Erfindungen. Damit erobern sie Märkte und erzielen Gewinne.
Der Staat hilft dabei, indem er kreative und einmalige Kennzeichen, Produkte und Verfahren schützt. Zum Beispiel mit Hilfe eines Patents oder einer Marke. Der Inhaber einer Marke erhält das exklusive Recht, ein bestimmtes Zeichen im Geschäftsverkehr zu nutzen. Wie zum Beispiel Coca-Cola. Bereits im Jahr 1887 beantragte dessen Erfinder John Pemberton in Amerika den Schutz des Schriftzuges. In Deutschland wurde Coca-Cola im Jahr 1926 als Marke angemeldet. Heute verdient der gleichnamige Getränkekonzern Milliarden. Nachahmer und Raubritter haben keine Chance. Im Folgenden zeigen wir anhand von Beispielen, was eine Marke ist, wie ein Kennzeichen geschützt werden kann und was dabei zu beachten ist.
Beispiel Möbel-Marke
Als Werbekauffrau weiß Laura Faltz, was ankommt. Die 30-Jährige ist Geschäftsführerin der ecomoebel GmbH. Das Unternehmen vertreibt individuell gestaltete Möbel, die ganz pder teilweise aus Altmöbeln produziert werden. Die alten Stücke werden sogar auf Schadstoffe getestet, bevor sie nach Wunsch „aufgemöbelt“ werden.
Jeder Kunde erhält sein ganz persönliches Möbel, das gesundheitlich unbedenklich ist. Bestätigt wird das mit dem ecomoebel-Zertifikat. Aus Betten werden Bänke, aus Fenstern Vitrinen, oder es wird Schränken einfach ein neuer Anstrich verpasst. Seit August 2003 ist ecomoebel als Marke registriert und geschützt. Nur die Dortmunder Firma und die mit Lizenzen ausgestatteten Partner dürfen das Möbel-Zeichen benutzen. Der Wert der Firma ist damit bis heute weiter gestiegen.
Fair, professionell und sicher verkaufen
Welche Möglichkeiten gibt es, sich als Verkäufer von Waren durch Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) klug gegen allzu viele Gewährleistungs- und Haftungswünsche der Kunden abzusichern? Und was sollte in den AGB auf jeden Fall geregelt sein?
Diese und viele Fragen mehr stellen sich allen Unternehmern, die Waren an ihre Endkunden verkaufen. Der Verkauf der Ware kann auf der Grundlage einer sog. Mindesteinigung über Ware und Preis mündlich erfolgen.
Dann gelten die gesetzlichen Regelungen. Sinnvoll ist es jedoch, die Spielräume, die der Gesetzgeber und die Rechtsprechung zum Vorteil des Verkäufers vorsehen, über Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zum eigenen Vorteil zu nutzen.
Einbeziehung von AGB
Unter welchen Umständen werden AGB wirksam Bestandteile des Verkaufsvertrags? Dies richtet sich in erster Linie danach, ob der Kunde ein Verbraucher (entsprechend § 13 BGB) oder ein Unternehmer (im Sinne von § 14 BGB) ist. Gegenüber Verbrauchern gilt: Die AGB des Verkäufers werden nur Bestandteil des Vertrags zwischen den Vertragsparteien, wenn der Verkäufer vor Vertragsschluss ausdrücklich darauf hinweist oder – wenn dieser Hinweis nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist – es durch einen deutlichen sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses kundtut.
Außerdem muss dem (gegebenenfalls auch körperlich behinderten) Kunden in zumutbarer Weise die Möglichkeit verschafft werden, vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen. Dritte Voraussetzung ist, dass der Kunde sich mit den AGB einverstanden erklärt. Für AGB zwischen zwei Unternehmern gilt dies jedoch nicht. Es bedarf hier lediglich einer sog. rechtsgeschäftlichen Einbeziehung, d.h. es gelten die üblichen Voraussetzungen für das Zustandekommen von Verträgen. Zur wirksamen Einbeziehung reicht hier jede auch nur stillschweigende Willensübereinstimmung.
Dies geschieht durch Übersendung der AGB und das stillschweigende Einverständnis des unternehmerischen Kunden, indem dieser der Geltung der AGB nicht widerspricht. Aus Beweissicherheitsgründen empfiehlt sich jedoch auch bei unternehmerischen Kunden, ein ausdrückliches Einverständnis durch Unterschrift oder „Häkchen setzen“ bei einem Online-Geschäft einzuholen. Ferner gilt: Individuelle Absprachen mit dem Kunden zum Vertrag haben immer Vorrang vor der Geltung von AGB.
Mobilitätsbudget – das musst du wissen
Eine Wochenkarte für Bus und Bahn, eine kurze Fahrt mit dem E-Roller oder doch lieber das Car-Sharing-Angebot bei schlechtem Wetter? Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden dafür ein Mobilitätsbudget zur Verfügung stellen, sollen bald eine neue Möglichkeit der Pauschalbesteuerung nutzen können. Welche Voraussetzungen dazu erfüllt sein müssen, liest du hier.

Was ist das Mobilitätsbudget?
Das Mobilitätsbudget ist ein Angebot von Unternehmen für ihre Mitarbeitenden, alternative Verkehrsmitteln für privat veranlasste Reisen zu nutzen. Das Unternehmen stellt dafür einen bestimmten Betrag zur Verfügung, die Mitarbeitenden können die Verkehrsangebote je nach aktuellen Bedürfnissen, Verfügbarkeit und persönlichen Präferenzen flexibel miteinander kombinieren. Das Mobilitätsbudget ist damit eine gute Alternative zum privaten Auto oder Dienstwagen.
Was ist jetzt neu?
Im Regierungsentwurf für ein Jahressteuergesetz 2024 wurden die Rahmenbedingungen für ein Mobilitätsbudget definiert und steuerliche Anreize für dessen Nutzung geschaffen. So sollen Unternehmen die Möglichkeit erhalten, den damit verbundenen geldwerten Vorteil für Arbeitnehmende pauschal mit 25 Prozent zu versteuern. Die Regelungen zur Dienstwagenbesteuerung sollen damit nicht verändert werden.
Welche Verkehrsmittel können genutzt werden?
Unternehmen können die Angebotswahl in ihrem Mobilitätsangebot selbst bestimmen. Grundsätzlich können neben ebenfalls steuerlich geförderten Jobtickets auch Budgets für die gelegentliche Inanspruchnahme von Sharing-Angeboten wie E-Roller, Leihräder oder Carsharing-Autos, enthalten sein. Auch Einzelfahrkarten, Zeitkarten und Ermäßigungskarten für den Bus- und Bahnverkehr, also etwa der monatliche Anteil einer BahnCard, können Teil des Mobilitätsbudgets sein.
Was fällt nicht unter das Mobilitätsbudget?
Die dauerhafte und nicht nur gelegentlichen Nutzung von Pkw ist ausgeschlossen. Auf Dauer ausgelegte Mietwagen-, Leasing- oder Abo-Modelle fallen also nicht unter das Mobilitätsbudget. Gleiches gilt für Luftfahrzeuge, Privatwagen der Mitarbeitenden und dauerhaft auch zur privaten Nutzung überlassene Dienstwagen. Wird für die Arbeitnehmenden bereits eine Pauschalbesteuerung für die Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte vorgenommen, kann die Pauschalbesteuerung für ein Mobilitätsbudget nicht dafür in Anspruch genommen werden.
Wer muss das Mobilitätsbudget versteuern?
Grundsätzlich müssen die Mitarbeitenden einen solchen geldwerten Vorteil versteuern. Die Betriebe hingegen müssen entsprechende Sozialversicherungsbeiträge abführen. Werden die Pläne der Regierung umgesetzt und entschließen sich Unternehmen dann das Mobilitätsbudget künftig selbst pauschal mit 25 Prozent zu versteuern, ist dieses beitragsfrei.
Was sind die Voraussetzungen für eine Pauschalbesteuerung?
Die pauschale Versteuerung ist nur zulässig, wenn Betriebe das Mobilitätsbudget zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewähren. Zudem ist die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung auf einen Höchstbetrag von 2.400 Euro im Kalenderjahr begrenzt und kann nicht für bereits pauschal versteuerte Sachbezüge oder Zuschüsse genutzt werden. Die Regelungen sind also nur alternativ anwendbar.
Tipp: Was solltest du jetzt tun?
- Behalte die geplanten Steuerbegünstigungen im Blick!
- Prüfe, ob deine Belegschaft Interesse an einem Mobilitätsbudget als Benefit hat.
- Sprich mit deinem/deiner Steuerberater*in, um zu klären, welche Vor- und Nachteile eine Pauschbesteuerung für dein Unternehmen hat.
Der Autor Andreas Islinger – LL.M. Sozialrecht, Master of Arts in Taxation – ist Partner, Steuerberater und Leiter Rentenberatung und Lohnzentrum bei ECOVIS in München.
Genussrechte – eine bessere Alternative der Mitarbeitendenbeteiligung?
Seit der Verabschiedung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes wird eine bisher wenig beachtete Methode der Mitarbeitendenbeteiligung für Jungunternehmen interessant: Genussrechte. Warum es sich lohnt, diese Alternative genauer zu betrachten.
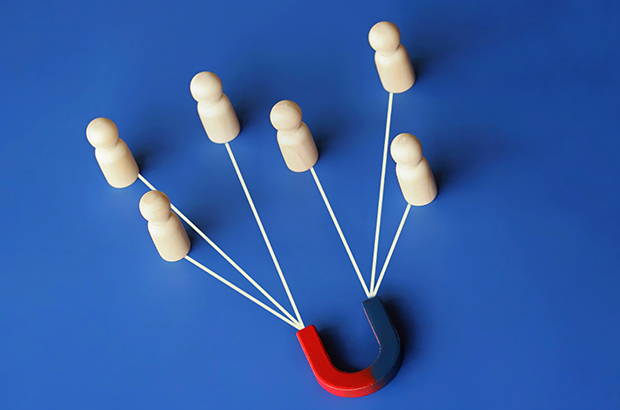
Beteiligungen für Mitarbeitende sind für junge Unternehmen essentiell, um auf dem Arbeitsmarkt um die besten Talente konkurrieren zu können. Arbeitnehmende müssen sich dank gut ausgestalteter Beteiligungsprogramme nicht mehr zwischen lukrativem Gehalt und innovativem Arbeitgebenden entscheiden – wovon insbesondere Start-ups profitieren.
Die technische Umsetzung eines Beteiligungsprogramms für Mitarbeitende kann auf unterschiedliche Arten und Weisen erfolgen. Aktuell sind in Deutschland Virtual Stock Option Plans (VSOPs) die gängige Form in der Praxis. Doch seit der Verabschiedung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes wird eine weitere – bisher wenig beachtete – Methode für Jungunternehmen interessant: Genussrechte. Doch welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede haben Genussrechte und VSOPs und warum lohnt es sich, diese Alternative genauer zu betrachten?
Virtuelle Beteiligung
Im deutschen Venture Capital-Markt werden Mitarbeitendenbeteiligungen typischerweise durch virtuelle Anteile abgebildet (VSOPs). Mitarbeiter*innen werden dabei wirtschaftlich so gestellt, als hätten sie eine echte (gesellschaftsrechtliche) Beteiligung am Unternehmen erhalten. Allerdings erhalten Beschäftigte bei VSOPs nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen das Unternehmen. Das bedeutet, dass sie im Falle eines Exits eine Sonderzahlung erhalten. Dabei ist der Strukturierungs- und Verwaltungsaufwand gering, da Unternehmen zur vertraglichen Beteiligung in der Regel auf standardisierte Verträge zurückgreifen können. Da keine Gesellschaftsanteile übertragen werden, gelangen keine Mitarbeiter*innen in das Cap Table und der Gang zum Notariat bleibt erspart. Nachteilig sind hingegen die steuerlichen Konsequenzen für die Mitarbeitenden: Bei entsprechender Ausgestaltung kommt es zwar zum Zeitpunkt der Ausgabe der virtuellen Beteiligung nicht zu einer Besteuerung der Mitarbeiter*innen. Allerdings unterliegt der Erlös dann bei Zahlung der normalen Lohnversteuerung mit einem Spitzensteuersatz von 45 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.
Genussrechte als Alternative?
Aufgrund aktueller steuerlicher Gesetzesänderungen rückt eine andere Gestaltungsmöglichkeit (wieder) in den Fokus: eigenkapitalähnliche Genussrechte. Im Folgenden werfen wir einen detaillierten Blick auf das Beteiligungsmodell.
Ausgestaltung
Genussrechte können inhaltlich annähernd genauso flexibel ausgestaltet werden wie VSOPs und stellen aus juristischer Sicht ebenfalls keine reale Beteiligung dar, sondern nur einen schuldrechtlichen Anspruch gegen das Unternehmen auf die Beteiligung am Gewinn. Aber auch eine Teilhabe am klassischen Exit-Erlös kann vereinbart werden. Bei der Ausgabe der Genussrechte leistet der Arbeitnehmende entweder eine Kapitaleinlage oder er erhält das Genussrecht schlicht unentgeltlich/verbilligt. Genussrechte können vom Arbeitgeber zu einem beliebigen Nennwert ausgegeben werden und eine Teilhabe am Gewinn und/ oder einem Liquidations-/Exiterlös mit oder ohne Verzinsung sowie mit oder ohne Verlustbeteiligung vermitteln.
Aufwand und praktische Umsetzung
Verträge für Genussrechte können für nahezu jede Gesellschaft maßgeschneidert gestaltet werden. Die Ausgabe obliegt – wie auch bei VSOPs – grundsätzlich der Geschäftsführung. In der Praxis sollte bei der Ausgabe ein entsprechender Gesellschafterbeschluss die Geschäftsführungsmaßnahme flankieren, um mögliche Streitigkeiten in Bezug auf die Wirksamkeit der Maßnahme vorzubeugen. Oftmals ist dies aufgrund von satzungsrechtlichen Zustimmungsvorbehalten ohnehin notwendig.
Der Beteiligungs- und Verwaltungsaufwand ist gering, da Unternehmen – wie bei den VSOPs – auf standardisierte Verträge zurückgreifen können. Formerfordernisse sind nicht gegeben und ein Gang zum Notar ist ebenfalls nicht notwendig.
Die für Mitarbeitendenbeteiligungen üblichen Vesting- bzw. Leaver-Regelungen unterscheiden sich bei den Genussrechten von den VSOPs kaum. Ein Augenmerk sollte bei einem Verfall aufgrund eines Leaver-Events auf die Rückübertragung von Genussrechten an den Arbeitgebenden gelegt werden. Dies sollte im Beteiligungsprogramm geregelt werden.
Steuerliche Vorteile der Genussrechte
Die Gewährung von Genussrechten (wie auch von echten Anteilen) führte bislang zum Zeitpunkt der Zuteilung zu einer lohnsteuerpflichtigen Sachzuwendung in Höhe des Marktwerts der gewährten Beteiligung, auch wenn noch kein Exit-Erlös erzielt wurde (Dry-Income-Problematik). Dafür profitieren echte Anteile sowie Genussrechte von einem linearen Steuertarif für Kapitaleinkünfte mit einem maximalen Steuersatz von 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer (§ 32d EStG).
Zukunftsfinanzierungsgesetz – Steuerliche Begünstigung von Genussrechten
Mit Inkrafttreten des Zukunftsfinanzierungsgesetz (ZuFinG) am 1. Januar 2024 hat der Gesetzgeber die Regelungen des § 19a EStG überarbeitet, um die genannte Dry-Income-Problematik zu mildern und um Beteiligungen für Mitarbeitende im Venture Capital-Bereich attraktiver zu machen. Die Vorschrift findet sowohl auf echte Anteile wie auch auf Genussrechte Anwendung.
Eine Dry-Income-Problematik besteht zwar bei VSOPs nicht, denn die Lohnsteuerpflicht fällt bei entsprechender Strukturierung bei VSOPs erst zum Zeitpunkt eines Exits in Höhe des individuellen (progressiven) Steuersatzes mit maximal 45 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer an. Der lineare Steuertarif für Kapitaleinkünfte (max. 25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) auf etwaige Wertzuwächse findet im Rahmen der VSOPs jedoch gerade keine Anwendung – im Gegensatz zu eigenkapitalähnlich ausgestalteten Genussrechten. Damit können Genussrechte bei entsprechender Ausgestaltung das „Beste aus beiden Welten“ vereinen: Einen Besteuerungsaufschub im Rahmen der Lohnsteuer für die unentgeltliche/verbilligte Einräumung des Genussrechts und einen niedrigen Steuertarif für Kapitaleinkünfte bei der Realisierung des Wertzuwachses beim Exit. Sollte der Wert des Genussrechts dann niedriger sein als zum Zeitpunkt der Gewährung, ist für die aufgeschobene Lohnsteuer dann auch nur der niedrigere Wert maßgebend.
Bedingungen für den Besteuerungsaufschub
Der Besteuerungsaufschub für etwaig anfallende Lohnsteuer im Zusammenhang mit der unentgeltlichen/verbilligten Einräumung wird unter bestimmten Voraussetzungen gewährt: Zu diesen zählt, dass eine qualifizierte Unternehmensbeteiligung vom Arbeitgebenden zusätzlich zum regulären Arbeitslohn unentgeltlich oder vergünstigt am Unternehmen eingeräumt wird (keine bloße Entgeltumwandlung), die Gründung des Unternehmens nicht länger als 20 Jahre zurückliegt und das Unternehmen zum Zeitpunkt der Einräumung des Genussrechts einen Jahresumsatz von EUR 100 Mio. oder eine Jahresbilanzsumme von EUR 86 Mio. nicht überschreitet sowie nicht mehr als 1.000 Mitarbeitende hat.
Dies stellt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal der eigenkapitalähnlichen Genussrechte gegenüber den VSOPs dar. Denn eine Beteiligung über virtuelle Anteile an einem Unternehmen gilt gerade nicht als Vermögensbeteiligung im Sinne des § 19a EstG i.V.m. dem 5. VermBG und profitiert somit – anders als die Genussrechte – nicht von der Begünstigung des § 19a EStG.
Der Besteuerungsaufschub endet nach § 19a EStG erst, wenn entweder das Genussrecht ganz oder teilweise entgeltlich oder unentgeltlich übertragen wird (Exit) oder das Dienstverhältnis beendet wird, spätestens aber nach 15 Jahre. Sofern das Unternehmen gegenüber dem Finanzamt unwiderruflich erklärt, im Exit-Fall für die Lohnsteuer zu haften, endet der Besteuerungsaufschub auch nicht beim Wechsel des Arbeitgebenden oder spätestens nach 15 Jahren, sondern tatsächlich erst beim Exit.
Fazit
Für die Einführung eines Beteiligungsprogramms für Mitarbeitende in Form von eigenkapitalähnlichen Genussrechten bzw. die Umstellung eines bestehenden virtuellen Mitarbeitendenbeteiligungsprogramms (VSOP) auf eigenkapitalähnliche Genussrechte sprechen steuerrechtliche Vorteile. Dazu zählt insbesondere der Besteuerungsaufschub für etwaig anfallende Lohnsteuer im Zusammenhang mit der unentgeltlichen/ verbilligten Einräumung und die Anwendung des linearen Steuersatzes für Kapitaleinkünfte auf etwaige Wertzuwächse. Hierdurch bekommen Start-ups im umkämpften Arbeitsmarkt um die besten Talente starke Argumente im Vergleich zur Konkurrenz.
Allerdings sollten sich Unternehmer*innen durch eine fachkundige Beratung absichern, um Risiken von eigenkapitalähnlichen Genussrechten vorzubeugen. Dazu zählen insbesondere die saubere Strukturierung zur Einhaltung der steuerlichen Erfordernisse sowie die Abwägung mit alternativen Modellen, insbesondere virtuelle und reale Beteiligungsmodelle für Mitarbeitende.
Die Autoren:
Dr. Andreas Demleitner ist Rechtsanwalt & Steuerberater im Bereich Corporate Tax bei PwC und berät als Partner sowohl Start-ups als auch Investor*innen im Venture Capital-Umfeld mit den Schwerpunkten Durchführung von Finanzrunden und Implementierung von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen, Andreas.demleitner@pwc.com
Dr. Minkus Fischer, EMBA, ist Local Partner bei PwC Legal im Bereich Legal Deals im Stuttgarter Büro. Er berät seit über zehn Jahren in den Bereichen Corporate/M&A, mit einem Schwerpunkt in Venture Capital-Transaktionen, Minkus.fischer@pwc.com
Darknet Deals: Identitätshandel im Darknet
Datenkriminalität im Schatten: Wie ein Anruf zu Identitätshandel im Darknet führt.

Die Sicherheit und der Schutz von sensiblen Daten sind in einer wachsenden digitalen Welt von größter Bedeutung. Denn leider sind Betrüger*innen ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, an diese persönlichen Informationen zu gelangen. Dabei hat sich das Darknet zu einer der Hauptschnittstellen für den illegalen Handel mit gestohlenen Daten etabliert. Auch die Methoden der Betrüger zur Datenbeschaffung werden immer dreister und ausgeklügelter. Im Folgenden erfährst du, wie unsere Daten ins Darknet gelangen und wie sich Besorgte davor schützen können.
Die dunkle Seite des Internets und kriminellen Handlungen
Das Darknet ist ein abgeschotteter Bereich im Internet, der nicht über herkömmliche Suchmaschinen zugänglich ist. Hier können Nutzende ihre Identität verschleiern und anonym kommunizieren. Es wird für verschiedenste Zwecke genutzt, darunter illegale Aktivitäten wie der Austausch gestohlener Daten. Normalerweise gibt es verantwortliche Stellen bzw. spezielle Aufsichtsbehörden, die kontaktiert werden können, um gegen Datenschutzverletzungen im World Wide Web vorzugehen. Doch in diesem abgeschirmten Bereich des Internets wird alles dafür getan, um vor den entsprechenden Zuständigkeiten ungesehen zu bleiben. So befinden sich die Betreiber*innen der Server in der Regel außerhalb Europas, was es für Strafverfolgungsbehörden äußerst schwierig macht, einmal gestohlene Daten zu löschen oder Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Erst im Darknet veröffentlicht, können solche Datensätze mehrfach betrügerisch genutzt oder verkauft werden, was die Sicherheit und Privatsphäre der Betroffenen langfristig gefährdet. Auch können die Personen schwerer ausfindig gemacht werden, da sie die entwendeten Informationen nicht selbst nutzen und ihre rechtswidrigen Aktivitäten schwer auf sie zurückzuführen sind. Auf dem digitalen Schwarzmarkt zahlen Käufer*innen für solche gestohlene Daten und damit verbundene Dienstleistungen in Kryptowährungen wie Bitcoin. Diese Währungen führen auch dazu, dass die Bezahlvorgänge kaum nachvollziehbar sind.
Von Phishing bis Europol-Masche: Wie Betrüger*innen an die Daten kommen
Zu den bekanntesten Methoden, um an die begehrten Informationen zu kommen, zählt Phishing. Diese Masche ist vor allem für ihre Spam-Mails bekannt, bei denen die Betroffenen dazu verleitet werden, auf einen Link zu klicken und vertrauliche Daten preiszugeben. Jedoch findet diese Methode inzwischen auch über das Telefon statt. Die Betrüger*innen tarnen sich beispielsweise als Europol-Mitarbeitende und fordern ihre Gesprächspartner*innen dazu auf, ihre IBAN-Nummer zu nennen. Mittlerweile ist selbst die Suche nach einer Wohnung oder einem Job nicht mehr sicher. So verwenden Trickser gefälschte Angebote und stellen ein vorgetäuschtes Identitätsverfahren vor, um Suchende dazu zu bringen, Fotos ihrer Ausweise zu übermitteln.
Eine weitere dreiste Masche besteht darin, Leidtragende während eines Gesprächs schnell zu einem eindeutigen „Ja“ zu animieren. Wenn die Person zum Beispiel zustimmt, dass das Telefonat aufgezeichnet wird, haben die Betrüger bereits fast alles erreicht, was sie wollten. Danach stellen sie einige harmlose Fragen, und schon haben sie genug Material gesammelt, um das Gespräch beliebig zusammenschneiden zu können. Dann scheint es, als hätten die Betroffenen mit ihrem „Ja“ einem Kaufvertrag oder einem Abonnement zugestimmt.
Finanzielle Ausbeute: So viel bis du wert
Im Darknet existiert bereits ein florierender Handel mit gestohlenen Identitäten, die es Käufer*innen ermöglichen, verschiedene kriminelle Aktivitäten durchzuführen. Doch wie viel Gewinn können die Betrüger*innen damit überhaupt erreichen? Im Report des auf Antiviren-Programme spezialisierten Herstellers Bitdefender wird deutlich, dass eine gestohlene Identität in Form eines biometrischen EU-Passes auf dem Schwarzmarkt bis zu 4.500 Euro bringen kann. Die McAfee-Studie „The Hidden Data Economy“ von 2018 enthüllte wiederum, dass Darknet-Händler*innen in der Europäischen Union bis zu 40 Euro für vollständige Kreditkartendaten verlangen können. Auch Konten von Online-Zahlungsdiensten werden hier gehandelt. Dabei ist jedoch der Preis abhängig vom Guthaben des gehackten Kontos und variiert zwischen 20 und 300 Euro. Um also Betrüger*innen nicht auf den Leim zu gehen und sich den Ärger mit geklauten Daten zu ersparen, ist der Datenschutz im digitalen Zeitalter auch für Privatpersonen wichtiger denn je!
Praktische Maßnahmen: Wie entgehe ich der Täuschung?
Identitätsklau per Telefon ist nach wie vor eine weitverbreitete Methode für Datenhändler*innen, über die jede(r) informiert sein sollte. Um die persönlichen Daten zu schützen, ist es wichtig, bei der Weitergabe sensibler Informationen generell vorsichtig zu sein. Hier sind einige wichtige Maßnahmen, die ergriffen werden können, um einem möglichen Betrugsversuch vorzubeugen: Wenn ein Anruf verdächtig erscheint oder eine unbekannte Person Geld verlangt, handelt es sich in den meisten Fällen um einen Schwindel. Die größte Sicherheit besteht darin, das Gespräch sofort zu beenden. Um Datenverluste und finanzielle Schäden zu vermeiden, sollten niemals persönliche Informationen wie Anschrift, E-Mail-Adresse, Geburtstag, Passwörter oder Bankdaten an Fremde weitergegeben werden. Seriöse Behörden oder Unternehmen werden am Telefon unter keinen Umständen nach solchen Angaben fragen.
Ist der Schaden bereits entstanden und die Daten wurden preisgegeben, sollte die Bundesnetzagentur eingeschaltet werden. Auch die Polizei sollte unter der Rufnummer 110 kontaktiert werden. Wurde beispielsweise Geld illegal vom eigenen Konto abgebucht, kann die Bank dieses innerhalb von vier Wochen zurückholen. Hier gilt es jedoch zu beachten, dass dies nur funktioniert, wenn die Überweisung nicht von der betroffenen Person selbst getätigt wurde. Daher sollten niemals Zahlungen an eine unbekannte Person getätigt werden. Häufig kommen betrügerische Anrufe aus dem Ausland. Daher ist besondere Vorsicht bei folgenden Vorwahlen geboten: +88 (Globales Navigationssatellitensystem), +225 (Elfenbeinküste), +231 (Liberia), +252 (Somalia), +257 (Burundi), +261 (Madagaskar) oder +370 (Litauen). Schließlich kann es auch helfen, sich regelmäßig über die neuesten Betrugsmaschen zu informieren und somit im Falle eines entsprechenden Anrufs sensibilisiert zu sein.
Der Autor Thomas Wrobel ist Spam-Schutz-Experte, CTO der Müller Medien-Tochter validio und Gründer von Clever Dialer. Die App liefert verlässliche Anrufinformationen und schützt Verbraucher*innen vor Spam-Telefonaten.
Die Co-Founder-Beteiligung
Recht für Gründer*innen: Was aus steuerrechtlicher Sicht zu beachten ist, wenn das Gründungsteam durch eine weitere Person verstärkt wird.

Ein für Gründer*innen regelmäßig relevantes Thema ist die Beteiligung eines/einer später hinzutretenden Co-Founder*in zu dem als UG/GmbH organisierten Start-up. Klassischerweise soll der/die hinzutretende Gründer*in dabei kein Cash Investment mitbringen, sondern das Start-up durch seine künftige Tätigkeit unterstützen. Das Ziel ist mithin regelmäßig, dass der/die hinzutretende Co-Founder*in lediglich den Nominalbetrag der Anteile (in der Regel ein Euro je Anteil) leistet, nicht aber den ggf. weit höheren Verkehrswert. Dies ist etwa beabsichtigt, wenn das Gründungsteam nachträglich erweitert werden soll, auf Betreiben eines/einer beteiligten Investor*in oder wenn in einer Nachfolgekonstellation ein(e) neue(r) Co-Founder*in für ein ausgeschiedenes Teammitglied nachrückt.
Das Problem besteht nun darin, dass die Gewährung der Anteile in diesen Szenarien nach deutschem Steuerrecht grundsätzlich der Einkommensteuer unterliegen kann. Ein für die Einkommensbesteuerung relevanter Zufluss liegt bei der Gewährung einer Beteiligung grundsätzlich schon vor, wenn „echte“ Anteile (im Gegensatz zu virtuellen Anteilen) rechtlich wirksam übernommen werden.
Je nach konkreter Situation dürfte dann der/die beitretende Co-Founder*in, der/die für die Einräumung lediglich den Nominalbetrag leistet, im Hinblick auf den Differenzbetrag bis zum Verkehrswert der eingeräumten Anteile einkommensteuerpflichtig sein. Es erfolgt mithin eine Besteuerung auf Grundlage des Werts der Anteile, obgleich dem/der Co-Founder*in kein Cash-Betrag zufließt (sog. Dry Income). Dies ist ein ganz erhebliches Steuerrisiko, das den/die beitretende(n) Co-Founder*in direkt betrifft. Es ist wegen der Pflicht der Gesellschaft zur ordnungsgemäßen Abführung entsprechender Lohnsteuer auch ein Thema für die Geschäftsführung der Gesellschaft.
Fondsstandort- und Einkommensteuergesetz
Der Gesetzgeber hatte an sich im Jahr 2021 die Intention, dieses Thema zu regeln, und als Folge sollte auch der/die beitretende Co-Founder*in entlastet werden. Der in diesem Zusammenhang im Rahmen des sog. Fondsstandortgesetzes (2021) neu gefasste § 19a Einkommensteuergesetz (EStG) hilft an dieser Stelle allerdings nur bedingt. Nach § 19a Abs. 1 EStG unterliegen die Anteile bei Einräumung zwar zunächst nicht der Einkommensbesteuerung, sondern gemäß § 19 Abs. 4 Nr. 1 EStG erst bei der späteren Übertragung im Exit-Fall. Dies würde für sich gesehen dem/der Co-Founder*in zur Risikominimierung steuerrechtlich entgegenkommen, da eine Besteuerung dann erst erfolgt, wenn tatsächlich der Exit-Erlös erzielt wird.
Allerdings wird die Einkommensteuer nach den weiteren Varianten des § 19 Abs. 4 EStG auch dann fällig, wenn seit der Übertragung der Vermögensbeteiligung zwölf Jahre vergangen sind oder das Dienstverhältnis des/der Gründer*in beendet wird.
Nach § 19a Abs. 5 EStG hat das Betriebsstättenfinanzamt den nicht besteuerten Vorteil im Rahmen einer Anrufungsauskunft gemäß § 42e EStG bei Einräumung der Anteile zu bestätigen. Im Falle des späteren Exits wird dann für die Bewertung des zu besteuernden geldwerten Vorteils auf diese Feststellungen Bezug genommen.
Aus Sicht des/der beitretenden Co-Founder*in besteht damit auch bei Anwendung des § 19a EStG weiterhin die Gefahr, dass sich das Steuerrisiko zu einem Zeitpunkt realisiert, in dem er/sie aus dem Beitritt noch keine Erlöse erzielt hat. Auch wird die Steuerlast nicht abhängig von der Wertentwicklung der eingeräumten Anteile reduziert, sondern lediglich auf einen späteren Zeitpunkt verlagert.
Hurdle Shares und Growth Shares
Dieses Thema wird im Rahmen einer Finanzierungsrunde aktuell anderweitig über die Gewährung von sog. Hurdle Shares oder auch Growth Shares gelöst. Hierbei handelt es sich um Anteile (in der Regel Common Shares mit Stimmrechten etc.), deren Wert im Ergebnis im Zeitpunkt der Übertragung bei einer späteren Erlösverteilung als negativer Rechnungsposten zum Abzug gebracht wird (sog. negative Liquidationspräferenz). Deren Anerkennung durch die Finanzverwaltung setzt dabei voraus, dass sämtliche Erlöse, also Liquidations-, Gewinn- und sonstige Erlöse, erfasst werden. Im Zeitpunkt der Einräumung wird so der Wert der Anteile und damit der zu besteuernde geldwerte Vorteil neutralisiert.
Wesentlich bei der Einräumung dieser Anteile ist damit die Festlegung eines sog. Hurdle Amount je Anteil, der definiert, welcher Abzug von künftigen Erlösen erfolgen soll. Dieser Wert entspricht regelmäßig dem Verkehrswert des jeweiligen Anteils zum Zeitpunkt der Einräumung abzüglich des tatsächlich gezahlten Anteilspreises (in der Regel Nominalbetrag). Vereinfacht ist der/die hinzutretende Co-Founder*in bei einem künftigen Exit mithin nur mit der Wertsteigerung ab seinem/ihrem Beitritt beteiligt. In der Folge erzielt der/die Co-Founder*in, anders als in den Fällen der Dry-Income-Besteuerung, keinen unmittelbaren Lohnzufluss, der bereits bei Einräumung zu versteuern wäre. Dies gilt allerdings nur insoweit, als der Hurdle Amount der tatsächlichen Differenz zwischen dem gezahltem Anteilspreis und dem Verkehrswert entspricht. Bei Abweichungen zugunsten des/der Co-Founder*in führt die Differenz zu einem sog. geldwerten Vorteil, der als Teil des Arbeitslohns im Zeitpunkt des Zuflusses zu versteuern ist.
Neben der Vermeidung der Anfangsbesteuerung bei Einräumung der Anteile erzielen die Hurdle Shares auch eine reduzierte Steuerlast im Exit-Fall. Aufgrund der Gestaltung als echte Beteiligung (im Gegensatz etwa zu einer virtuellen Beteiligung, hier Besteuerung mit dem persönlichen Steuersatz – also unter Umständen bis zu 45 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag), werden aus der Beteiligung Kapitaleinkünfte erzielt, die dem sog. Abgeltungssteuersatz (25 Prozent zzgl. Solidaritätszuschlag) unterliegen oder (bei Beteiligungen von mindestens einem Prozent) im Teileinkünfteverfahren zu 40 Prozent steuerfrei gestellt sind. Bei Zwischenschaltung einer Holding-UG kann die Steuerlast unter Umständen noch weiter reduziert werden (bis zu 95 Prozent der Einkünfte steuerfrei).
Zur Vermeidung von steuerlichen Risiken empfiehlt es sich, die Strukturierung der Co-Founder-Beteiligung über Hurdle Shares im Rahmen einer Lohnsteueranrufungsauskunft (denkbar, aber aufwendiger ist auch eine verbindliche Auskunft oder eine Kombination) mit der Finanzverwaltung abzustimmen. Die diesbezügliche Rückmeldung hat zwar nur Bindungswirkung für die Gesellschaft und nimmt zudem einige Monate in Anspruch – während dieser Zeit kann die Beteiligung noch nicht final umgesetzt werden –, sollte aber insbesondere wegen der Bewertungsunsicherheiten bei Start-ups als Absicherung erwogen werden.
Diese Wartezeit bedeutet jedoch nicht, dass der Beitritt der/des Co-Founder*in (etwa im Rahmen einer Finanzierungsrunde) bis zur positiven Auskunft des Finanzamts aufgeschoben werden muss. Dieser Umstand kann im Rahmen der Erstellung der Beteiligungsdokumentation entsprechend abgebildet werden und die finale Einräumung der Beteiligung vom Eingang einer positiven Rückmeldung abhängig gemacht werden. Auch für den Fall einer negativen Rückmeldung werden in der Regel bereits Vorkehrungen getroffen, etwa durch die alternative Einräumung von virtuellen Anteilen (dann allerdings mit höherer Besteuerung; s.o.).
Zukunftsfinanzierungsgesetz
Aktuell bestehen Diskussionen über weitere gesetzgeberische Maßnahmen, die für das hier beschriebene Thema relevant sind. Insbesondere durch den aktuell vorliegenden Referentenentwurf des Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (kurz: Zukunftsfinanzierungsgesetz) werden verschiedene Maßnahmen vorgesehen, durch die unter anderem die o.g. Punkte an den bestehenden Regelungen aufgegriffen werden.
Bezüglich der Beteiligung eines/einer Co-Founder*in sind die rechtlichen und insbesondere steuerrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten. Hier wird der Gesetzgeber seit einiger Zeit tätig; es ist jedoch noch nicht absehbar, mit welchen Änderungen zu rechnen ist. Bis dahin wird es in den meisten Fällen einer nachträglichen Beteiligung naheliegen, eine Gestaltung von Hurdle Shares vorzusehen und den Vorgang steuerrechtlich mit der Finanzverwaltung entsprechend vorab zu klären.
Die Autoren: Alexander Weber, LL.M. (Victoria University of Wellington) ist Partner und Roman Ettl-Steger, LL.M. (King’s College London) Salaried Partner, beide am Münchner Standort der Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek im Bereich Venture Capital, www.heuking.de


