Aktuelle Events
Anbieter-Test: Cloudbuchhaltung 2019
Buchhaltung aus der Cloud: die Alternative zur klassischen Software-Lösung. Wir haben 7 Anbieter unter die Lupe genommen.

In der Cloud kommt man dem Traum vom papierlosen Büro schon ziemlich nah: Belege mobil fotografieren – und mit wenigen Handgriffen sofort buchen. Keine Installation, geringe Kosten, auf jedem Gerät nutzbar – Cloud-Dienste erfreuen zurecht wachsender Beliebtheit, zumal sie gegenüber klassischer Software funktional stark aufgeholt haben. Gründer, Freiberufler und Kleinbetriebe haben die Wahl zwischen Komplettlösungen mit Buchhaltung & Auftragsbearbeitung oder schlanker Anwendungen für die Rechnungsstellung. Letzteres ist nur sinnig, wenn man die Buchhaltung dem Steuerberater überlässt. In Sachen Buchhaltung ist die Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) ein Muss. Wir haben sieben Cloud-Dienste unter die Lupe genommen.

Die Cloud-Lösung LexOffice ist in drei Versionen erhältlich. Den Unterschied macht dabei die Buchhaltung: Nur mit dem umfangreichsten Paket „Buchhaltung & Berichte“ lässt sich die obligatorische EÜR erstellen. Neue Funktionen werden – wie bei Cloud-Lösungen üblich – sofort bereitgestellt. So sind zuletzt Alternativpositionen in Angeboten, Abschlagsrechnungen und Rechnungskorrekturen hinzugekommen. Gut ausgestattet ist die Software in Sachen Online-Banking. Hier lassen sich alle gängigen Finanzinstitute anbinden, zuletzt auch das Berliner Fintech-Unternehmen Kontist, das mit einem kostenlosen Geschäftskonto aufwarten kann.
Das Zusammenspiel beider Dienste geht weit über das übliche Maß hinaus: Wer die Zahlungsvorgänge des Bankkontos mit Belegen in LexOffice verknüpft, kann die Dokumente auch aus dem Kontoauszug heraus aufrufen. Zudem wird die aus den ein- und ausgehenden Belegen berechnete Umsatzsteuerzahllast laufend ermittelt und auf einem Rücklagenkonto gesammelt. Das ist gerade für unerfahrene Gründer hilfreich, denn es kann schnell passieren, dass Geld ausgegeben wird, das eigentlich dem Finanzamt gehört. Über eine weitere Schnittstelle zu PayPal kann man Transaktionen halb automatisch in die Buchhaltung übernehmen.
Im Geschäftsalltag arbeitet LexOffice belegorientiert. Angebote und Rechnungen sind mit wenigen Eingaben verarbeitet. Eingehende, gescannte oder digitale Belege lassen sich per Drag & Drop übernehmen und direkt für die EÜR kategorisieren. Dabei fischt eine OCR-Funktion relevante Rechnungsdaten heraus, die sich anschließend halbmanuell übernehmen lassen. Weitere Punkte sammelt LexOffice mit dem Dashboard, das Außenstände, Umsätze, Einnahmen und Ausgaben übersichtlich zusammenfasst. Kleinere Lücken bestehen bei der Anlagenverwaltung, der Preisgestaltung oder der Gruppierung. Für unterwegs gibt es eine mobile App für Android und Apple iOS. Wer etwa unterwegs Reisekosten erfassen will, kann die Belege einfach abfotografieren und mit wenigen Handgriffen verarbeiten.
Fazit
LexOffice ist elegant gestaltet und dank der vielen Eingabehilfen einfach zu bedienen. Gründer reduzieren so den Papierkram auf ein Minimum. Mit Anbindungen an Einkommensteuererklärung, Projektzeiterfassung oder E-Commerce-Lösungen lässt sich der Cloud-Dienst jederzeit erweitern. Weniger schön sind die zuletzt kräftigen Preiserhöhungen.

Bei sevDesk hat sich seit unserem letzten Test nicht allzu viel getan. Eine Schwachstelle ist die OCR-Funktion, die bei den meisten Rechnungen nur einen Teil der Beleginformationen übernimmt. Praktisch sind hingegen Funktionen für Buchungssplitts und wiederkehrende Vorgänge, mit denen sich etwa Miet- oder Abschlagszahlungen buchhalterisch automatisieren lassen. Etwas dünn ist es um die klassischen Auswertungen bestellt. Hier hat sevDesk nicht viel mehr als die obligatorische EÜR anzubieten.
Nichts zu meckern gibt es hingegen beim umfangreichen Dashboard, das unter anderem über Einnahmen/Ausgaben, Kontostand oder Steuerzahllast informiert. Artikel- und Kundendatenbank sind schlank, aber ausreichend. Bei den Kundendaten wird zwischen Organisationen und Mitarbeitern unterschieden. Wer es mit größeren Unternehmen oder Behörden zu tun hat, behält so besser den Überblick. Umsatzsteuersätze lassen sich auf Artikelebene festlegen, sodass Rechnungen mit unterschiedlichen Steuervorgaben erstellt werden können.
Vorbildlich ist der kaufmännische Workflow umgesetzt, der im Anschluss an die Rechnung mit einer Mahnung fortgesetzt werden kann. Die Schnittstelle zum Frankierdienst erspart einem den Weg zur Post. Ein- und ausgehende Zahlungen lassen sich per Online-Banking übernehmen, sodass Doppeleingaben entfallen. Für iPhones und Android-Smartphones stellt sevDesk zwei mobile Apps zur Verfügung, um Belege zu scannen und Aufträge zu schreiben. Tablets werden derzeit nicht unterstützt. Mit dem Wechsel auf die größere sevDesk Warenwirtschaft kommen Anwender auch in den Genuss einer Lagerverwaltung.
Fazit
SevDesk ist eine ausgewogene Einstiegslösung für Start-ups, Freiberufler und Kleinbetriebe. Nachholbedarf besteht beim klassischen Reporting und im mobilen Bereich, wo eine Tablet-Version fehlt. Wichtiger Pluspunkt: Für sevDesk gibt es 20 Schnittstellen zu angrenzenden Online-Diensten.

Die Sage Business Cloud Buchhaltung verbindet die beiden Bereiche Auftragsbearbeitung und Finanzbuchhaltung. Insgesamt ist der Cloud-Dienst nicht ganz so elegant und einfach zu bedienen wie LexOffice, dafür jedoch in Teilbereichen besser ausgestattet. So können Anwender mit der einfachen Gewinnermittlung starten und später auf die Bilanzierung wechseln.
Das ist speziell für wachstumsorientierte Gründer interessant, die in absehbarer Zeit die Grenzen für die vereinfachte Gewinnermittlung überschreiten. Ein weiterer Vorteil ist die Bestandsführung für Artikel, die vor allem für Handels- und Handwerksbetriebe interessant sein dürfte, die neben Dienstleistungen auch Materialien verkaufen. Auch bei Sage wird grundsätzlich belegorientiert gearbeitet. Gescannte oder digitale Belege lassen sich gesetzeskonform archivieren.
Mit der App zum Cloud-Dienst kann man unterwegs Rechnungen erstellen oder Geschäftszahlen abrufen. Der Anwender findet neben druckorientierten Berichten auch ein professionelles Dashboard vor, das aktuelle Geschäftszahlen – etwa zu Umsätzen, Cashflow oder Außenständen – listet. Über Partnerlösungen lässt sich der Funktionsumfang erheblich erweitern: So sind zuletzt die CRM-Lösung von Teamleader und das Forderungsmanagement von Bilendo hinzugekommen. Zusätzliche Benutzer lassen sich mit wenigen Klicks ergänzen.
Fazit
Bei der Sage Business Cloud Buchhaltung stehen die Ampeln auf Wachstum. Der Cloud-Service ist mit vielen Funktionen für ambitionierte Betriebe ausgestattet. Hierzu gehört der fliegende Wechsel von der EÜR auf die Bilanzierung oder die Lagerverwaltung. Insgesamt macht der Cloud-Dienst einen ausgewogenen Eindruck zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
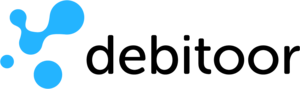
Bei Debitoor M profitieren Anwender von einem stellenweise überraschend breiten Leistungsspektrum. So können Dienstleister per Abo-Rechnung die Fakturierung regelmäßig wiederkehrender Vorgänge automatisieren. Ein Dashboard gibt es bei Debitoor M nicht nur auf der obersten Ebene, sondern etwa auch in der Anlagenverwaltung. Neben der obligatorischen EÜR werden bei den Auswertungen auch Bilanz & GuV angeboten. Die doppelte Buchführung – wie für Kapitalgesellschaften vorgeschrieben – beherrscht der Cloud-Dienst nicht.
Bei Bedarf lassen sich ergänzende Online-Dienste von Debitoor-Partnern hinzubuchen. Hierzu gehören etwa Webshops, Zeiterfassung oder Lohnabrechnung. Debitoor gehört zu den fleißigen Entwicklern, die ihren Dienst laufend um neue Funktionen erweitern. So ist kürzlich die Anbindung an den Kartenleser von Sumup hinzugekommen. In Kombination mit der mobilen App kann man nun unterwegs unbare Kundenzahlungen entgegennehmen. Zusätzlich stehen mobil mehr Kundendaten zur Verfügung, die sich über eine durchaus effiziente Such- und Filterfunktion besser recherchieren lassen. Andere Neuerungen wie die Optionen, um PDF-Belege zu ergänzen oder die Umsatzsteuervoranmeldung zu korrigieren, dienen vor allem dazu, vorhandene Lücken zu schließen. Ein Schritt nach vorn ist das überarbeitete Online-Banking, das jetzt automatisch neue Umsätze abholt.
Fazit
Debitoor M ist ein schlanker, übersichtlicher Cloud-Dienst für Freiberufler und Gründer, die den Jahresabschluss dem Steuerberater überlassen. Vor allem die mobile App hat in letzter Zeit deutlich zugelegt, was jenen entgegenkommt, die viel unterwegs sind.

Das Finanz- und Rechnungsprogramm invoiz eignet sich hervorragend für all jene, die ihre Buchhaltung nicht selber machen, sondern die wichtigen buchhalterischen Angelegenheiten lieber dem Steuerberater überlassen wollen. Mit invoiz erledigen Freiberufler und Selbstständige einfach, übersichtlich und schnell die vorbereitende Buchhaltung. So ist es zum Beispiel möglich, Aufträge mithilfe der Zeiterfassungsfunktion nach Stunden- oder Tagessätzen abzurechnen und relevante Daten per Knopfdruck für den Steuerberater zu exportieren. Wer das Zeiterfassungstool mite benutzt, kann dies mit invoiz verknüpfen und so die eingetragenen Zeiten direkt verarbeiten und in Rechnung stellen. Eine große Hilfe ist auch der invoiz Steuerschätzer, mit dem die Nutzer auf Grundlage der Umsatz- und Ausgabenzahlen die Größenordnung der bereits aufgelaufenen Steuerbelastung ermitteln können. Sie können so in Echtzeit sehen, was ihnen effektiv vom Umsatz übrig bleibt. Unabhängig von der Steuerbelastung ermittelt das Liquiditätsbarometer den voraussichtlichen Kontostand am Ende des jeweiligen Monats. Mittels künstlicher Intelligenz sagt dieses Feature die bevorstehenden Ausgaben vorher. Details wie offene Rechnungen, regelmäßige Einnahmen und Ausgaben sowie ausstehende Umsatzsteuerzahlungen liegen der Berechnung zugrunde. Die voraussichtliche Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich dabei aus Details wie dem Vorhandensein einer Dauerfristverlängerung und Informationen über das Abbuchungsverhalten des zuständigen Finanzamtes.
Bei invoiz lassen sich Geschäftskonten aller Art einbinden – sogar Spar- und Tagesgeldkonten. Einmal eingerichtet erkennt das System sofort, wenn eine Rechnung bezahlt wurde und informiert den Nutzer über den Zahlungseingang. Übrigens können in invoiz erstellte Rechnungen mittels invoizPAY direkt und per Knopfdruck einfach bezahlt werden. Das ist entweder per PayPal, mit dem GiroCode oder traditionell per Überweisungsträger möglich. Selbstverständlich bietet invoiz auch die Funktionen wie das Erstellen und Versenden von Angeboten, Rechnungen, Lieferscheine und Mahnungen an. Sogar Abschlags- und Aborechnungen werden von invoiz unterstützt. Alle Features stehen den Nutzern von invoiz als Apps zur Verfügung, die je nach Plan variieren und individuell dazugebucht werden können. Weitere Apps, aus von Drittanbietern, sind in der Entwicklung. Das Angebot von invoiz wird also konsequent und nach Kundenbedürfnissen ausgebaut.
Fazit
invoiz ist als Produkt der Buhl-Gruppe ein sicherer und vollumfänglich ausgestatteter Anbieter für das Finanzmanagement von Freiberuflern und Selbstständigen.

Der finnische Cloud-Dienst Zervant ist ähnlich aufgestellt wie Invoiz und verfügt ebenfalls über keine eigene Buchhaltung. Wer seine Rechnungen ausschließlich ausdruckt oder per E-Mail verschickt, startet am besten mit der kostenlosen Version, mit der man Angebote und Rechnungen an bis zu zehn verschiedenen Kunden versenden kann. Mit dem Wechsel auf eines der Bezahlmodelle buchen Anwendern unter anderem Abschlagsrechnungen, das kaufmännische Mahnwesen und die Zeiterfassung hinzu. Deren aufgezeichneten Einträge lassen sich mit wenigen Klicks in die Abrechnung übernehmen.
Was hingegen fehlt, ist das Online-Banking. Das führt dazu, dass sich eingehende Zahlungen relativ umständlich buchen lassen. Neben dem E-Mail-Versand können Rechnungen auch an einen Frankierservice übermittelt oder als sichere E-Rechnung verschickt werden. Der Umfang von Rechnungslegung, Kunden- und Artikeldatenbank ist knapp bemessen, aber für Dienstleistungsbetriebe ausreichend. Da Zervant ausschließlich Ausgangsrechnungen verarbeitet, bleibt beim Berichtswesen der Einblick in die finanzielle Situation unvollständig. Geboten werden Umsatzauswertungen und eine Übersicht zur Rechnungsstruktur. Ohne Technologiepartner ist die Ausbaufähigkeit der Software begrenzt.
Fazit
Zervant ist ein leicht zu bedienender Cloud-Dienst für die Angebots- und Rechnungserstellung. Der größte Vorteil liegt darin, dass der Service bis zu zehn Kunden kostenlos verarbeitet. Insgesamt ist der Funktionsumfang überschaubar.

FastBill ist neben Zervant und Invoiz der Dritte im Bunde, der ohne eigene Buchhaltung auskommt. Immerhin hat FastBill mehr zu bieten als die beiden Wettbewerber. Besonders gut wird die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater unterstützt: Während man bei Invoiz die Dokumente für den Berater halbmanuell herunterladen muss, unterstützt FastBill die komfortable DATEVconnect-Anbindung, die nicht nur Buchungsdaten, sondern auch elektronische Belege übermittelt. Kunden- und Artikeldatenbank sind übersichtlich, aber nur durchschnittlich ausgestattet. Zwar wird zwischen Privat- und Geschäftskunden unterschieden, doch dafür können auf Artikel- und Kundenebene keine Rabatte hinterlegt werden. Jede Kundenakte enthält in verschiedenen Registern Rechnungen, Dokumente und Projekte, was bei komplexeren Geschäftsbeziehungen für mehr Übersicht sorgt. Praktisch für Dienstleister, die auf Stundenbasis arbeiten, ist die integrierte Projektzeiterfassung. Die geloggten Arbeitszeiten lassen sich mit wenigen Handgriffen zum hinterlegten Stundensatz abrechnen.
Die im letzten Jahr angekündigten Kundenaktivitäten wurden bislang allerdings noch nicht realisiert. Was die Auswertungen angeht, liefert FastBill ausschließlich verkaufsorientierte Zahlen, etwa zum Umsatz oder den offenen Rechnungen. Da Ausgabenbelege ohne Kontierung lediglich für den Steuerberater gescannt werden, bleibt der Einblick in die Finanzsituation unvollständig. Zu den weiteren Funktionen gehört das integrierte Online-Banking, über das sich in der Pro-Version bis zu fünf Bankkonten einbinden lassen. Für den mobilen Einsatz gibt es eine Scan-App. Die Software selbst lässt sich ausschließlich via Webbrowser nutzen.
Fazit
Dafür, dass FastBill lediglich die Verkaufsseite unterstützt, erscheint der Preis recht hoch – auch wenn der Cloud-Service unterm Strich eine gute Figur macht. Vor allem eine native mobile App sollte man bei dem Preisniveau erwarten dürfen. Interessant ist der Dienst für Gründer, die Wert auf eine gut ausgestattete Auftragsbearbeitung legen.
Wer hat die Nase vorn?
Die Cloud-Anbieter ziehen die Daumenschrauben an. Im Vergleich zu unserem letzten Test sind die monatlichen Mietkosten teils kräftig gestiegen. Umso wichtiger ist es, den Funktionsumfang der Dienste genau zu prüfen, bevor man langfristig darauf zurückgreift. Denn bei einem späteren Wechsel kann man meist nur einen Teil der Daten mitnehmen, was oft einen erheblichen Arbeitsaufwand nach sich zieht. Während die EÜR mal mehr, mal weniger komfortabel, aber stets ähnlich umgesetzt ist, gibt es im Bereich der Auftragsbearbeitung größere Unterschiede. Zu den wichtigsten Funktionen gehören hier Projektzeiterfassung, Abo- oder Abschlagsrechnungen.
Mobile Apps und ein – meist eingeschränktes – Online-Banking sind bei den meisten Diensten inklusive. Respekt vor der Buchhaltung muss man nicht haben, die Lösungen sind durchweg selbsterklärend und auch für kaufmännische Einsteiger geeignet. Was die Bewertung angeht, hat LexOffice trotz Preiserhöhung die Nase vorn. Der Cloud-Dienst verbindet eine vorbildliche Benutzerführung mit einer guten Ausstattung. Gleich dahinter kommt die Sage Business Cloud, die als einziger Cloud-Service EÜR und Bilanzierung parallel unterstützt. Wer ausschließlich Rechnungen schreiben will, ist bei Invoiz bestens aufgehoben – zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Hier findest du die wichtigsten Fakten aus unserem Test im kompakten Überblick als Download
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Die Wächter des Firmengedächtnisses
Wie das 2025 von Christian Kirsch und Stefan Kirsch gegründete Start-up amaiko den Strukturwandel im Mittelstand adressiert.

Der demografische Wandel und eine erhöhte Personalfluktuation stellen mittelständische Unternehmen zunehmend vor die Herausforderung, internes Know-how zu bewahren. Viele Unternehmen stehen vor der Schwierigkeit, dass Firmenwissen fragmentiert vorliegt. Informationen sind häufig in unterschiedlichen Systemen oder ausschließlich in den Köpfen der Mitarbeitenden gespeichert. Verlassen langjährige Fachkräfte den Betrieb in den Ruhestand oder wechseln jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kurzfristig die Stelle, gehen diese Informationen oft verloren. Zudem bindet die Suche nach relevanten Dokumenten in verwaisten Ordnerstrukturen Arbeitszeit, die in operativen Prozessen fehlt.
Das 2025 gegründete Start-up amaiko aus Niederbayern setzt hierbei auf einen technischen Ansatz, der auf die Einführung neuer Plattformen verzichtet und stattdessen eine KI-Lösung direkt in die bestehende Infrastruktur von Microsoft Teams integriert. Vor diesem Hintergrund entwickelten die Brüder Christian und Stefan Kirsch mit amaiko eine Softwarelösung, die spezifisch auf die Ressourcenstruktur mittelständischer Betriebe ausgelegt ist.
Integration statt neuer Insellösungen – und die Abgrenzung zu Copilot
Ein wesentliches Merkmal des Ansatzes ist die Entscheidung gegen eine separate Software-Plattform. Christian Kirsch, Geschäftsführer von PASSION4IT und amaiko, positioniert die Lösung als „Teams-native“. Das bedeutet, dass der KI-Assistent technisch in Microsoft Teams eingebettet wird – jene Umgebung, die in vielen Büros bereits als primäres Kommunikationswerkzeug dient. Ziel ist es, die Hürden bei der Implementierung zu senken, da Nutzer ihre gewohnte Arbeitsumgebung nicht verlassen müssen.
Angesichts der Tatsache, dass Microsoft mit dem „Microsoft 365 Copilot“ derzeit eine eigene, tief integrierte KI-Lösung ausrollt, stellt sich die Frage nach der Positionierung. Christian Kirsch sieht hier jedoch keine direkte Konkurrenzsituation, sondern eine klare Differenzierung: Copilot sei eine sehr breite, Microsoft-zentrische KI-Funktion. Amaiko hingegen verstehe sich als spezialisierter, mittelstandsorientierter Wissensassistent, der Beziehungen, Rollen, Prozesse und Unternehmenslogik tiefgreifend abbildet.
Ein entscheidender Vorteil liegt laut Kirsch zudem in der Offenheit des Systems: „Während Copilot naturgemäß an Microsoft‑Systeme gebunden ist, lässt sich amaiko herstellerunabhängig in eine viel breitere Softwarelandschaft integrieren – vom ERP über CRM bis zu Branchenlösungen. Unser Ziel ist nicht, Copilot zu kopieren, sondern reale Mittelstandsprozesse nutzbar zu machen“, so der Co-Founder.
Funktionsweise, Sicherheit und Haftung
Funktional unterscheidet sich das System von herkömmlichen Suchmasken durch eine agentenähnliche Logik. Die Software bündelt Wissen aus internen Quellen wie Richtlinien oder Projektdokumentationen und stellt diese kontextbezogen zur Verfügung. Ein Fokus liegt dabei auf der Datensouveränität. Hierbei betont Christian Kirsch, dass Kundendaten nicht in öffentlichen Modellen verarbeitet werden: „Die Modelle laufen in der europäischen Azure AI Foundry, unsere eigenen Dienste auf deutschen Servern. Die Daten des Kunden bleiben on rest vollständig im jeweiligen Microsoft‑365‑Tenant. Es findet kein Training der Foundation Models mit Kundendaten statt – weder bei Microsoft noch bei uns. Grundlage dafür sind die Azure OpenAI Non‑Training Guarantees, die Microsoft in den Product Terms sowie in SOC‑2/SOC‑3‑ und ISO‑27001‑Reports dokumentiert.“
Auch rechtlich zieht das Start-up eine klare Grenze, sollte die KI einmal fehlerhafte Informationen, sogenannte Halluzinationen, liefern. „Amaiko generiert Vorschläge, keine rechts‑ oder sicherheitsverbindlichen Anweisungen. Das stellen wir in unseren AGB klar: Die Entscheidungshoheit bleibt beim Unternehmen. Wir haften für den sicheren Betrieb der Plattform, nicht für kundenseitig freigegebene Inhalte oder daraus abgeleitete Maßnahmen. Es geht um eine saubere Abgrenzung – technische Verantwortung bei uns, inhaltliche Verantwortung beim Unternehmen“, so Christian Kirsch.
Geschäftsmodell und Markteintritt
Seit der Vorstellung der Version amaiko.ai im Juli 2025 wird das System nach Angaben des Unternehmens mittlerweile von über 200 Anwendern genutzt. Durch die Integration in die bestehende Microsoft-365-Landschaft entfällt für mittelständische Kunden eine aufwendige Systemmigration, was die technische Eintrittsbarriere gering hält.
Passend zu diesem Ansatz ist amaiko als reines SaaS-Produkt konzipiert, das Unternehmen ohne Einstiegshürde direkt online buchen können. Laut Kirsch sind keine Vorprojekte, individuellen Integrationspfade oder teuren Beratungspflichten notwendig: „Die Nutzung ist selbsterklärend und leichtgewichtig. Wer zusätzlich Unterstützung möchte – etwa zur Wissensstrukturierung oder Governance – kann sie bekommen. Aber die technische Einführung selbst ist bewusst so gestaltet, dass Mittelständler ohne Implementierungsaufwand starten können.“
Unterm Strich liefert amaiko damit eine pragmatische Antwort auf den drohenden Wissensverlust durch den demografischen Wandel: Statt auf komplexe IT-Großprojekte zu setzen, holt das bayerische Start-up die Mitarbeitenden dort ab, wo sie ohnehin kommunizieren. Ob sich die „Teams-native“-Strategie langfristig gegen die Feature-Macht von Microsoft behauptet, bleibt abzuwarten – doch mit dem Fokus auf Datensouveränität und mittelständische Prozesslogik hat amaiko gewichtige Argumente auf seiner Seite, um sich als spezialisierter Wächter des Firmengedächtnisses zu etablieren.
Gründer*in der Woche: Gamba Zamba – Garnelen Made in Germany
Das FoodTech-Start-up aquapurna der Gründer David Gebhard und Florian Gösling zeigt, dass Garnelen verantwortungsvoll und regional angeboten werden können – aus deutscher Aufzucht.

Die Geschichte von Gamba Zamba beginnt auf einer Reise: Als Florian Gösling in Asien Einblicke in die industrielle Garnelenproduktion erhält, ist er schockiert. Zurück in Deutschland tauschte er sich mit David Gebhard, seinem langjährigen Freund aus dem Bergsport und heutigen Co-Gründer von Gamba Zamba aus, und stellte die Frage: „Warum sollten Garnelen nicht auch hier bei uns wachsen können – frisch, nachhaltig und ohne Tierleid?“
Bei ihren Recherchen stellten die beiden fest: Europäische Alternativen gibt es, aber sie sind mehrfach teurer als Importware. Eine weitere Erkenntnis: Zwar ist die Technologie für landbasierte Kreislaufaquakultur grundsätzlich vorhanden, befindet sich jedoch noch in einem frühen Entwicklungsstadium und verursacht zu hohe Kosten.
Florian und David waren sich sicher, dass das besser geht, schritten zur Tat und gründeten mitten in der Corona-Pandemie auf dem Gelände einer ehemaligen Kali-Mine bei Hannover ihr eigenes Garnelenforschungszentrum.

Hightech trifft Naturverständnis
Dort, in der eigens entwickelten Kreislaufanlage, wachsen seitdem Garnelen unter stabilen, artgerechten Bedingungen auf. Das System spart über 99 Prozent Wasser, arbeitet vollständig ohne Antibiotika und Chemie und ermöglicht eine Aufzucht, die Natur und Technologie intelligent verbindet.
Das sogenannte SmartReef-System schafft künstliche Riffstrukturen, auf denen sich die Tiere häuten und zurückziehen können. Sensoren überwachen permanent die Wasserqualität. „Unsere Tiere sollen sich wohlfühlen. Nur dann können sie gesund wachsen“, so Florian.
Während den Garnelen-Weibchen in Asien und Südamerika ein Auge entfernt wird, damit sie ihre Eier ablegen – was meist zu ihrem Tod führt –, setzt Gamba Zamba auf natürliche Vermehrung und eine Diät aus Tintenfisch und Miesmuscheln. „Für uns ist das ein absolutes No-Go. Wir sehen Garnelen als Lebewesen, nicht als reine Commodity“, betont David.
Auch sonst unterscheidet sich die Aufzucht grundlegend von herkömmlichen Methoden: Das Start-up verzichtet konsequent auf Antibiotika, Sulfite (E223), die allergische Reaktionen auslösen können, Phosphate, die Wasser binden und Konsument*innen täuschen, übermäßige Glasur – also das typische „Pfannenwasser“, und chemische Entkeimungsmittel wie Chlor oder Peroxide. Das Ergebnis: reine, unverfälschte Garnelen mit natürlichem Geschmack und fester Textur.
„Viele Menschen möchten bewusster essen, ohne auf Genuss zu verzichten. Genau das bieten wir: frische Garnelen aus deutscher Aufzucht – mit vollem Geschmack und gutem Gewissen“, erklärt Florian.
Bisher hatten Garnelen-Fans hierzulande kaum eine Wahl: Entweder billige Importware mit zweifelhaftem Ursprung und hohem CO₂-Fußabdruck oder europäische Nischenprodukte für teils über 120 Euro pro Kilo. „Wir schaffen endlich eine leistbare, nachhaltige Alternative“, sagt Florian.
Diese 10 Start-ups bauen an der Zukunft der AgriFood-Branche
Die deutsche Start-up-Landschaft verzeichnete 2025 ein Rekordhoch bei Neugründungen. Doch gerade im AgriFood-Sektor ist der Weg vom Prototyp zum Marktführer steinig. Kapitalintensive Hardware und strenge Regulatorik bremsen viele aus. Der Growth Alliance Accelerator zeigt, wie Gründer*innen diese Hürden überspringen – und präsentiert zehn Akteure, die auf der Erfolgsspur sind.

Es ist ein Paradoxon: Die Nachfrage nach nachhaltigen Lebensmitteln und effizienter Landwirtschaft ist so hoch wie nie, doch für Gründer*innen und junge Unternehmen in der AgriFood-Branche bleibt der Markteintritt ein Hürdenlauf. Während Software-Start-ups oft mit geringem Kapital skalieren, kämpfen Food- und AgTech-Pioniere mit der „Hardware-Falle“. Sie benötigen teure Produktionsanlagen, Labore und müssen langwierige Zulassungsverfahren (z.B. Novel-Food-Verordnung) durchlaufen.
Dennoch ist die Branche im Aufwind: Laut dem Deutschen Startup Monitor und aktuellen Zahlen des Startup-Verbands stiegen die Gründungszahlen 2025 um beachtliche 29 Prozent. Das Kapital ist da, doch es fließt selektiv. Investor*innen suchen heute keine reinen Ideen mehr, sondern validierte Geschäftsmodelle mit technologischem Tiefgang (DeepTech). Genau hier setzte das Finale des Growth Alliance Accelerator 2025 am 28. Januar 2026 in Frankfurt/Main an.
Brückenschlag zwischen Acker und Finanzwelt
Initiiert vom TechQuartier und der Landwirtschaftlichen Rentenbank, hat sich der Accelerator als Schmiede für die „Scale-up“-Phase etabliert. Vier Monate lang wurden zehn Start-ups, die bereits eine Nutzer*innenbasis vorweisen konnten, fit für die nächste Finanzierungsrunde gemacht.
Das Programm adressierte genau die Pain Points der Branche: Verhandlungstaktik, Rechtsfragen und vor allem den Zugang zu Kapital. Ein Highlight war das Investor Dinner im November 2025, bei dem die Gründer*innen direkten Zugang zu Risikokapitalgeber*innen erhielten – in der aktuellen Marktphase ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.
Die „Class of 2025“: Wer die Transformation treibt
Die zehn Absolvent*innen decken die gesamte Wertschöpfungskette ab – vom Boden über das Labor bis zum Supermarktregal. Hier ein Blick auf die Köpfe hinter den Innovationen:
1. High-Tech auf dem Acker: Robotik und Daten
Die Digitalisierung der Landwirtschaft (Smart Farming) ist der stärkste Hebel für mehr Effizienz.
Paltech GmbH
Die Brüder Felix und Florian Schiegg gründeten 2022 Paltech zusammen mit Jorge Decombe im Allgäu. Ihr autonomer Roboter für chemiefreie Unkrautbekämpfung im Grünland ist eine Antwort auf strengere Pestizid-Gesetze und Personalmangel.
Bacchus Software GmbH
Das 2023 gegründete Start-up bacchus Weinbau-Software um das Trio Maximilian Dick, Julian Herrlich und Philipp Bletzer digitalisiert den Weinbau. Ihre Software ersetzt das händische Fahrtenbuch und koordiniert die komplette Weinbergsarbeit.
Agrario Energy
Die Energiewende macht Landwirt*innen zu Energiewirt*innen. Seit 2023 bieten die Gründer Alexander von Breitenbach und Chris Weber mit Agrario Energy eine unabhängige Vergleichsplattform, die Flächeneigentümer mit Betreiber*innen von Erneuerbare-Energien-Anlagen zusammenbringt.
2. Deep Tech & Sicherheit: Das Labor als Wächter
Lebensmittelsicherheit wird durch globale Lieferketten immer komplexer. Hier setzen wissenschaftsbasierte Ausgründungen an.
NanoStruct GmbH
NanoStruct wurde 2021 als Spin-off der Universität Würzburg gegründet. Das Team nutzt Nanotechnologie, um gefährliche Bakterien in Lebensmitteln in Minuten statt Tagen aufzuspüren.
SAFIA Technologies
Gegründet 2020 von Timm Schwaar (aus der Bundesanstalt für Materialforschung), entwickelt das Berliner Start-up SAFIA Technologies Schnelltests für Mykotoxine (Schimmelpilzgifte). Ihre Technologie ermöglicht Laborqualität im Schnelltest-Format.
Landman.Bio
Das noch junge Unternehmen (Gründung 2023) Landman.Bio nutzt Bakteriophagen (Viren, die Bakterien fressen) als natürliche Waffe gegen Pflanzenkrankheiten – eine dringend benötigte Alternative zu Antibiotika und klassischen Pestiziden in der Nutzpflanzenzucht.
3. Sustainability & Climate: Kohlenstoff als Währung
CO2-Tracking ist kein Marketing-Gimmick mehr, sondern ökonomische Notwendigkeit.
CinSOIL
Das 2024 in Berlin gegründete CinSOIL-Team um Dr. Giorgi Shuradze, Dr. Antonella Succurro und Dr. Tavseef Shah kommt aus der Wissenschaft. Ihr KI-Tool nutzt Satellitendaten, um Bodenkohlenstoff zu erfassen. Das ermöglicht Agrarunternehmen, Dekarbonisierung nicht nur zu behaupten, sondern zu beweisen.
Niatsu
Gegründet 2023 von Marius Semm und Jakob Tresch in Zürich, adressiert Niatsu die Lebensmittelindustrie. Ihre Software berechnet den Product Carbon Footprint (PCF) automatisiert und kostengünstig, was gerade für den Mittelstand entscheidend ist.
4. Future Food
Was wir morgen essen (und trinken).
VANOZZA
Eines der etabliertesten Start-ups der Runde. Gegründet 2019 von Nico Hansen in Hamburg, hat sich Vanozza mit fermentierten Käsealternativen auf Cashew-Basis einen Namen gemacht und arbeitet nun an der „zweiten Generation“ ihrer Produkte.
food42morrow/JUMA
Die Frankfurter Gründer Raoul und Max Kammann sowie Carlos Lopez Granado gründeten die GmbH bereits 2020 und brachten 2022 ihre Marke JUMA (Tee-Eistees auf Guayusa-Basis) auf den Markt. Sie bedienen den Trend zu „Functional Food“.
Fazit
Die AgriFood-Start-ups des Abschlussjahrgangs des Growth Alliance Accelerators 2025 haben die Phase der reinen Ideen-Findung bereits eindrucksvoll gemeistert. Jetzt geht es um Skalierung, industrielle Anwendung und messbaren Impact. Programme wie die Growth Alliance sind dabei der Katalysator, der wissenschaftliche Exzellenz mit dem nötigen Geschäftssinn verbindet.
E-Mail-Betrug mit KI erfolgt in Sekunden
Der Incident Response Report 2026 zeigt eindrucksvoll, dass Cyberangriffe schneller, leiser und menschlicher geworden sind.

Bei einem bekannten Absender mit einer üblichen Rechnung würden die Meisten den Freigabeprozess starten. Erst im Nachhinein fällt auf, dass das Geld an Verbrecher*innen geschickt worden ist. Doch das Eindringen ins System durch die Angreifer*innen fand bereits weit davor statt. Unbemerkt konnten sie mitlesen, E-Mails verschieben und Antworten vorbereiten.
Genau solche Sicherheitsvorfälle hat das europäische Cybersecurity-Unternehmen Eye Security erstmals systematisch ausgewertet. Der neue Incident Response Report 2026 basiert auf 630 realen Cybervorfällen zwischen 2023 und 2025 bei europäischen Unternehmen, darunter zahlreiche aus Deutschland. Auf dessen Grundlage lassen sich Trends ableiten.
Bleiben Attacken unbemerkt, droht hoher Schaden
In einem der untersuchten Vorfälle waren Angreifer*innen in der Lage, rund eine Million Euro zu erbeuten. Besonders auffällig: die Hacker waren 72 Tage unentdeckt im System des Unternehmens unterwegs. Diese hatten es gezielt auf europäische Mittelständler abgesehen, die international tätig sind. Als Einfallstor diente dabei eine Phishing-Mail mit einem schadhaften Link, auf den Mitarbeiter*innen in der Finanzabteilung hereingefallen sind.
Die Angreifer*innen gingen dabei nach einem bekannten Muster vor und waren über Wochen in der Lage, sich mit den Lieferketten des Unternehmens vertraut zu machen. Sie hatten vollständige Einblicke in das E-Mail-Konto und konnten falsche Rechnungen erstellen, die in der Folge regulär bezahlt worden sind. Dank des Rückgriffs auf eine Plattform, die als Phishing-as-a-Service funktioniert, war der technische Aufwand hinter der Aktionen gering und erforderte kaum Vorwissen.
Angriffe beginnen mitten im Arbeitsalltag
Cyberangriffe sind heute leise, schnell und identitätsbasiert. Angreifer*innen müssen Systeme kaum noch technisch hacken. Stattdessen nutzen sie Vertrauen, legitime Zugänge und menschliche Routinen – vor allem E-Mail-Kommunikation und Benutzerkonten. Über 70 Prozent aller untersuchten Vorfälle entfielen auf sogenannte Business-Email-Compromise-Angriffe (BEC). In mehr als 40 Prozent der Fälle reichte ein einziger Phishing-Moment, um Zugriff zu erhalten: ein gut gemachter Link, eine täuschend echte Nachricht, ein kurzer Moment der Unachtsamkeit.
Erschreckenderweise entsteht der eigentliche Schaden oft innerhalb von Minuten. Der Angriff wird aber erst Tage oder sogar Wochen später bemerkt. Ohne kontinuierliche Überwachung bleiben kompromittierte E-Mail-Konten im Median 24 Tage unentdeckt. In dieser Zeit lesen Angreifer*innen unbemerkt mit, verschieben E-Mails, verändern Zahlungsdetails oder bereiten den nächsten Schritt vor, während im Unternehmen ganz normal weitergearbeitet wird.
Identitäten als die Hauptangriffsfläche
Laut Report greifen Täter*innen dort an, wo Vertrauen im Arbeitsalltag entsteht und geben sich als Kolleg*innen, Dienstleister*innen oder Vorgesetzte aus, übernehmen bestehende Sitzungen oder bringen Mitarbeitende dazu, Anmeldungen selbst zu bestätigen. So wird selbst Multi-Faktor-Authentifizierung ausgehebelt: Seit Anfang 2025 gelang das in 62 Prozent der untersuchten Fälle, etwa weil Nutzer*innen auf Phishing hereinfallen, ungewollt eine Anmeldung bestätigen oder weil Angreifer bereits in einer laufenden Sitzung „mitlaufen“. Von außen sieht alles korrekt aus. Genau das macht diese Angriffe so schwer zu erkennen.
Ransomware: die digitale Form einer Geiselnahme
Mittels Ransomware-Angriffe verschaffen sich Verbrecher*innen Zugriff auf die IT eines Unternehmens und sperren Systeme, Dateien oder ganze Netzwerke. Auf den Bildschirmen erscheint dann eine Nachricht: Der Zugriff wird nur wieder freigegeben, wenn ein Lösegeld gezahlt wird – die durchschnittliche Lösegeldforderung lag laut Report bei rund 613.000 US-Dollar, einzelne Forderungen überschritten die Millionengrenze.
Laut ENISA Report ist Ransomware nach wie vor die größte Bedrohung in Europa mit 81,1 % der gesamten Attacken. Darin wird auch auf die Fragmentierung hingewiesen, da 82 verschiedene Ransomware-Varianten im Einsatz sind. Allerdings sind im Trend Report signifikant weniger solcher Fälle registriert, da dank Managed Detection and Response (MDR) Präventivmaßnahmen Schutz bieten.
Entgegen der verbreiteten Vorstellung sind Ransomware-Angriffe keine Hightech-Hacks. Meist beginnen sie mit ganz alltäglichen Schwachstellen:
- Öffentlich erreichbare Anwendungen (30 % der Fälle), die nicht richtig abgesichert oder aktualisiert sind.
- Unsichere Fernzugänge wie VPN oder RDP (17 %), über die sich Angreifer direkt einloggen können.
- Phishing (13 %), bei dem Mitarbeitende unbemerkt Zugangsdaten preisgeben.
Besonders häufig traf es Unternehmen aus Industrie, Bauwesen sowie Transport und Logistik. Der Grund ist simpel: Zeit ist dort Geld. Jede Stunde Stillstand verursacht sofort spürbare wirtschaftliche Schäden.
Erkennung der Angriffe kann auf wenige Minuten reduziert werden
Der Report zeigt eine deutliche Trennlinie zwischen Unternehmen mit und ohne kontinuierliche Angriffserkennung:
- In Umgebungen mit Managed Detection & Response (MDR) sinkt die Erkennungszeit bei BEC-Angriffen von über 24 Tagen auf 23,8 Minuten.
- Die Bearbeitungszeit pro Vorfall reduziert sich um bis zu 90 Prozent.
- Angriffe werden häufig gestoppt, bevor es zu finanziellen Schäden kommt.
Die zentrale Botschaft des Incident Response Reports 2026: Cyberangriffe sind schneller, leiser und menschlicher geworden. Klassische Schutzmaßnahmen allein reichen nicht mehr aus, wenn Angreifer innerhalb weniger Minuten handlungsfähig sind. Unternehmen wird deshalb ein Perspektivwechsel empfohlen: nicht warten, bis etwas kaputtgeht, sondern davon ausgehen, dass jemand bereits mitliest. Identitäten müssen genauso ernst genommen werden wie Systeme.
Was der/die Einzelne tun kann und woran sich kompromittierte E-Mail-Konten erkennen lassen
Kompromittierte E-Mail-Konten fallen selten durch offensichtliche Warnsignale auf, sondern meist durch kleine Abweichungen im Arbeitsalltag. E-Mails verschwinden plötzlich aus dem Posteingang, Gesprächsverläufe wirken unvollständig oder Antworten landen unerwartet in Unterordnern. Häufig haben Angreifer unauffällige Regeln angelegt, um Kommunikation abzufangen und umzuleiten – ohne aufzufallen.
Auch der Tonfall kann sich verändern. Antworten klingen vertraut, aber nicht ganz wie gewohnt: etwas knapper, ungewohnt förmlich oder mit kleinen Abweichungen in Anrede und Gruß.
Besonders kritisch sind beiläufige Änderungen bei Rechnungen oder Zahlungsdaten. Eine neue Bankverbindung oder eine „kurze Aktualisierung“ mit der Bitte um schnelle Freigabe wirkt harmlos, ist aber ein typisches Muster. Weitere Hinweise liefern Login-Benachrichtigungen zu ungewöhnlichen Zeiten, Zugriffe aus anderen Ländern oder MFA-Anfragen, die niemand bewusst ausgelöst hat. Solche Meldungen werden im stressigen Alltag oft weggeklickt, dabei sind sie häufig die ersten konkreten Anzeichen für einen laufenden Angriff.
Hinzu kommen Rückmeldungen aus dem Team. Aussagen wie „Die E-Mail sah echt aus, aber irgendwas war komisch“ oder „Ich dachte, das wärst wirklich du“ tauchen in vielen Vorfällen auf.
Abschließend bleibt eine der wichtigsten Erkenntnisse aus der Incident-Response-Praxis: Kompromittierte E-Mail-Konten fühlen sich selten wie ein Angriff an. Sie fühlen sich an wie ganz normale Arbeit, mit kleinen Ungereimtheiten. Wer diese ernst nimmt und früh prüft, gewinnt wertvolle Zeit. So können Angriffe gestoppt werden, bevor echter Schaden entsteht.
metergrid: Stuttgarter Start-up sammelt 10 Mio. Euro für Mieterstrom-Plattform ein
Das 2021 gegründete metergrid ist auf Software- und Abwicklungslösungen für sogenannte Mieterstrommodelle spezialisiert. Die Runde ist laut metergrid die bislang größte Wachstumsfinanzierung im deutschen Mieterstrom-Markt.

Das 2021 gegründete EnergyTech-Start-up metergrid hat eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Mio. Euro abgeschlossen. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich dabei um die bislang größte Wachstumsfinanzierung im deutschen Mieterstrom-Markt. Angeführt wird die Runde von dem niederländischen Investor SET Ventures. Auch die Bestandsinvestoren Hager, LBBW Venture Capital, Mätch VC sowie mehrere Business Angels beteiligten sich erneut.
Metergrid ist auf Software- und Abwicklungslösungen für sogenannte Mieterstrommodelle spezialisiert. Diese ermöglichen es, Solarstrom von Dächern mehrgeschossiger Wohngebäude direkt an die Bewohner zu verkaufen. Das Stuttgarter Unternehmen konnte die Zahl der versorgten Bewohner*innen nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr von rund 10.000 auf über 53.000 steigern.
Ausbau zur Gesamtplattform geplant
Mit dem frischen Kapital plant das Unternehmen, sein Geschäftsmodell von einer reinen Abrechnungslösung zu einer umfassenden Energie-Plattform für Mehrparteienhäuser auszubauen. Ziel sei es, neben Photovoltaik-Anlagen künftig auch Ladeinfrastruktur für E-Mobilität, Energiemanagementsysteme, Speicherlösungen sowie Heiz- und Nebenkostenabrechnungen über eine zentrale Software abzuwickeln.
„Wir machen Energieversorgung im Mehrparteienhaus erstmals automatisiert, wirtschaftlich und massentauglich“, erklärte Johannes Mewes, Co-Founder und Geschäftsführer von metergrid. Bis zum Jahr 2030 will das Unternehmen nach eigenen Angaben eine Million Menschen in Mehrparteienhäusern mit erneuerbarer Energie versorgen.
Hürden beim Mieterstrom
Rund 44 Mio. Menschen in Deutschland leben in Mehrparteienhäusern. Die Umsetzung von lokalen Energiekonzepten scheiterte dort bislang oft an komplexen regulatorischen und administrativen Hürden. Metergrid adressiert dieses Marktsegment, indem es Vermietern, Wohnungseigentümergemeinschaften und Wohnungsbaugesellschaften die bürokratische Abwicklung – von der behördlichen Anmeldung bis zur Abrechnung mit den Mietern – abnimmt.
Dr. Till Stenzel, Partner beim Lead-Investor SET Ventures, sieht in der Lösung das Potenzial, den Markt für urbane Energieversorgung zu erschließen: „Mehrparteienhäuser konnten bisher noch praktisch gar nicht an der Energiewende teilnehmen – metergrids Lösung sorgt hier für eine ganzheitliche, volldigitalisierte Lösung.“
b2venture legt 150 Millionen Euro Fonds auf
b2venture, ein europäischer Early-Stage-Investor, hat Fonds V erfolgreich am Hard Cap von 150 Mio. Euro geschlossen, um gezielt in Frühphasen-Start-ups zu investieren.

b2venture wurde im Jahr 2000 gegründet und verfolgt seitdem einen klaren Ansatz: konsequent gründerorientierte und mit langfristiger Perspektive investieren. Fonds V setzt diese Linie fort und knüpft an das intergenerationale Modell an, bei dem erfolgreiche Gründer*innen selbst zu Investor*innen werden und ihre Erfahrung, Netzwerke und ihr Kapital an junge Gründungsteams weitergeben. Dieses Prinzip trägt inzwischen fünf b2venture-Fondsgenerationen und unterstreicht damit die Stärke und Skalierbarkeit des community-basierten Modells.
Starke Limited Partners und mehr als 350 AngelInvestor*innen
Jetzt legt b2venture den größten Fonds seiner 25-jährigen Geschichte auf und investiert mit Fonds V in skalierbare, resiliente Technologien sowie digitale Geschäftsmodelle in der Frühphase. b2ventures Fonds V baut auf eine starke, breit aufgestellte Investorenbasis: langjährige und neue Limited Partners wie Family Offices, institutionelle Investor*innen und high-net-worth Individuals. Viele von ihnen begleiten b2venture bereits über mehrere Fondsgenerationen hinweg. Zu den neuen Limited Partners zählen unter anderem Flexstone, der Schweizer Pensionsfonds Stiftung Abendrot, Portfolio-Unternehmer wie Thomas Hagemann (SevenSenders) sowie langjährige b2venture Super Angels wie Joachim Schoss.
Ein Alleinstellungsmerkmal der Investor*innenbasis ist eine starke Community aus über 350 erfahrenen Angel-Investoren, die den Fonds aktiv unterstützt. Die Angel-Investor*innen investieren gemeinsam mit b2venture und bringen ihre Erfahrung aus dem Aufbau und der Skalierung erfolgreicher Unternehmen ein.
25 Jahre Early-Stage-Erfahrung mit Community-Fokus
Seit mehr als 20 Jahren begleitet b2venture den Aufbau europäischer Tech-Unternehmen, darunter DeepL, 1KOMMA5°, Raisin, SumUp, Nelly und Urban Sports Club. Die Bilanz: mindestens ein Unicorn pro Fonds, 11 IPOs und die langfristige Begleitung hunderter Founder-Teams. Im Jahr 2025 verzeichnete b2venture einen IPO (Navan) und sieben weitere Exits, darunter Araris Biotech, Beekeeper sowie zuletzt Neptune (Übernahme durch OpenAI).
Erste Investments Fonds V
Mit Fonds V plant b2venture Investitionen in rund 35 Early-Stage-Startups in ganz Europa, mit Fokus auf skalierbare und langfristig tragfähige Technologien. Zu den ersten Investments von Fonds V gehören Unternehmen wie:
- Nautica Technologies, das autonome Schwarmroboter im Abonnementmodell zur Reinigung von Schiffsrümpfen anbietet,
- Hive Robotics, eine KI-gestützte Plattform für autonome Systeme, die eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Luft-, Land- und See-Einheiten ermöglicht,
- Augmented Industries, eine KI-gestützte Plattform, die Industriefachkräften hilft, komplexes Wissen dokumentieren und Probleme effizienter lösen sowie
- Assemblean, eine Production-as-a-Service-Plattform für die effiziente Fertigung komplexer Produkte.
Diese Investments unterstreichen den Fokus auf DeepTech sowie Industrie-, Automatisierungs- und Infrastrukturunternehmen – mit Fokus auf KI und Robotik.
„Venture Capital ist vor allem ein People Business“, sagt Jan-Hendrik Bürk, Partner bei b2venture. „Unsere Angel-Community spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie unterstützt uns bei der Auswahl und Unterstützung von Teams, die langfristig erfolgreiche Tech-Companies aufbauen. Mit Fonds V stärken wir dieses Modell weiter, mit echter fachlicher Expertise und nicht nur mit Kapital.“
„Wir brauchen Kundenfeedback – aber bitte nicht so, dass es uns ausbremst!“
Wie Kundenfeedback – richtig eingeholt und aufgesetzt – für Start-ups zum Entscheidungsbeschleuniger statt zum Bremsklotz wird.

In Start-ups gibt es einen besonderen Takt. Entscheidungen werden oft zwischen zwei Meetings getroffen, Produktanpassungen noch am selben Tag live geschaltet und neue Ideen lieber ausprobiert als endlos diskutiert. Viele beschreiben das sogar als Überlebensstrategie. Feedback von Kunden und Mitarbeitern klingt dabei oft wie ein notwendiges Übel: wichtig, aber zeitaufwendig. Viele Gründerinnen und Gründer haben deshalb eine Sorge: „Wenn wir jetzt anfangen, systematisch Kundenfeedback einzuholen, verlieren wir Tempo.“
Ein Gastbeitrag von Dennis Wegner, Gründer und Geschäftsführer von easyfeedback GmbH.
Meine Erfahrung aus der Arbeit mit tausenden Unternehmen zeigt: Das Gegenteil ist der Fall. Kundenfeedback lässt sich oft innerhalb von zwei Wochen einholen und auswerten. Und richtig aufgesetzt, wird es zum Entscheidungsbeschleuniger statt zum Bremsklotz.
Ohne Feedback treffen Start-ups Entscheidungen auf Basis von Annahmen. Und Annahmen sind in frühen Wachstumsphasen besonders riskant: Man skaliert Funktionen, Prozesse oder Marketingbotschaften, ohne wirklich zu wissen, ob sie beim Kunden ankommen. Diese Logik ist beispielsweise besonders kritisch in der frühen Produktentwicklung. In der MVP-Phase entscheiden wenige Stellschrauben darüber, ob ein Produkt später relevant ist oder nicht.
Wie Struktur Tempo bringt statt es zu bremsen
Der entscheidende Hebel ist Struktur. Nicht mehr Feedback, sondern das richtige Feedback: ein klares Ziel, eine klar definierte Zielgruppe und präzise formulierte Fragen. Wenn ich weiß, was ich wissen will, kann ich Feedback gezielt einsetzen, um schneller zu einer Entscheidung zu kommen.
Ein Beispiel: Statt eine breite Zufriedenheitsumfrage zu starten, sollte die zentrale Frage etwa lauten:
„Was hat Sie fast davon abgehalten, unser Produkt zu kaufen?“
Diese eine Frage liefert oft mehr Entscheidungsrelevanz als 20 Fragen mit festgelegten Antwortstufen. Sie spart Zeit, weil sie den Fokus schärft. Teams diskutieren dann nicht mehr abstrakt über Meinungen, sondern über konkrete, wiederkehrende Muster.
Struktur reduziert also Komplexität. Und weniger Komplexität bedeutet: mehr Geschwindigkeit.

Welche Feedbacks Start-ups wirklich brauchen
Nachfolgend vier Bereiche, die für junge Unternehmen besonders wertvoll sind:
1. Kauf- und Absprunggründe
Warum entscheiden sich Kunden für oder gegen euch? Diese Erkenntnisse sind Goldwert für Produkt, Pricing und Marketing.
2. Onboarding-Erfahrungen
Wo hakt es in den ersten Tagen? Alles, was hier unklar bleibt, kostet später Zeit und Nerven.
3. Nicht genutzte Features
Was ihr entwickelt habt, aber nicht genutzt wird, bindet Ressourcen ohne Mehrwert zu schaffen.
4. Erwartungen vs. Realität
Wo klaffen Marketingversprechen und tatsächliche Nutzung auseinander? Genau hier entstehen Enttäuschung.
Wichtig dabei: Quantitative Bewertungen liefern Hinweise, aber die offenen Antworten liefern die Erklärung. Sie zeigen, warum etwas funktioniert oder scheitert.
Warum Skalierung ohne Feedback teuer wird
Viele Start-ups wachsen erst und fragen später nach Feedback. Das ist ein gefährlicher Fehler. Denn je größer ein Unternehmen wird, desto teurer werden falsche Entscheidungen. Ein schlecht erklärtes Feature mag bei 50 Kunden kaum auffallen. Bei 5.000 Kunden explodieren Supportanfragen. Bei 50.000 Kunden wird daraus ein massives Kostenproblem.
Ohne strukturiertes Feedback wird oft an Symptomen gearbeitet statt an Ursachen. Teams optimieren Prozesse und bauen neue Features, ohne zu wissen, ob sie damit das eigentliche Problem lösen. Feedback wirkt hier wie ein Frühwarnsystem. Es zeigt Schwachstellen, bevor sie teuer werden. Und es ermöglicht Kurskorrekturen, solange sie noch wenig Aufwand verursachen.
Feedback als Entscheidungsbeschleuniger
Der größte Denkfehler ist, Feedback als Diskussionsgrundlage zu sehen. Richtig eingesetzt ist es eine Entscheidungshilfe. Wenn klare Fragen gestellt werden, entstehen klare Antworten. Wenn Antworten systematisch ausgewertet werden, entstehen Muster. Und Muster schaffen Sicherheit.
Start-ups, die Feedback ernst nehmen, entscheiden nicht langsamer. Sie entscheiden besser. Und oft schneller, weil sie weniger raten müssen.
Mein Rat an Gründerinnen und Gründer
Habt keine Angst vor Feedback. Habt Angst vor Entscheidungen ohne Feedback. Startet klein. Stellt eine einzige Frage, deren Antwort ihr wirklich braucht. Hört genau hin auch wenn es unbequem ist. Und setzt das Gelernte konsequent um. Dann wird Kundenfeedback nicht zur Bremse, sondern zum Motor für Wachstum.
Der Autor Dennis Wegner ist Geschäftsführer von easyfeedback GmbH.
to teach: Vom KI-Hype zur Schulinfrastruktur
Wie das 2022 gegründete EdTech to teach die Lücke zwischen Chatbot und Klassenzimmer schließt.

Vor drei Jahren begann mit dem öffentlichen Zugang zu generativer künstlicher Intelligenz ein weltweiter Hype, der auch vor den Schultoren nicht haltmachte. Doch im Bildungsmarkt entscheidet sich derzeit, ob die Technologie tatsächlich Produktivität schafft oder in einer digitalen Sackgasse endet. Das Hamburger EdTech to teach liefert hierzu eine Blaupause: Was 2022 als Experiment begann, hat sich innerhalb von drei Jahren zu einer Arbeitsplattform für hunderttausende Lehrkräfte entwickelt.
Das Problem: US-Tools verstehen deutsche Schulen nicht
Als generative KI erstmals verfügbar wurde, wirkte ihr Einsatz im Bildungsbereich naheliegend. Doch der Blick auf die internationale Konkurrenz zeigt das Dilemma: Während US-Platzhirsche wie MagicSchool AI oder Diffit den Markt mit hunderten Mikro-Tools fluten und technisch beeindrucken, fehlt ihnen der kulturelle Fit. „Einfach nur Texte aus ChatGPT zu kopieren, löst kein einziges Problem von Lehrkräften“, erklärt Felix Weiß, Co-Founder und CEO von to teach.
Die Diskrepanz zwischen dem Versprechen der KI und dem tatsächlichen Schulalltag war groß. US-Lösungen scheitern oft an spezifischen deutschen Lehrplänen oder liefern reine Multiple-Choice-Formate, die hierzulande kaum Anwendung finden. Lehrkräfte benötigten keine unstrukturierten Textwüsten, sondern didaktisch saubere, lehrplankonforme und sofort einsetzbare Materialien. Genau hier setzte das 2022 von Felix Weiß und Marius Lindenmeier gegründete Unternehmen an.
Der Pivot: Datenschutz als Burggraben
Der entscheidende Wendepunkt kam 2023. Das Start-up vollzog einen Strategiewechsel (Pivot) weg von einer SaaS-Lösung für Verlage hin zu einer direkten Plattform für Lehrkräfte. Anstatt Nutzer*innen mit freien Eingabefeldern (Prompts) allein zu lassen, entwickelte das Team feste Arbeitsblattvorlagen. Dies wurde zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber internationalen Anbietern: Während diese oft an der strikten DSGVO scheitern, bietet to teach durch Serverstandorte in der EU und Rechtssicherheit eine Lösung, die Schulträger akzeptieren.
Dabei mussten technische Kinderkrankheiten überwunden werden: Frühe KI-Modelle „halluzinierten“ Fakten. To teach reagierte mit der systematischen Integration von Quellen und profitierte zugleich von der rasanten Evolution der Sprachmodelle.
Skalierung im Ökosystem gegen nationale Konkurrenz
Der Markt nahm die Lösung schnell an: Im Januar 2023 meldete sich der erste Nutzer an, bis Ende des Jahres waren es laut Unternehmen bereits knapp 16.000 Lehrkräfte. Das Jahr 2024 markierte dann den Übergang vom Start-up zur Plattform: Durch die Übernahme von fobizz (101skills GmbH) wurde to teach Teil eines größeren Bildungsökosystems. Die Gründer blieben als Geschäftsführer an Bord.
Dieser Schritt war strategisch überlebenswichtig in einem sich konsolidierenden Markt. Einerseits gegenüber agilen Herausforderern, da Konkurrenten wie schulKI, Teachino, KIULY oder Kuraplan zum Teil aggressiv um Landeslizenzen kämpfen bzw. auf dem Markt für KI-gestützte Unterrichtsplanung und Materialerstellung durchgestartet sind.
Andererseits war der Schritte in Hinblick auf etablierte Verlage notwendig. Denn Häuser wie Cornelsen ziehen inzwischen mit eigenen KI-Assistenten nach, sperren ihre Inhalte jedoch oft in geschlossene Systeme, d.h. binden sie oft an die eigenen Verlagswerke.
Durch die erfolgreiche Integration in fobizz ist to teach kein isoliertes Insel-Tool mehr, sondern profitiert von bestehenden Landesrahmenverträgen und einem riesigen Vertriebsnetz. Die Nutzer*innenzahlen explodierten förmlich auf über 140.000 Lehrkräfte bis Ende 2024, so die Angaben von to teach.
Status Quo 2025: KI als neue Infrastruktur
Heute, im dritten Jahr nach der Gründung, hat sich der Fokus erneut verschoben. To teach versteht sich inzwischen als Arbeitsinfrastruktur. Die Zahlen unterstreichen diesen Anspruch: Nach Angaben von to teach nutzen über 300.000 Lehrkräfte die Plattform, und mehr als 4.000 Schulen sind angebunden. Das bedeutet: Millionen von Inhalten wurden so bereits KI-gestützt vorbereitet.
Das Unternehmen treibt nun den systematischen Schulvertrieb voran. Damit beweisen EdTechs wie to teach, dass sich Qualität und Personalisierung im sonst oft als innovationsresistent geltenden Bildungsmarkt skalieren lassen.
Für CEO Felix Weiß ist die Diskussion über das „Ob“ längst beendet: „Die Frage ist nicht mehr, ob KI im Klassenzimmer ankommt, sondern, wie und auf welche Weise sie dort wirklich hilft.“
Das False-Hope-Syndrom
Neujahrs-Parolen vs. harte Führungsrealität: Mit welchem Führungsstil willst du dein Unternehmen 2026 weiterbringen?

Der Spruch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ mag tapfer klingen, dient in der Praxis aber als bequemer Deckmantel für Führungskräfte, die Aufschub, Inkonsequenz und Selbstbetrug rechtfertigen wollen.
Ben Schulz, Gründer der Ben Schulz & Partner AG und Unternehmensberater, fordert: „Es braucht einen kompromisslosen Realitätscheck gegen das False-Hope-Syndrom als unterschätzte Gefahr für Unternehmen im Mittelstand.“ Besonders im Jahr 2026, das als gnadenloser Stresstest durch Digitalisierung, Fachkräftemangel und KI-Herausforderung gilt, sind klare Entscheidungen statt blinder Zuversicht Pflicht.
Wenn Optimismus zur tödlichen Droge wird
Seit Langem lässt sich bei vielen Geschäftsführern ein bedrohliches Muster beobachten: Sie wirken nach außen mit großen Reden, motivierenden Botschaften und Neujahrsversprechen optimistisch, während sie innerlich ausgebrannt durch Krisen stolpern. Das False-Hope-Syndrom beschreibt diesen Kreislauf präzise, ein kurzer Rausch aus überhöhten Erwartungen und Motivation, gefolgt vom harten Crash, wenn die Realität zuschlägt. „Hoffnung verpufft nicht zuletzt, sondern sie stirbt zuerst und zieht dabei die gesamte Veränderungsenergie in den Abgrund, was in Zynismus und der klassischen Ausrede ‚Wir hatten doch gute Ansätze‘ endet“, so der Experte. In Wahrheit waren es selten mehr als leere Ankündigungen ohne echte Umsetzung.
Führungstheater: Plakate statt Kante
Im Mittelstand tritt diese Erkrankung besonders häufig auf, wo Führungskräfte zu Wandplakaten, Leitbild-Dekoration und Führungstheater greifen, anstatt schmerzhafte Entscheidungen zu treffen. „Seit Jahren sehe ich das Muster: Geschäftsleiter hoffen sich durch Krisen, statt zu entscheiden“, erklärt Schulz aus jahrelanger Berufserfahrung. Zum Jahreswechsel kulminieren die Symptome in Phrasen wie „2026 wird unser Jahr“, die ohne klare Ziele, Ressourcen und Verzichtsbereitschaft nicht als Feigheit mit neuem Datum kaschieren. Der Experte weiß: „2026 wird Stresstest pur. Ohne Mut zum Schnitt – Budgets kürzen, Blocker raus, Projekte killen – wartet nur der Kollaps.“
Neujahrs-Blindheit entschleiert
Echte Führung entfaltet sich genau dort, wo Bequemlichkeit endet, nämlich bei Entscheidungen, die Energie fressende Projekte stoppen, blockierende Personen entfernen oder Budgets radikal kürzen – Fokus entsteht durch Verzicht. Mit dem Konzept „Hope & Trust Leadership“ verankert Ben Schulz Zuversicht fest in der Realität und liefert einen klaren Leitfaden für 2026, fernab jeder Kuschelmentalität. Es koppelt Hoffnung an sichtbare, wiederholbare Erfolge und macht sie somit greifbar. „Ich habe diese toxischen Verhaltensmuster auch schon selbst erlebt und teuer bezahlt“, gibt Schulz ehrlich zu. „Verschleppte Entscheidungen zerstören mehr als sie aufbauen.“ Statt Parolen braucht es Führungskräfte, die falsche Hoffnung mutig beenden und echte Hoffnung durch Taten stärken.
Drei klare Regeln für 2026:
Regel 1: Preis vor Hoffnung
Jede neue Vision erfordert einen sichtbaren Lohn wie personelle Säuberung, Kostensenkung oder Strategie-Radikalcut – ohne Schmerz bleibt sie Illusion.
Regel 2: Motivationsnebel verboten
Kein „Wir schaffen das!“ ohne präzise Antworten: Was genau? Bis wann? Mit wem? Worauf verzichten? Emotionaler Spam zerstört Vertrauen.
Regel 3: Hoffnung als messbare Leistung
Es gilt die Flur-Stimmung zu vergessen. Entscheidend sind Zielklarheit, Konsequenz und Taten, die halten, was sie versprechen.
Optocycle: Bauschutt-Recycling auf KI-Basis
Die Optocycle-Gründer Max-Frederick Gerken und Lars Wolff Optocycle zeigen, wie aus Bauschutt neuer Rohstoff wird und erhalten dafür eine Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Jährlich fallen in Deutschland laut Umweltbundesamt rund 86 Mio. Tonnen Schutt und Abfälle auf Baustellen an. Häufig landen diese Materialien auf Deponien. So gehen allerdings wertvolle Ressourcen verloren. Der Ausweg: Ein hochqualitatives Recycling des Schutts vermeidet klimaschädliche Emissionen und hält wertvolle Materialien im Wertstoffkreislauf – und das bei zertifiziert gleichwertiger Qualität.
Um das Recycling von Material im Bausektor zu automatisieren, entwickelt das 2022 von Max-Frederick Gerken und Lars Wolff gegründete Start-up Optocycle aus Tübingen ein System auf Grundlage künstlicher Intelligenz (KI) zum Echtzeit-Monitoring.
Echtzeit-Monitoring im Recycling-Prozess
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert das Projekt mit rund 170.000 Euro. Im Rahmen der DBU-Green Startup-Förderung haben die Gründer ein KI-basiertes System zur automatischen, reproduzierbaren Klassifizierung von Bauabfällen entwickelt. Darauf aufbauend soll nun ein Prototyp das Echtzeit-Monitoring von RC-Körnungen – also recycelten Gesteinskörnungen aus Bauschutt – ermöglichen.
„Aktuell basiert in der Branche der Aufbereitungsprozess von Bauschutt meist auf subjektiven Schätzungen“, so Max-Frederick Gerken. Auch das Endprodukt werde nur stichprobenartig im Labor überprüft. Mit dem System sei „Echtzeitmonitoring von Recycling-Gesteinskörnungen möglich. Somit können die Qualität der Körnung verbessert und mehr Material in die Beton-Produktion überführt werden“, so Gerken.
Die Qualität von Sekundärrohstoffen verbessern
Das System kombiniert laut Gerken moderne, optische Sensorik mit KI – und löse so ein altbekanntes Problem in der Baubranche. „Zurzeit schwankt oft die Beschaffenheit der recycelten Rohstoffe. Das bedeutet einerseits ein wirtschaftliches Risiko für Unternehmen und führt andererseits zum Verlust von wertvollen Materialien“, so Gerken. Optocycle erwartet mithilfe seiner Entwicklung eine 20 Prozent höhere Menge an recycelten, hochqualitativen Gesteinskörnungen sowie 15 Prozent geringere Abfallreste, die sonst auf Deponien landen würden. Dazu werden nach Gerkens Angaben sowohl der eingehende Schutt „optimal klassifiziert“ als auch das Ergebnis transparent überprüft. Kooperationspartner ist hierbei die Heinrich Feeß GmbH, die laut Gerken bereits seit vielen Jahren mit Optocycle zusammenarbeitet. Der Mitgründer weiter: „Die Technologie leistet einen Beitrag für Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Wir helfen dabei, die Qualität von Sekundärrohstoffen zu verbessern, die aus dem Bauschutt gewonnen werden. Diese Lösung lässt sich zudem perspektivisch auf alle Abfallströme übertragen."
Das System von Optocycle kann Gerken zufolge direkt in bereits bestehende Anlagen zur Verarbeitung von Bauabfällen installiert werden – „direkt über dem Fließband.“ Diese einfache Nachrüstung spare Kosten und ermögliche die schnelle Umsetzung eines innovativen Bauschutt-Recyclings. „Denn nur wenn das Recycling finanziell machbar ist, kann die Kreislaufwirtschaft in der Baubranche Erfolg haben“, so Gerken.
Kreislaufwirtschaft in der Baubranche ist aktiver Klimaschutz
Kreislaufwirtschaft in der Baubranche hat nach den Worten des zuständigen DBU-Referenten Dr. Volker Berding wichtige Effekte für den Klimaschutz: „Die Produktion von immer neuem Beton sorgt für hohen Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen.“ Einer WWF-Studie zufolge entstehen bei der Herstellung von Zement – dem wichtigsten Bestandteil von Beton – acht Prozent der gesamten globalen Treibhausgasemissionen. Berding: „Alles, was zur einer Emissionsreduzierung beiträgt, hat also bereits einen großen Effekt für den Klimaschutz.“ Eine Kreislaufwirtschaft funktioniere jedoch nur, „wenn die Sekundärrohstoffe sich qualitativ nicht von einer Neuproduktion unterscheiden. Genau diesen Schritt kann Optocycle mit einem skalierbaren, optimierten Prototypen gehen.“
Astrogeografie: Die unterschätzte Macht der Orte
Wie die Standortfrage den Erfolg deiner Ideen mitbestimmt, erläutert Business-Astrologin Franziska Engel.

Manche Ideen scheinen wie von selbst zu wachsen, sobald sie an einem bestimmten Ort entstehen. Gespräche fließen leichter, Kooperationen ergeben sich im richtigen Moment und Entscheidungen fallen mit einer Klarheit, die sich kaum planen lässt. Und dann gibt es Orte, an denen das Gegenteil geschieht. Projekte stocken, Motivation sinkt und selbst gute Pläne fühlen sich schwer an.
Diese Unterschiede sind kein Zufall. Jeder Mensch steht in einer individuellen Beziehung zu bestimmten Orten. Diese Verbindung lässt sich astrogeografisch sichtbar machen und zeigt, wo persönliche Linien und Themen in Resonanz treten. Orte entfalten ihre Wirkung also nicht aus sich selbst heraus, sondern im Zusammenspiel mit der Person, die dort lebt oder arbeitet. Wer diese Zusammenhänge versteht, erkennt, dass Standortentscheidungen nicht nur von Zahlen abhängen, sondern auch von Resonanz.
Wenn Zahlen zu wenig sagen
In der Wirtschaft gilt die Standortwahl meist als nüchterne Rechenaufgabe. Es geht um Steuern, Infrastruktur, Fachkräfte oder Marktpotenziale. Doch diese Faktoren erklären nicht, warum manche Gründer*innen an einem Ort aufblühen, während sie an einem anderen stagnieren.
Als Business-Astrologin mit Fokus auf internationale Wirtschaft, beschäftige ich mich seit Jahren mit dieser Fragestellung. In meiner Arbeit verbinde ich wirtschaftliches Denken mit astrogeografischen Analysen, die zeigen, welche Orte mit den individuellen Anlagen und Potenzialen einer Person in Resonanz stehen. Dabei geht es nicht um allgemeine Zuschreibungen zu Ländern, Städten oder Regionen, sondern um den persönlichen Bezug zwischen Mensch und Ort.
Jeder Mensch hat ein eigenes energetisches Muster, das durch astrogeografische Linien sichtbar gemacht werden kann. Diese Linien zeigen, wo bestimmte Themen wie etwa Kreativität, Kommunikation, Wachstum oder Stabilität besonders aktiv werden.
Wer diese individuellen Zusammenhänge kennt, kann Standortentscheidungen bewusster treffen. Ein Ort kann dann gezielt gewählt werden, um eine bestimmte Entwicklungsphase zu unterstützen oder neue Impulse in ein bestehendes Projekt zu bringen.
Ein Ort, an dem Ideen nur so sprühen. Ein anderer, an dem sich plötzlich Klarheit einstellt. Oder ein dritter, an dem trotz aller Mühe nichts richtig funktioniert. Diese Erfahrungen kennt fast jede(r), der/die gründet oder neue Wege geht. Es geht hierbei nicht darum, einem Ort bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben. Entscheidend ist, wie dieser Ort mit dem eigenen astrologischen Muster in Verbindung steht. Erst daraus entsteht Resonanz oder Spannung.
Diese Resonanz kann sowohl auf die Standortwahl als auch auf die Gestaltung von Arbeitsräumen angewendet werden. Schon kleine Veränderungen können spürbar machen, ob sich jemand in seiner Energie bewegt oder dagegen arbeitet. Die Position eines Schreibtischs, die Blickrichtung, Licht oder Farben, all das beeinflusst, wie sich persönliche Linien am Ort entfalten können. Es ist faszinierend zu beobachten, wie sich die Atmosphäre verändert, sobald ein Raum in seiner Balance ist.
Wenn Ort und Mensch zusammenarbeiten
Erfolg entsteht dort, wo Menschen und Orte miteinander harmonieren. Wenn der Standort das stärkt, was jemand in die Welt bringen möchte, entsteht eine natürliche Leichtigkeit. Ideen fließen, Kommunikation wird klarer und Entscheidungen fallen mühelos. Diese Sichtweise gewinnt gerade jetzt an Bedeutung.
Immer mehr Gründer*innen arbeiten ortsunabhängig und leben in Bewegung. Sie wechseln Länder, Zeitzonen und Kulturen. Für sie ist die Frage nach dem richtigen Ort oft keine Entscheidung auf Dauer, sondern eine, die sich ständig neu stellt.
Es ist aber nicht nur wichtig, passende Standorte zu finden, sondern auch die Orte, an denen man sich bereits befindet, bewusst zu verstehen. Denn jeder Ort, an dem man sich aufhält, trägt eine bestimmte Resonanz im persönlichen System. Wer erkennt, welche Energie dort gerade wirkt, kann sie gezielt nutzen, ob zur Fokussierung, zur Inspiration oder für einen Neuanfang.
Gerade für digitale Nomad*innen, Freelancer*innen oder Unternehmer*innen, die regelmäßig unterwegs sind, kann dieses Wissen zum Schlüssel werden. Es geht nicht darum, ständig auf der Suche nach dem perfekten Ort zu sein, sondern die Qualität des jeweiligen Ortes zu erkennen und bewusst mit ihr zu arbeiten. Wenn Menschen verstehen, wie der Ort, an dem sie sich gerade befinden, mit ihnen in Resonanz steht, können sie viel freier und klarer handeln. Dann wird Bewegung selbst zu einem stabilen System.
Standortwahl als Zukunftskompetenz
In klassischen Gründungsprozessen wird der Standort oft zu Beginn festgelegt und danach kaum hinterfragt. Man sollte ihn jedoch als lebendiges Element sehen, das sich mitentwickelt. So wie sich Menschen verändern, wandeln sich auch ihre Resonanzen. Ein Ort, der früher förderlich war, kann später blockierend wirken, und umgekehrt. Viele erkennen erst im Rückblick, dass der Standort Teil ihrer Entwicklung war. Er erzählt, wo etwas begonnen hat und wo sich neue Wege auftun.
Diese Erkenntnis macht die Standortwahl zu einer echten Zukunftskompetenz. Wer versteht, wie Mensch und Ort zusammenwirken, kann bewusster steuern, wann ein Wechsel sinnvoll ist und wann Stabilität gebraucht wird. So wird die Standortplanung zu einem Werkzeug für innere und äußere Klarheit.
Der Ort als stiller Mitspieler
Orte sind keine Zufälle, sondern Wegbegleiter. Sie spiegeln, wo man steht, und zeigen, was sich entfalten möchte. Manche öffnen Türen, andere laden dazu ein, innezuhalten. Wenn wir die Sprache unserer Orte verstehen, treffen wir Entscheidungen mit mehr Bewusstsein. Dann wird der Standort zu einem stillen Mitspieler, der leise, aber kraftvoll dabei hilft, Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. So entsteht Erfolg nicht nur durch Strategie, sondern auch durch die Verbindung zwischen Mensch, Ort und dem, was entstehen will.
Die Autorin Franziska Engel ist Diplom-Wirtschafts-Sinologin und geprüfte (Business-)Astrologin des Deutschen Astrologen Verbandes e.V., www.unternehmen-astrologie.de
E-Commerce Berlin Expo 2026 – das sind die Highlights
Das Programm für die 10. Jubiläumsausgabe der E-Commerce Berlin Expo, einer Fachmesse und Konferenz für die B2B-E-Commerce-Branche am 17. und 18. Februar in Berlin, steht. Mehr Infos dazu hier.
Die E-Commerce Berlin Expo, eine der führenden Veranstaltungen der E-Commerce-Branche in Europa, bereitet sich anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums auf ihre bislang größte Ausgabe vor. Der prestigeträchtige neue Veranstaltungsort, die Messe Berlin, ebnet den Weg für eine noch größere Besucherzahl mit mehr als 14.000 erwarteten Teilnehmenden.
Die Teilnehmenden können sich außerdem auf 300 Dienstleister freuen, die ihre einzigartigen Branchenlösungen präsentieren, sowie auf ein umfangreiches Konferenzprogramm auf Deutsch und Englisch mit führenden E-Commerce-Expert:innen aus der DACH-Region und darüber hinaus. Das diesjährige Programm behandelt vielfältige Themen, darunter auch E-Commerce im Zeitalter der KI, bewährte Markenstrategien, Insights aus dem chinesischen Onlinehandel und die Zukunft der Branche.
Globale Marken an Bord
Mehr als 150 Branchenexpert:innen präsentieren Vorträge und 50 Workshops auf vier Vortragsbühnen und in vier Masterclass-Bereichen. Die Teilnehmer können sich außerdem auf zahlreiche Live-Podcast-Formate freuen, darunter der hauseigene „Behind the Click Podcast“. Die Präsentationen und Case Studies stammen von Top-Vertreter:innen global bekannter Marken, von Einzelhändlern wie MediaMarkSaturn, flaconi, Breuninger, rebuy oder Fielmann sowie von aufstrebenden Newcomern und Promi-Lieblingen wie saint sass. Innovative Einblicke von Branchenriesen wie Google und TikTok runden das Vortragsprogramm ab.
Podiumsdiskussionen und neue Stimmen im Fokus
Neben Keynote Speeches und Masterclasses bietet die Veranstaltung auch Podiumsdiskussionen. Im Mittelpunkt stehen die aktuell brennendsten Themen – darunter, was wir vom asiatischen Ansatz im E-Commerce lernen können, Retail Media sowie der effektive Einsatz von KI im Handel. In diesem Jahr werden auch neue Stimmen aus der Branche in einem einzigartigen Format mit sechs Kurzvorträgen von jeweils 10 Minuten Länge in den Fokus gerückt.
Wie nehme ich an der E-Commerce Berlin Expo teil?
Vormerken
Die E-Commerce Berlin Expo findet am 17. und 18. Februar in der Messe Berlin statt. Die Expo beginnt am ersten Tag um 9:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr (am zweiten Tag um 17:00 Uhr).
Toxic Funding – Geld ist nie nur Geld
Wenn Investor*innen Kultur zerstören. Oder: Warum Unternehmenskultur das wahre Anlagegut ist.

In der Start-up-Szene gilt Kapital oft als Heilsbringer. Wer es schafft, ein Investment zu sichern, hat es geschafft – so die gängige Logik. Doch kaum jemand spricht darüber, welchen Preis dieses Kapital fordert. Denn Geld ist nie nur Geld. Es trägt Energie, Interessen und Absichten in sich. Wenn diese nicht zu den Werten des Unternehmens passen, wird aus Wachstum Druck, aus Motivation Kontrolle, aus Vision Zersetzung.
Die toxische Dynamik beginnt selten offensichtlich. Am Anfang ist da meist Begeisterung: ein(e) Investor*in, der/die an dich glaubt, Türen öffnet, Potenziale sieht. Doch mit jedem Reporting, jeder zusätzlichen KPI, jeder strategischen Forderung verschiebt sich etwas im System. Der Fokus wandert von der Idee auf die Rendite, vom Menschen auf die Zahl, von der Kultur auf das Kapital – und genau hier kippt die Energie.
Manchmal ist es nicht einmal böse Absicht, sondern das System selbst, das falsche Anreize setzt. Der Kapitalmarkt liebt Beschleunigung, nicht Beständigkeit. Er honoriert Wachstum, nicht Werte. Wer auf diesem Spielfeld spielt, braucht mehr als Mut – er/sie braucht Bewusstsein. Denn jedes Investment ist auch ein Eingriff in das Nervensystem eines Unternehmens. Doch echte Stärke zeigt sich nicht im Tempo, sondern in der Fähigkeit, Stabilität zu halten, wenn alles um einen herum beschleunigt.
Wenn Macht das Spielfeld betritt
Investor*innen bringen nicht nur Geld, sie bringen auch Einfluss. Wer Anteile hält, hält auch Macht – und Macht folgt eigenen Regeln. Wird sie weise genutzt, kann sie ein Unternehmen stabilisieren. Wird sie jedoch als Druckmittel eingesetzt, um Kontrolle zu sichern oder Wachstum zu erzwingen, wird sie toxisch.
Dann entstehen Strukturen, in denen sich Gründer*innen sich selbst verlieren. Entscheidungen werden nicht mehr aus Überzeugung getroffen, sondern aus Angst, Erwartungen nicht zu erfüllen. Menschen, die anfangs für eine Idee gebrannt haben, brennen plötzlich aus. Kultur wird zur leeren Worthülse im Pitchdeck.
Manchmal geht es noch weiter. Investor*innengruppen tauschen das Management aus, ziehen Budgets ab, blockieren Entwicklungen oder zwingen Unternehmen in Märkte, die nicht zu ihrer DNA passen. Das Ergebnis: ein Start-up, das äußerlich wächst, aber innerlich zerfällt. Und mit jedem Kompromiss an die eigenen Werte verschiebt sich der Mittelpunkt weg vom Warum hin zum Wie viel.
Man könnte sagen: Es ist die moderne Form des Kolonialismus, nur dass es diesmal nicht um Länder geht, sondern um Unternehmenskulturen. Und das Perfide daran: Der Schaden zeigt sich nicht sofort. Er wächst langsam, unsichtbar, wie eine leise Entzündung im System. Erst wenn Menschen gehen, Energie versiegt und Sinn verloren geht, wird klar, was zerstört wurde. Doch dann hilft kein Kapital mehr, denn Vertrauen lässt sich nicht kaufen.
Der unsichtbare Preis der Abhängigkeit
Viele Start-ups merken zu spät, dass sie längst abhängig sind. Term Sheets sind unterschrieben, Mitspracherechte eingeräumt, Kontrollmechanismen installiert. Was als Partnerschaft begann, fühlt sich plötzlich wie eine stille Übernahme an.
Manch eine(r) sagt sich dann: „Ich treffe keine Entscheidungen mehr, ich erfülle nur noch Erwartungen.“ Und das ist der Moment, in dem toxisches Funding seine volle Wirkung entfaltet. Nicht, weil jemand böse Absichten hat, sondern weil das System selbst dysfunktional geworden ist. Wenn Druck, Angst und Kontrolle das Nervensystem eines Unternehmens bestimmen, erstickt es an sich selbst – nicht an fehlender Innovation, sondern an fehlender Integrität.
Abhängigkeit entsteht dort, wo Visionen zu Kennzahlen werden und Entscheidungen nur noch auf Papier Sinn ergeben. Kein Geld der Welt kann ersetzen, was du an Glaubwürdigkeit verlierst, wenn du gegen deine eigenen Werte handelst.
Kultur ist kein Soft Skill – sie ist Kapital
Was viele vergessen: Kultur ist der eigentliche Kapitalwert eines Unternehmens. Sie ist die Energie, aus der alles entsteht – Kreativität, Vertrauen, Loyalität, Wachstum. Wenn sie zerstört wird, bleibt eine leere Hülle.
Die Frage ist also nicht, ob du Geld annimmst, sondern von wem und unter welchen Bedingungen. Wer sich Kapital holt, sollte nicht nur auf Bewertung oder Anteile schauen, sondern auf Haltung. Wie denken die Investor*innen über Verantwortung? Was passiert, wenn Dinge nicht nach Plan laufen? Denn in Krisenzeiten zeigt sich, ob Geld eine Partnerschaft nährt oder Machtverhältnisse offenlegt.
Gesunde Strukturen trotz externer Interessen
Es gibt Wege, sich zu schützen – nicht durch Abwehr, sondern durch Bewusstsein. Start-ups mit klaren Werten lassen sich seltener manipulieren. Wer weiß, wofür er/sie steht, erkennt schneller, wann etwas nicht mehr stimmt.
Kultur zeigt sich nicht im Leitbild, sondern im Verhalten. Vor allem dann, wenn Geld ins Spiel kommt. Je klarer du deine Grenzen kennst, desto stabiler bleibt dein System. Setze Strukturen, die Transparenz schaffen. Schaffe Räume, in denen auch Kritik an Investor*innenerwartungen ausgesprochen werden darf. Und halte dir Menschen im Umfeld, die dich erden: Mentor*innen, Coaches, Partner*innen ohne finanzielles Interesse.
Wer sich ständig nur vor Zahlen rechtfertigen muss, verliert irgendwann den inneren Kompass. Und wenn du dich selbst verlierst, verliert dein Unternehmen seine Seele.
Bewusste Partnerschaft statt Machtgefälle
Kapital kann wertvoll sein, sofern es mit Bewusstsein geführt wird. Es gibt viele Investor*innen, die langfristig denken, Werte respektieren und verstehen, dass Kultur die Grundlage von Performance ist. Sie fördern Verantwortung, nicht Abhängigkeit.
Doch diese Personen findest du nur, wenn du selbst weißt, was du willst. Frage dich vor jeder Finanzierungsrunde: Was ist der Preis, den ich zu zahlen bereit bin? Kontrolle? Geschwindigkeit? Autonomie? Und was ist dir auch dann heilig, wenn Geld knapp ist? Wer diese Fragen ehrlich beantwortet, trifft Entscheidungen nicht mehr aus Angst, sondern aus Klarheit.
Der stille Wandel
Vielleicht braucht es in dieser Zeit ein neues Bewusstsein für Geld. Nicht als Treibstoff des Wachstums, sondern als Resonanzverstärker für das, was bereits da ist. Kapital ist Energie und wirkt immer in beide Richtungen.
Bringen Investor*innen Angst, Misstrauen oder Machtstreben mit, prägt diese Energie das Unternehmen. Bringen sie hingegen Vertrauen, Weitsicht und Menschlichkeit mit, entsteht Wachstum, das Substanz hat.
Die neue Generation von Gründer*innen spürt das zunehmend. Sie will nicht mehr nur skalieren, sondern gestalten. Und sie weiß: Kultur ist das wahre Anlagegut. Denn was nützt der erfolgreichste Exit, wenn man sich selbst verliert?
Fazit
Toxic Funding ist kein Finanzthema, sondern ein Bewusstseinsthema. Kapital kann heilen oder zerstören. Das liegt nicht am Geld selbst, sondern an der Haltung derer, die es geben und die es annehmen.
Beginnen Gründer*innen, sich selbst und ihre Kultur zu schützen, entsteht eine neue Form von Wirtschaft. Eine, in der Geld wieder Mittel zum Zweck ist und nicht der Zweck selbst. Vielleicht ist das der eigentliche Wandel, den unsere Zeit braucht: weniger Investment in Kontrolle, mehr Vertrauen in Haltung. Denn Unternehmen, die auf Integrität bauen, müssen sich nicht verkaufen, um zu wachsen. Sie ziehen das richtige Kapital an, weil sie selbst wertvoll sind.
Die Autorin Nicole Dildei ist Unternehmensberaterin, Interimsmanagerin und Coach.
SPEIKI: das Spucktuch zum Anziehen
SPEIKI wurde von Dr. Karin Mehling entwickelt – als ihr eigenes Kind ein sogenanntes Spuckbaby war und gängige Hilfsmittel im Alltag nicht funktionierten. Aus dieser Erfahrung entstand ein durchdachtes Spucktuch, das genau auf die Bedürfnisse von Eltern und das Verhalten der betroffenen Babys abgestimmt ist.

Was tun, wenn das eigene Baby ständig spuckt – und keine Lösung wirklich hilft? Genau diese Frage hat sich Gründerin Dr. Karin Mehling 2020 gestellt, als sie selbst mitten in der herausfordernden Spuckphase ihres zweiten Kindes steckte. Rund 70 Prozent der Säuglinge spucken in den ersten vier bis sechs Lebensmonaten – ein häufiges Phänomen, das durch den noch unreifen Magenpförtner, einem Muskel am Mageneingang, verursacht wird.
Der Alltag ist in dieser Zeit vor allem geprägt durch Flecken wischen und Wäsche waschen, unangenehme Gerüche und feuchte Textilien. Aus ihrer persönlichen Erfahrung entstand das SPEIKI Original (Kurzform für Speikind): Ein „Spucktuch zum Anziehen“, das Eltern von Speikindern spürbar entlastet, da es die ausgespuckte Milch fast vollständig auffängt.
Per Bootstrapping aus dem Wohnzimmer in den Markt
Entwickelt wurde das SPEIKI Original am Wohnzimmertisch für den eigenen Sohn. 2021 meldete die promovierte Germanistin, Verlagskauffrau sowie PR- und Marketing-Managerin ihr Gewerbe als Einzelunternehmerin, wenig später konnte das Spucktuch bereits in Serie gehen.
In der per Bootstrapping finanzierten Startphase war es laut der Gründerin die größte Challenge, zu akzeptieren, nicht alles sofort schaffen zu können. Während sie als Angestellte ihren Fokus auf die klar definierten Projekte und Tätigkeiten legen konnte, kamen nun als Solo-Selbständige die Notwendigkeiten rund um Buchhaltung, Herstellung, Verwaltung und vieles mehr hinzu.
„Mit zwei Kindern zu Hause und bald einen weiteren Buben im Bauch gründete ich mein Einzelunternehmen. Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb – alles stemmte ich allein und ,nebenbei‘. Nachts, zwischen Windeln und Weinen, auf dem Boden neben der Badewanne, in der die Buben sitzen – es gab fast keinen Ort und keine Zeit, die ich nicht versuchte zu nutzen, um meine Vision voranzutreiben: Mit meinem Textil-Label kluge Lösungen für den Baby-Alltag zu schaffen, die wirklich unterstützen. Dabei leiteten und leiten mich mein Ehrgeiz, mein Allrounder-Gemüt und meine Zielstrebigkeit, ebenso wie meine Werte, die dem Prinzip der ökonomischen Nachhaltigkeit folgen.“
Gefertigt wird das Spucktuch in einer bayerischen Nähmanufaktur. Regionalität ist Karin Mehling wichtig, als Unternehmerin sieht sie sich in der Verantwortung, nachhaltig zu wirtschaften.

Fünf Jahre erfolgreich im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt
Der Weg von der ersten Idee bis zum etablierten Produkt zeigt den typischen Werdegang vieler Einzelunternehmen: handgemachte Prototypen, lokale Produktionswege und ein wachsendes Sortiment, das sich an den alltäglichen Bedürfnissen von Familien orientiert. Der Hauptfokus liegt bis heute auf dem SPEIKI selbst. Ergänzende Produkte runden das Portfolio ab, bleiben aber klar am Bedarf von Familien mit Spuck- und Stillthemen ausgerichtet.
Das Ergebnis: Ein Sortiment, das trotz spitzer Positionierung breit genug ist, um relevant zu bleiben. Das Wachstum der Marke basiert vor allem auf organischer Sichtbarkeit, Community-Nähe und authentischer Kommunikation.
„Ich habe mich bewusst auf das Kernprodukt konzentriert – und ergänze nur dort, wo Familien echte Bedürfnisse haben“, erklärt die Gründerin. Die Nachfrage zeigt, dass dieser Ansatz funktioniert: Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum und blickt auf eine Entwicklung zurück, die weit über die Region hinaus Wirkung zeigt. Als Direct-to-Customer-Unternehmen mit jährlich wachsenden Umsätzen ein Meilenstein im stark umkämpften Babyausstattungsmarkt. „Dass aus einer spontanen Idee so viel werden kann, hätte ich selbst nicht zu träumen gewagt“, sagt Karin Mehling. „Aber offensichtlich haben viele Eltern genau das gebraucht.“





