Aktuelle Events
Anbieter-Check: Webinare
Was muss eine Webinar-Software können, um als vielschichtiges Kommunikations- und Business-Tool im Start-up-Alltag bestehen zu können? Dazu haben wir die Produkte der Marktführer unter die Lupe genommen. Wichtig für alle, die sich eine Webinar-Software zulegen möchten.

Der Einsatz von Webinaren ist bei vielen Unternehmen beliebt. Schneller, direkter und individueller Zugang zu potenziellen Kunden – das lässt sich mit Webinaren erreichen. Kommuniziert wird dabei ganz ortsunabhängig mit Hilfe von Videoübertragungen, parallelen Chats oder Präsentationen – fast wie im realen Leben. Die Möglichkeiten sind dabei vielfältig. Wer etwa eine Software anbietet, kann diese in Webinaren hervorragend präsentieren. Im Beratungsumfeld nutzen auch viele kleine Unternehmen Webinare, um Kostproben spezialisierten Know-hows zu geben. Kunst, Kultur, Pädagogik, Reisen … die Zahl der Branchen und Themen, die in Form von Webinaren bei der gewünschten Personengruppe angebracht werden können, ist riesig. Unified Communications heißt das Schlagwort.
Der Markt und damit die Zahl der Nutzer wächst; Experten gehen auch in den kommenden Jahren weiterhin von beachtlichem Wachstum aus. Auf den Zug aufzuspringen lohnt sich, denn so werden im Vergleich zum klassischen Vertrieb mit persönlicher Anwesenheit auch noch Kosten gespart. Doch: Die Vielfalt der angebotenen Lösungen für die Durchführung ist groß, die Preise und Funktionen häufig undurchsichtig – Fehlentscheidungen sind dabei durchaus an der Tagesordnung. Wir helfen bei der Orientierung.
Wo anfangen?
Die Recherche bei Google zeigt meist schon schnell, dass die Dinge nicht einfach sind. Jeder Anbieter kocht hier sein ganz eigenes Süppchen. Am Ende gewinnt dann oft die Lösung, die den besten Vertrieb hat. Das häufige Ergebnis: überflüssige Funktionen, Probleme mit nicht funktionierender Technik bei den Teilnehmern, explodierende Kosten, fehlende Funktionen oder geringe Akzeptanz. Hilfreich ist deshalb ein Blick auf die Merkmale der einzelnen Collaboration-Lösungen.
I. Vorab-Überlegungen
Erstellen Sie zunächst im Vorfeld der Entscheidung ein aussagekräftiges Webinar-Konzept. Beantworten Sie dazu folgende Fragen: Wer soll erreicht werden? Welche Botschaften sollen auf welche Weise kommuniziert werden? Wie viele Moderatoren soll es geben, die zeitgleich arbeiten können? Welche technische Ausstattung haben potenzielle Kunden?
Da Web-Collaboration-Lösungen sehr vielseitig sind, sollte auch vorab überlegt und entschieden werden, ob die Lösung für weitere Zwecke wie etwa das Video-Conferencing oder für Telefonkonferenzen eingesetzt werden soll. Im nächsten Schritt erfolgt dann die Festlegung der notwendigen (Kern-)Funktionalitäten auf Basis des obigen Konzeptes: Im Ergebnis entsteht ein Anforderungskatalog, der die Entscheidung erleichtert bzw. konkret ermöglicht. Im letzten Step erfolgt dann das Einholen von Angeboten und die Bewertung der Lösungen auf Basis des von Ihnen erstellten, individuellen Anforderungskataloges. Sinnvoll ist ergänzend ein Testzugang, mit dem Sie einen Probelauf durchführen können.
Welche Funktionen werden gebraucht?
Für Webinar-Lösungen werden meist die nachfolgend aufgeführten Funktionen angeboten. Welche davon wichtig sind, können Sie nur im Einzelfall entscheiden. Für den erfolgreichen Einsatz wird deshalb zunächst das eingangs thematisierte Konzept benötigt. Entscheidender Faktor ist dabei, wie Sie Ihre Botschaften vermitteln können und welche Einschränkungen bei Ihren Kunden bestehen. Hier die wichtigsten Funktionalitäten im Kompaktüberblick
Kernfunktionalitäten
Wer eine Software präsentieren will, braucht unbedingt das Desktop-Sharing. Wer dagegen ein physisches Produkt oder sich selbst präsentieren will, sollte auf Videoübertragungen setzen – in einigen Fällen ist auch eine Kombination aus Desktop-Sharing und Video sinnvoll. Das Verteilen von Unterlagen ist für jeden praktisch, denn Whitepapers und ähnliches helfen, in Erinnerung zu bleiben. Zeichenwerkzeuge dagegen sind nur im Ausnahmefall wichtig, genauso wie das Whiteboard. Das Verteilen von Unterlagen und das Desktop-Sharing dagegen gehören zu den Funktionen, die in jedem Fall vorhanden sein sollten. Ein Chat ist in der Regel auch sinnvoll und notwendig.
Technische Voraussetzungen
Die technischen Bedingungen stellen Stolperfallen dar. Hat ein Teilnehmer nicht die notwendige Hardware – also ein Mikrofon oder ein Headset, kann er sich gegebenenfalls nicht am Webinar beteiligen. Alle Anbieter haben zwar die Option der Einwahl via Telefon, diese ist aber in vielen Fällen mit zusätzlichen Kosten verbunden, die sehr unterschiedlich ausfallen. Noch problematischer wird es, wenn eine zusätzliche Software installiert werden muss. Viele große Unternehmen verhindern dies und machen damit gegebenenfalls die Teilnahme unmöglich. Auch die Verschlüsselung der Daten sowie die Serverstandorte spielen gerade in großen Unternehmen (also auch bei Teilnehmern) eine erhebliche Rolle.
Technische Probleme ergeben sich außerdem häufig auf Linux-Rechnern, die nur sehr eingeschränkt unterstützt werden. Wer Teilnehmer aus dem Ausland erwartet, sollte prüfen, inwieweit dies funktioniert. Die Preismodelle der unterschiedlichen Anbieter orientieren sich darüber hinaus an Teilnehmerzahlen, die im Vorfeld geschätzt werden sollten. Ob eine Lösung mit Smartphone oder Tablet nutzbar ist, sollte ebenfalls in Ihren Fragenkatalog für Anbieter gehören.
Vermarktungsoptionen
Um potenzielle Kunden zu erreichen, sind individuelle Einladungstexte sinnvoll. Auch die Nachvollziehbarkeit der Teilnehmer ist wichtig für das Nachhalten im Vertrieb. Hierzu dienen Tools zur Abfrage der Teilnehmer, aber nicht alles muss über Standard-Funktionalitäten der Software gelöst werden. Das gilt auch für die CRM-Integration, die nur begrenzt notwendig ist, da oft schon ein einfacher CSV-Import reicht. Eine sehr wichtige Funktion ist das Aufzeichnen von Webinaren, denn diese werden als Mitschnitt gern auch für den Vertrieb genutzt – als Video auf Plattformen wie YouTube beispielsweise.
Administration und mehr
Viele Webinar-Lösungen bieten ausgesprochen komfortable Funktionalitäten. Aber: Häufig wird genau das zum Stolperstein, denn die Akzeptanz bei den späteren Webinar-Moderatoren dafür ist teilweise gering. Je umfangreicher eine Lösung ist, desto mehr Einarbeitungszeit muss eingeplant werden. Unter Umständen wird eine vielseitige Lösung gesucht, die sich neben Webinaren auch für Webkonferenzen und Telefonkonferenzen anbietet. Gerade Unternehmen, die noch ganz am Anfang stehen, wollen in der Regel nicht mit zig unterschiedlichen Lösungen arbeiten. Deshalb prüfen Sie am Besten im Vorfeld auch, inwieweit eine Lösung erweiterbar ist oder für eine weitergehende Kommunikation innerhalb eines Teams oder Unternehmens geeignet ist.
Lizenzmodelle
Hier ist äußerste Vorsicht ratsam. Wesentlich ist die Frage, ob pro Nutzer oder pro virtuellem Raum abgerechnet wird. Je nachdem fallen die Kosten sehr unterschiedlich aus. Häufig entstehen erhebliche zusätzliche Kosten für die Einwahl aus dem Ausland oder via Telefon. In jedem Fall sollten Funktionalitäten und Preise sehr genau im Vorfeld geprüft werden, denn gerade diese zusätzlichen Kosten werden von vielen Anbietern oft nur sehr vage formuliert. Die Erfahrung zeigt außerdem, dass es wichtig ist, sich nicht nur auf ein einziges festgelegtes Konzept bei der Durchführung zu verlassen. Denn vereinzelt kann es immer technische Probleme geben. Es ist deshalb ratsam, einen Ersatzplan griffbereit zu haben und im Falle eines Falles etwa schnellstmöglich von Videoübertragung/Audio und Chat auf Telefon und Desktop-Sharing wechseln zu können. Mit anderen Worten: Die Einwahl per Telefon sollte immer gewährleistet sein und somit mit gebucht werden.
II: Der Anbieter-Check
Einige Anbieter tun sich im Markt für Webinar-Lösungen hervor. Dabei fällt vor allem die Unübersichtlichkeit einiger Lösungen auf. Rechtsanwalt Markus Schmidt von deranwalt24.de rät: „Allgemein ist zu empfehlen, die angebotenen Leistungen zu prüfen. Nur, wenn dem Kunden bekannt ist, welchen Service er bekommt und welche Leistungen in dem Angebot genau enthalten sind, kann er einschätzen, ob es sich um ein kompetentes und seriöses Angebot handelt.“ Auf vielen Seiten finden sich jedoch eher wenige Fakten und dafür umso mehr schwammige und unklare Werbeversprechen. Ein Anruf beim Anbieter, ein Testaccount oder noch besser eine E-Mail mit konkreten Fragen ist also ein wichtiger Schritt im Vorfeld. Einen ersten Überblick gängiger Lösungen zeigen wir im Folgenden auf. Der Anbieter-Markt wird stark von großen Unternehmen beherrscht; die bekanntesten stellen wir vor. Denn bei der Recherche lassen sich diese ohnehin gar nicht übersehen. Als eher kleineren Anbieter haben wir zusätzlich Talkyoo mit in den Vergleich aufgenommen, quasi stellvertretend als eine Alternative zu den großen Anbietern.
SKYPE
Der bekannteste Service in Sachen Web-Collaboration und damit der erste Gedanke ist wohl Skype. Aber: Als Video-Conferencing-Service ist Skype für das Durchführen von Webinaren nicht oder nur sehr begrenzt geeignet. Das ergibt sich schon alleine aus der fehlenden Möglichkeit, Einladungen zum Webinar aus Skype heraus per Mail zu verschicken oder der nicht vorhandenen Moderatorenrolle in Skype. Die Installation der Anwendung ist für die Mitarbeiter sehr vieler Unternehmen nicht möglich. Damit entfällt Skype in vielen Fällen als Lösungsweg.
CITRIX
Citrix lässt sich als Lösung für Webinare (Citrix GoToWebinar), für Web-Conferencing (Citrix GoToMeeting) oder für Online-Trainings (Citrix GoToTraining) einzeln buchen. Alternativ steht auch das gesamte Angebot als Komplettlösung zur Verfügung. Die besten Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie hier, wo die einzelnen Lösungen verglichen werden. Die Lösung GoToMeeting hat dabei den geringsten Funktionsumfang und ist für Webinare nicht geeignet. GoToWebinar ist dagegen voll auf Webinare ausgerichtet und erlaubt vor allem zusätzliche Möglichkeiten, die dem Vertrieb helfen – wie etwa Umfragen, anhand derer die Beteiligung am Webinar nachvollzogen werden kann. Die Lösung lässt sich darüber hinaus auch für das Web-Conferencing nutzen. Mit der Installation einer zusätzlichen Software lässt sich Citrix neben MacOS und Windows auch mit Linux nutzen. Die Preise unterscheiden sich je nachdem, ob es sich um ein monatliches Abonnement handelt, oder ob ein komplettes Jahr gebucht wird. Wer von Anfang an auf ein Monatsabo setzt, nimmt deutlich höhere Preise in Kauf. Der Preis für die monatliche Nutzung liegt derzeit bei 109 Euro pro Nutzer für das kleinste Paket (bis zu 100 Teilnehmern) als monatliches Abonnement. Hinzu kommen weitere Kosten für die Nutzung von Telefonservices und die Auslandseinwahl.
EDUDIP
Edudip ist eine komplette Online-Lösung und zugleich ein Marktplatz für Webinare. Hier wird in Online-Trainer und Unternehmen unterschieden. Für kleine Anbieter gibt es Online-Trainer-Pakete, die richtig erwachsene Variante mit allen notwendigen Funktionalitäten steht aber erst ab dem Business-Paket mit 69 Euro pro Monat und Nutzer zur Verfügung. Weitere Nutzer kosten dann 29 Euro monatlich pro Moderator. Einige Services wie die Einwahl per Telefon müssen hinzu gebucht werden. Die Funktionen der Lösung sind vielseitig, alle üblichen Dinge wie die Videoübertragung, Desktop-Sharing, Chat, Umfragen und mehr stehen zur Verfügung. Die Nutzung funktioniert über die Plattform, eine Installation von Software ist nicht notwendig. Technisch betrachtet entstehen aber Probleme mit dem zwingend notwendigen Flash-Player, der für das iPhone nicht verfügbar ist und vereinzelt auch in größeren Unternehmen nicht eingesetzt werden darf. Ein Teil potenzieller Kunden bzw. Teilnehmer ist damit ausgeschlossen. Bezüglich der Sicherheit zeigt sich der Anbieter mit einem Serverstandort in Deutschland und einer verschlüsselten Verbindung recht zuverlässig. Allzu vielseitig ist die Lösung nicht, denn für Telefonkonferenzen und Videokonferenzen ist Edudip nicht sonderlich geeignet.
FASTVIEWER
FastViewer punktet vor allem in Sachen Sicherheit: Ein TÜV-Zertifikat, die mögliche Einrichtung eigener Kommunikationsserver, die Auswahl des Serverstandortes über die Administrationsoberfläche sind wichtige Merkmale für sicherheitsbedachte Kunden. Neben der Webinar- und Conferencing-Lösung ist FastViewer auch für den Einsatz von Fernwartungen geeignet. Die 256-Bit AES-Verschlüsselung macht die Verbindung auch sicher. Chat, Umfragen, Videoübertragung, Whiteboard, Online-Präsentationen und alle anderen üblichen Funktionen sind hier verfügbar. Unterschiede ergeben sich allenfalls durch Details. Etwas unglücklich zeigt sich, dass die Aufzeichnung von Webinaren unter MacOS nicht verfügbar ist – hierzu ist aber eine Lösung in Arbeit. Windows und MacOS sind aber ansonsten unproblematisch; Linux wird nicht unterstützt. Die Lösung unterscheidet sich preislich stark von den hier vorgestellten Vorgängern: Die Abrechnung erfolgt pro Raum, nicht pro Nutzer. Damit dürfte Fast Viewer in vielen Fällen deutlich günstiger als die Konkurrenz sein. Es gibt unterschiedliche Lizenz-Modelle: Vom Mini-Paket in Form eines Prepaid-Guthabens über die monatliche Miete (38 Euro pro Monat und pro Raum) bis zum Kauf mit 979 Euro pro Raum einmalig plus 15 Prozent Wartungskosten pro Jahr. Außerdem kommen Vergünstigungen bei der Buchung zusätzlicher Räume ins Spiel.
TALKYOO
Das Unternehmen Talkyoo aus Hamburg war ursprünglich auf Telefonkonferenzen fokussiert. Aus der Kooperation mit FastViewer ist eine interessante Alternative entstanden, die verschiedene Anwendungen im Unternehmen abdeckt: Webkonferenzen, Webinare, Online-Präsentationen oder eben die immer noch zuverlässigste Lösung – die Telefonkonferenz. Insgesamt fehlt hier einzig die Abrechnung von Seminaren. Mit etwas Kreativität kann das aber auf anderen Wegen gelöst werden. Insbesondere wird durch den Hintergrund der Telefonkonferenzen hier international die Möglichkeit geboten, den bereits erwähnten Plan B stets in Angriff nehmen zu können, wenn die Audio- und Videoübertragung Probleme bereitet. Talkyoo unterscheidet sich für diese wichtige Option vor allem auch durch einen festen monatlichen Betrag von anderen Anbietern. Das macht die Kosten transparent und gut kalkulierbar. Eine Einwahl mit Skype ist ebenfalls möglich. Vorteilhaft ist darüber hinaus, dass auch kleine Pakete zu erschwinglichen Preisen gebucht werden können, ohne dabei die Funktionen einzuschränken. Das kleinste Telefon-Webkonferenz-Paket kostet pro Monat netto 32,53 Euro und kann ohne Frist gekündigt werden. Außerdem sind auch Sofort-Webkonferenzen ohne jede vertragliche Bindung möglich. Durch Upgrades wächst die Lösung dann bei Bedarf einfach und flexibel mit.
WEBEX
Wie auch Citrix wartet WebEx mit umfangreicher Funktionalität auf. Neben Standards wie dem Chat, Videoconferencing, Umfragen, Up- und Download von Dateien gibt es Details wie etwa das Aufteilen von Teilnehmern in Gruppen. Damit ist die Lösung sehr vielseitig einsetzbar – vom Meeting über das Webinar bis hin zum Training. In den Standard-Paketen, die man über die Webseite buchen kann, sind allerdings keine erweiterten Funktionalitäten – etwa für Trainings beinhaltet. Es geht bereits mit einem kleinen Paket für 8 Teilnehmer und 19 Euro im Monat pro Nutzer los – richtig teuer wird es aber, wenn Audio-Produkte wie das Telefonieren (vor allem aus dem Ausland) hinzu kommen, die ebenfalls pro Nutzer abgerechnet werden. Je nach Nutzung entstehen leicht monatliche Zusatzkosten von 150 Euro und mehr im Monat pro Nutzer. Zum Thema Datensicherheit lässt sich sagen, dass auch hier Kommunikationsserver im Ausland stehen. In großen Unternehmen kann das gegen die Richtlinien verstoßen und so möglicherweise die Teilnahme einiger Kunden ausschließen. Unterstützt wird neben MacOS und Windows auch Linux – allerdings mit starken Einschränkungen. So ist etwa ein 32Bit-Linux-System stark veraltet, aktuelle 64-Bit-Systeme sind hier aber nicht an Bord.
Gibt es die ideale Lösung?
Kurz gesagt: Es gibt keine ideale Lösung für alle Fälle. Jeder Anbieter wartet mit ganz eigenen Merkmalen und Preismodellen auf, die nur im einzelnen beurteilt werden können. Sehr wesentliche Unterschiede ergeben sich aus den Lizenzmodellen und den Telefonkosten. Neben den vorgestellten Lösungen kommen übrigens auch weitere Anbieter wie Adobe Connect, ClickMeeting, Mikogo oder TeamViewer in Frage. Wer zielgerichtet auswählt, vermeidet Enttäuschungen oder Überraschungen bei den Kosten. Mit der richtigen Lösung können Sie sich dann ganz auf den Kern der Sache konzentrieren: die Kommunikation mit Kunden und dem weiteren Netzwerk.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Pflanzentheke: Vertical-Farming-Start-up erhält DBU-Förderung
Das 2022 gegründete Start-up Pflanzentheke ermöglicht vertikales Gemüsewachstum in nährstoffreichem Wasser statt in Erde und wird dafür mit 175.000 Euro durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert.

Der Großteil des in Deutschland konsumierten Obsts und Gemüses wird importiert. Laut Zahlen des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Heimat (BMLEH) liegt die Selbstversorgungsrate – also der Anteil der im Land produzierten im Vergleich zu den insgesamt verbrauchten Gütern – für Gemüse bei 36 Prozent, für Obst lediglich bei 20 Prozent. Besonders große Städte sind auf die Versorgung durch Lebensmittellieferungen über weite Distanzen angewiesen. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde: „Nahrungsmittelanbau nah an urbanen Zentren mit hohem Bedarf spart teure und klimaschädliche Transportwege. Das geht jedoch nur mit einer effizienten Nutzung der knappen Flächen.“
Genau dieses Ziel verfolgt das 2022 von Dr. Michael Müller, Dr. Julia Dubowy, Lasse Olliges und Leon Welker gegründete Start-up Pflanzentheke aus dem hessischen Lorsch mit sogenannten Vertical-Farming-Systemen für den geschützten Anbau – also dem vertikalen Anbau von Lebensmitteln in geschlossenen Anlagen wie Gewächshäusern oder Folientunneln. Pflanzentheke-Mitgründer Leon Welker: „Das Gemüse wächst in A-förmigen Regalen in einem sogenannten hydroponischen System – Pflanzen gedeihen also in nährstoffhaltigem Wasser anstatt in Erde auf im Schnitt sieben Stufen pro Anlage.“ Nun nimmt das Unternehmen mit der DBU-Förderung in Höhe von 175.000 Euro die Automatisierung des Systems ins Visier – für einen effizienteren Einsatz von Zeit, Ressourcen und Energie.
Automatisiertes und datenbasiertes Pflanzenwachstum
Nach den Worten von Welker erfolgte die Bestückung mit Jungpflanzen der vertikalen Anlagen sowie die Ernte bislang manuell. Nun arbeitet das Start-up an einer vollständigen Automatisierung des Produktionsprozesses – bei minimalem Energieverbrauch und niedrigen Betriebskosten. „Wir setzen auf praxisnahe Automatisierungsschritte, die konkret dort ansetzen, wo kleine und mittlere Betriebe heute an ihre Grenzen stoßen: bei Ernte, Wiederbepflanzung und Systempflege“, so Welker. Das Ziel sei, die tägliche Arbeit „deutlich zu erleichtern – mit einem modularen System, das ressourcenschonend arbeitet, Wasser spart und Arbeitszeit reduziert“. Welker: „Damit machen wir effiziente Hydroponik auch für kleinere Betriebe wirtschaftlich zugänglich.“
Dazu werde das vorhandene A-förmige Anbaumodell in Bewegung versetzt und an eine intelligente Steuerung angeschlossen. „Mit Sensoren zur Überwachung werden die Pflanzenreihen mit den passenden Nährstoffen für die jeweilige Wachstumsphase versorgt – vollständig datenbasiert“, so der Mitgründer. Jede Reihe beherberge ein Gemüse in einem anderen Wachstumsstadium. Welker: „Durch die bewegliche Anlage optimieren wir auch den Zugang zum Sonnenlicht je nach Reifegrad.“ Schließlich könne eine Reihe geerntet und wiederbestückt werden, während die anderen Pflanzen durch die Umpositionierung ungestört wachsen.
Anlage soll Böden schonen sowie Wasser- und Düngerverbrauch reduzieren
Die von dem Start-up entwickelte Anlage ermöglicht Welker zufolge, Böden zu schonen, den Wasser- und Düngerverbrauch zu reduzieren und auf kleinen Flächen möglichst viele Lebensmittel anzubauen. „Das System kommt bei gleichem Ertrag mit rund 90 Prozent weniger Wasser und 85 Prozent weniger Dünger aus als die konventionelle Landwirtschaft,“ so der Pflanzentheke-Mitgründer. „Wir verbinden die Vorteile des Indoor-Vertical-Farmings – etwa bei Nährstoffnutzung und Wassereffizienz – mit einem entscheidenden Plus: Unsere Anlagen nutzen natürliches Sonnenlicht und kommen daher mit einem Bruchteil der Energiekosten aus“, sagt Welker. „Das macht den ressourcenschonenden Anbau wirtschaftlich tragfähig – auch ohne energieintensive Beleuchtungssysteme.“ Welker weiter: „Weite Transporte erzeugen hohe Mengen klimaschädlicher Treibhausgase. Der Anbau nah an Städten mithilfe solcher Vertical-Farming-Systeme reduziert die Lieferwege sowie die je nach Lebensmittel energieintensiven Kühlketten.“
DBU-Förderung ermöglicht klima- und umweltschonenden Lebensmittelanbau
Das Start-up war bereits bis Ende 2024 Teil der Green Startup-Förderung der DBU. Dadurch wurde nach Welkers Worten die Marktreife des Produkts erfolgreich erreicht. Die Entwicklung der Anlage sei zudem mit fachlicher Unterstützung durch die Hochschule Osnabrück erfolgt. „Die Automatisierung ist nun ein neues, zeitintensives Forschungsprojekt – eine Entwicklung, die wir im laufenden Betrieb nicht leisten könnten“, so Welker. Die erneute Förderung ermögliche mehr klima- und umweltschonenden Lebensmittelanbau mithilfe der automatisierten Pflanzentheke-Anlagen. Zielgruppen sind dem Unternehmen zufolge vor allem kleine und mittelgroße Betriebe. „Die Pflanzentheken sind schnell installierbar, da sie an bestehender Infrastruktur befestigt werden können“, so Welker. Neben den ökologischen Vorteilen des Systems solle die Automatisierung auch den steigenden Fachkräftemangel im Gartenbau in Teilen kompensieren.
KI-Agenten als Transformationstreiber 2026
Eine aktuelle DeepL-Studie zeigt: 69 % der globalen Führungskräfte erwarten für 2026 tiefgreifende Veränderungen durch KI-Agenten; KI-Sprachtechnologie wird zur unverzichtbaren Infrastruktur.

Eine neue Studie von DeepL, einem globalen Unternehmen für KI‑Produkte und ‑Forschung, zeigt: 2026 wird für viele Organisationen den Übergang vom Experimentieren mit KI hin zu agentischer Automatisierung markieren. So erwartet die Mehrheit der weltweit befragten Führungskräfte (69 %), dass agentenbasierte KI ihre Geschäftsabläufe im kommenden Jahr deutlich verändern wird.
Die Studie wurde im September 2025 von Censuswide im Auftrag von DeepL durchgeführt. Befragt wurden 5.000 Führungskräfte in Deutschland, Frankreich, den USA, Großbritannien und Japan. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Unternehmen verstärkt planen, autonome KI-Agenten im großen Umfang einzusetzen – etwa zur Unterstützung von Wissensarbeit, zur Effizienzsteigerung oder zur Anpassung organisatorischer Strukturen. Damit zeichnet sich die bedeutendste operative Veränderung in der Wirtschaft seit der Einführung der Cloud an.
„KI-Agenten sind längst nicht mehr experimentell, sie sind unumgänglich.“ sagt Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL. „Die nächste Phase besteht darin, sie tiefgreifend in unsere Arbeitsweisen zu integrieren. In 2026 werden KI-Agenten das mühsame Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten und repetitive Aufgaben übernehmen, sodass sich Menschen auf das konzentrieren können, was Unternehmen tatsächlich voranbringt.“
KI-Agenten werden zum nächsten Disruptor für Unternehmen
Nach ersten Pilot- und Anwendungsfällen rücken KI-Agenten zunehmend in den produktiven Einsatz:
- Fast die Hälfte der globalen Führungskräfte (44 %) erwartet für 2026 einen tiefgreifenden Wandel durch agentische KI; ein Viertel (25 %) sieht diesen Wandel bereits heute. Nur 7 % glauben, dass KI-Agenten ihre Betriebsabläufe nicht verändern werden, was die hohe Geschwindigkeit der Implementierungen unterstreicht.
- Als die drei wichtigsten Voraussetzungen für den sinnvollen und vertrauenswürdigen Einsatz von KI-Agenten nennen die Befragten nachweisbare Effizienz- und ROI-Effekte (22 %), Anpassungsfähigkeit der Belegschaft (18 %) und zunehmende organisatorische Bereitschaft (18 %).
- Als wesentliche Herausforderungen bei der Einführung von KI-Agenten nennen die Befragten Kosten (16 %), Bereitschaft der Belegschaft (13 %) und Reife der Technologie (12 %).
KI als zentraler Wachstumstreiber für globale Unternehmen
Über Agenten hinaus gilt KI insgesamt als wichtigster Motor für das Wirtschaftswachstum in 2026:
- Über zwei Drittel (67 %) der Befragten geben an, dass sich der ROI ihrer KI-Initiativen in diesem Jahr erhöht hat; mehr als die Hälfte (52 %) erwartet, dass KI im kommenden Jahr mehr zum Unternehmenswachstum beitragen wird als jede andere Technologie.
- Wenn es um messbare Verbesserungen durch KI geht, liegt Deutschland (78 %) zusammen mit Großbritannien (80 %) an der Spitze, gefolgt von den USA (71 %) und Frankreich (70 %). Japan verzeichnet mit 35 % deutlich niedrigere Werte, was auf langsamere Implementierungen und Bereitschaften hindeutet.
- Über die Hälfte der globalen Führungskräfte (51 %) rechnet damit, dass KI im kommenden Jahr mehr neue Rollen schafft als ersetzt. 52 % geben an, dass KI-Kenntnisse für die meisten Neueinstellungen vorausgesetzt werden.
KI-Sprachtechnologie entwickelt sich vom Werkzeug zur zentralen Infrastruktur
Die Studie zeigt zudem, wie KI-Sprachtechnologie zur entscheidenden Komponente der Unternehmensinfrastruktur wird:
- Fast zwei Drittel der globalen Unternehmen (64 %) planen 2026 steigende Investitionen in KI-Sprachtechnologie – angeführt von Großbritannien (76 %) und Deutschland (74 %), gefolgt von den USA (67 %) und Frankreich (65 %) werden mehrsprachige Kommunikation und Inhalte zu zentralen Faktoren für globales Wachstum. Im Gegensatz dazu bleibt Japan (38 %) vergleichsweise konservativ, was auf eine langsamere Dynamik hindeutet, gleichzeitig aber das wachsende Interesse von mehr als einem Drittel der Führungskräfte widerspiegelt.
In diesem Zusammenhang wird Echtzeit-Sprachübersetzung 2026 unverzichtbar:
- Über die Hälfte der globalen Führungskräfte (54 %) sieht Echtzeit-Sprachübersetzung im kommenden Jahr als unverzichtbar an – derzeit sind es ein Drittel (32 %).
- Großbritannien (48 %) und Frankreich (33 %) sind Vorreiter bei der Nutzung von Tools für die Echtzeit-Sprachübersetzung; Japan liegt derzeit nur bei 11 %.
- Die Nachfrage wird angetrieben von technologischen Fortschritten in der Echtzeit-Sprachübersetzung (46 %), Kundenerwartungen (40 %) und marktübergreifender Expansion (38 %).
Die Erkenntnisse der Studie liefern wichtige Einblicke in die Zukunft der KI und zeigen, wie diese Veränderungen Branchen umgestalten, Kundenerwartungen neu definieren und sich auf das Wettbewerbsumfeld auswirken.
5 Erfolgsfaktoren für (bootstrappende) Start-ups
Kapital bleibt schwer zugänglich: Was Gründer*innen jetzt von bootstrappenden Start-ups lernen können.
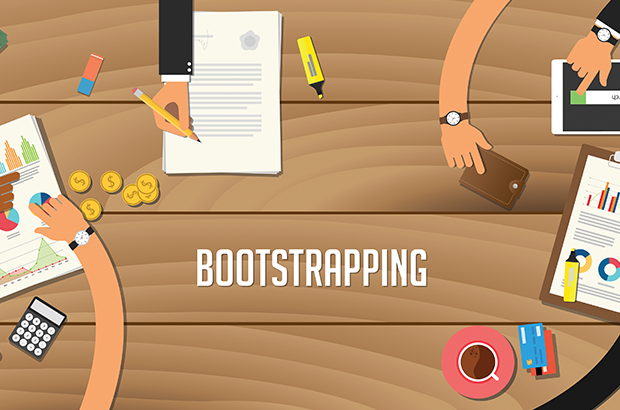
Andreas Lehr, Bootstrapper, Gründer und Host des Podcasts Happy Bootstrapping, hat mit über 150 bootstrappenden Gründer*innen gesprochen und aus den Gesprächen fünf Erfolgsfaktoren herausgearbeitet. Darunter Ansätze, die jetzt im aktuellen Funding-Klima von großer Bedeutung sind.
- Extreme Kund*innenfokussierung statt starker Wachstumsfokus.
- Profitables Wachstum mit kleinen Teams, Gründen in Teilzeit.
- Nischen-Strategien, die die Skalierung in einen breiteren Markt ermöglichen.
- Community-getriebene Produktentwicklung / Building in Public.
Lehrs Erkenntnis: „Bootstrapping gewinnt in der deutschen Start-up-Landschaft sichtbar an Gewicht. Immer mehr Gründer*innen setzen auf unabhängiges Wachstum. Genau die Strategien, die Bootstrapper*innen erfolgreich machen, werden für Gründer*innen in einem vorsichtigeren Markt zu wichtigen Werkzeugen, um Unternehmen stabil aufzubauen.“
5 Erfolgsfaktoren für (bootstrappende) Start-ups
1. Build in community, not just in public
- Eine Community ist eine dauerhafte Feedback-Quelle für bestehende und kommende Produkte.
- Aufbau enger Nutzer*innengruppen auf Discord, Instagram und per On-Site-Events sorgt für loyale Unterstützung.
- Eine Community liefert Ideen für neue Features und Produkte und hilft dabei sie zu validieren.
- Enge Interaktion sorgt für Loyalität und niedrigere Customer Acquisition Cost. Building in Community ist damit die Vertiefung von Building in Public.
Beispiel: Capacities.io ist eine Note-Taking-Software, die Notizen auf die menschliche Wahrnehmung optimierte Weise strukturiert. Die Gründer haben eine Community aus 5000+ Menschen auf Discord aufgebaut, was den Support- & Onboarding-Aufwand reduziert und die Produktbindung erhöht.
2. Keine Angst vor der Nische
- Start in einer sehr klar definierten Nische mit spitzem Nutzer*inproblem.
- Nischen ermöglichen schnelles Verständnis von Marktbedürfnissen und zielgerichtetes Produktdesign.
- Hohe Eintrittsbarrieren für Wettbewerber*innen durch Expertise und Fokus.
- Nischen können nach und nach erweitert werden, um einen breiteren Markt zu erreichen.
Beispiel: parqet.com startete als FinTech für Portfolio-Tracking für die Kunden*innen einer einzigen Bank. Die Schritt-für-Schritt-Erweiterung der Services sorgte für stabiles Wachstum und ausreichend unternehmerischer Ressourcen.
3. Produktfokus: Gut Ding will Weile haben
- Produktqualität und Nutzer*inerlebnis wichtiger als schnelle Releases.
- Intensive Iterationsphasen mit frühen Nutzer*innengruppen.
- Launches werden verschoben, bis das Produkt wirklich überzeugt.
- Kund*innennähe (direktes Feedback, Support) ist der Hebel für Produktentwicklung.
Beispiel: PROJO ist ein SaaS für Planungsbüros in der Architektur und Ingenieurswesen. Die Software wurde mit den ersten drei Kunden über zwei Jahre bei regelmäßigen Check-ins verfeinert.
4. Nicht nach Version eins aufgeben
- Erste Versionen sind oft nicht erfolgreich – Fortschritt entsteht durch Ausdauer.
- Anpassungen, Repositionierungen und mehrere Iterationen können notwendig sein.
- Gründer*innen profitieren langfristig von Beharrlichkeit in derselben Produktlinie. Expertise in der Nische entsteht nicht sofort.
Beispiel: Gründer Sebastian Röhl entwickelt verschiedene Apps im Self-Improvement-Bereich, um herauszufinden, was funktioniert: WinDiary, HabitKit, LiftBear. Viele Gründer*innen berichten von einem Hockey-Stick-Moment
5. Teilzeitgründen gibt Sicherheit
- Viele Bootstrapped-Projekte starten erfolgreich neben dem Hauptjob.
- Reduzierte Arbeitszeit (z.B. 4-Tage-Woche) ermöglicht risikoreduziertes Wachstum.
- Nebenberufliche Projekte schaffen Zeit für Markttests und frühe Umsätze.
- Erst später in Vollzeit wechseln, wenn Traction vorhanden ist.
Beispiel: Treazy, ein Start-up für Socken, wurde vom Gründerduo in Teilzeit aufgebaut und beschäftigt heute beide voll. Ein(e) Gründer*in muss nicht alles stehen und liegen, um ein Start-up aufzubauen, oft reichen drei Tage oder die halbe Woche, was finanzielle Sicherheit gibt und ein langsameres Wachstum möglich macht.
Marble Imaging erhält 5,3 Mio. Euro, um Europas Zugang zu hochauflösenden Erdbeobachtungsdaten voranzutreiben
Das 2023 von Robert Hook, Dr. Gopika Suresh und Alexander Epp gegründete Marble Imaging ist ein Erdbeobachtungsunternehmen aus Bremen, das eine Konstellation von sehr hochauflösenden Satelliten betreiben wird.

Neben dem High-Tech Gründerfonds (HTGF) hat Marble Imaging zudem eine starke Gruppe weiterer Investor*innen gewonnen, die die Mission teilt. Dazu gehören BAB Beteiligungs- und Managementgesellschaft Bremen, Lightfield Equity, Oslo Venture Company, nwk | nwu Beteiligungsgesellschaften der Sparkasse Bremen, Sentris Capital, Auxxo Female Catalyst Fund und SpaceFounders.
Die Investition soll es Marble ermöglichen, das Entwicklungsteam deutlich auszubauen und die Fertigstellung seiner Intelligence-, Maritime- und Befahrbarkeits-Tools voranzutreiben – Lösungen, die bereits erste Kund*innen bedienen und nun für den breiten kommerziellen Rollout vorbereitet werden. Zudem unterstützt die Investition den Aufbau der End-to-End-Datenverarbeitungskette sowie des Kund*innenportals, um eine nahtlose Nutzer*innenerfahrung sicherzustellen.
Die Finanzierung soll Marble zudem in die Lage versetzen, die schnell wachsende Pipeline an Datenkund*innen zu bedienen und zum Start des ersten Satelliten vollständig kommerziell einsatzbereit zu sein. Darüber hinaus soll sie den Ausbau der operativen Expertise und die Einrichtung eines dedizierten Operationszentrums für die geplante Satellitenkonstellation ermöglichen.
„Wir freuen uns sehr, ein starkes europäisches Investorenkonsortium an Bord zu haben, das das Wachstum unserer Dual-Use-Erdbeobachtungslösungen vorantreibt“, sagt Robert Hook, CEO und Mitgründer von Marble. „Mit dieser Finanzierungsrunde können wir unsere Fähigkeiten deutlich ausbauen, um der rasant steigenden Nachfrage gerecht zu werden.“
Der erste Marble-Satellit, der sehr hochauflösende multispektrale Daten liefern wird, soll im vierten Quartal 2026 starten. Bis Ende 2028 plant Marble Imaging, die eigene Konstellation schrittweise auf bis zu 20 Satelliten auszubauen. Die Nachfrage nach starken und innovativen souveränen Lösungen aus Europa zieht sich inzwischen durch nahezu alle großen Institutionen. Besonders deutlich wird dies in den Bereichen Sicherheit und Climate Tech, wo der Bedarf an schnell verfügbaren, sehr hochauflösenden Erdbeobachtungsdaten und fortschrittlichen KI-gestützten Analysen immer größer wird.
Das Unternehmen, angeführt von den Mitgründer*innen Robert Hook, Dr. Gopika Suresh und Alexander Epp, hat mit dem erfolgreichen Abschluss der Finanzierungsrunde einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Marble konnte dabei nicht nur namhafte Business Angels und institutionelle Investor*innen gewinnen, sondern auch großes Interesse führender Venture-Capital-Gesellschaften wecken.
Bereits zuvor hatte das Team für Aufmerksamkeit gesorgt, indem es mehr als 10 Millionen Euro an non-dilutive Funding für die Entwicklung und den Start des ersten Satelliten sicherte – unter anderem durch den DLR Kleinsatelliten Nutzlastwettbewerb und ESA InCubed. Zudem unterstrich das Marble die starke Nachfrage nach hochwertigen europäischen Daten und Analysen mit seinem ersten Ankervertrag im Wert von 3 Millionen Euro im Rahmen des ESA-Programms „Copernicus Contributing Missions“.
Zwischen Pflichtoptimismus und echter Zuversicht
Wie sich Hoffnung vermitteln lässt, wenn man als Führungskraft selbst nach Orientierung sucht.

Krisen erschüttern, Unsicherheit prägt Strategien und selbst Top-Führungskräfte kämpfen oft im Verborgenen mit eigenen Zweifeln. Inmitten dieser Herausforderungen gewinnt ein Konzept an überraschender Bedeutung: Hoffnung. Nicht als naiver Wunschgedanke, sondern als psychologisches Kapital mit nachweislicher Wirkung, für Motivation, Leistung und Widerstandskraft im Team. Hoffnung aktiviert nicht nur, sondern sie liefert innere Energie. Nicht nur um zu formulieren, auch um zu verfolgen, selbst wenn Hindernisse den Weg erschweren. Hoffnung im Führungskontext ist eng mit Optimismus, Selbstwirksamkeit und Resilenz verbunden, den vier Komponenten des sogenannten Psychological Capital (PsyCap). So beeinflussen Führungspersönlichkeiten mit hohem PsyCap nicht nur die psychische Stärke ihrer Mitarbeitenden, sondern steigern auch deren Engagement und Leistungsfähigkeit. Entscheidend dabei: Die Hoffnung der Mitarbeitenden wächst nicht im Vakuum. Sie orientiert sich am Verhalten der Führung. Wer selbst Zuversicht ausstrahlt, erzeugt emotionale Ansteckung. Gerade in unsicheren Zeiten wirkt Hoffnung also nicht nur stabilisierend, sondern sogar produktiv.
Persönliche Gradwanderung
Führungskräfte stehen dabei vor einer paradoxen Aufgabe: Sie sollen Hoffnung vermitteln, obwohl sie selbst häufig mit Erschöpfung, Isolation oder auch inneren Zweifeln ringen. Während der Pandemie berichteten knapp 70 Prozent der C-Level-Führungskräfte, ernsthaft über einen Rückzug nachgedacht zu haben, viele von ihnen griffen im Zuge dessen zu ungesunden Bewältigungsstrategien. Wer Hoffnung jedoch glaubwürdig verkörpern will, muss sich innerlich auch selbst tragen. Dies gelingt nur durch eine bewusste Selbstfürsorge, klare Grenzen und resilienzfördernde Routinen. Dabei bringt der Satz ‚Die Realität definieren und Hoffnung geben‘ die ethische Herausforderung von Führungskräften auf den Punkt. Hoffnung bedeutet hierbei eben nicht, aufkommende Probleme kleinzureden oder schlechte Nachrichten vollständig auszublenden. Vielmehr geht es darum, auch in schwierigen Situationen Wege aufzuzeigen, wie es weitergehen kann. Authentizität spielt in diesem Zusammenhang jedoch eine Schlüsselrolle. Denn wer ausschließlich auf eine positive Rhetorik setzt und kritische Lagen nur beschönigt, verliert schnell an Vertrauen. Umgekehrt erzeugt Hoffnung somit auch erst dann Wirkung, wenn sie mit Ehrlichkeit und einer nachvollziehbaren Perspektive verbunden bleibt.
Angst ersetzt kein Zukunftsbild
Entscheidungen im Führungskontext lassen sich häufig auf zwei Emotionen zurückführen: Angst oder Hoffnung. Zwar erzeugt Angst kurzfristig eine Bewegung, doch langfristig führt sie zu Misstrauen, Rückzug und Resignation. Mitarbeitende, die keine hoffnungsvolle Perspektive mehr erkennen, neigen häufiger dazu, zu kündigen oder brennen schneller aus. Dabei zählt Vertrauen zu den stärksten Treibern von Mitarbeiterbindung und Engagement. Ohne Integrität, Verlässlichkeit und offene Kommunikation kann aber auch Hoffnung keine richtige Wirkung entfalten. Erst das Zusammenspiel von Zuversicht und erlebtem Vertrauen aktiviert echte Veränderungskraft. Gerade auch im Mittelstand rückt das Thema Hoffnung in der aktuellen Zeit immer mehr in den Fokus. Mit knapp 80 Prozent der Unternehmen, die für 2025 einen Abschwung erwarten, wird die Fähigkeit zur Zuversicht zur Überlebensfrage, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Handlungsfelder hervor:
1. Zukunftsplanung trotz Unsicherheit: Dabei stechen vor allem drei strategische Hoffnung ersetzt selbstverständlich keine Strategie, aber sie motiviert überhaupt erstmal, eine zu entwickeln. In komplexen Märkten hilft sie so dabei, Visionen zu bewahren und langfristige Ziele nicht aus dem Blick zu verlieren.
2. Arbeitskultur und Generationen verbinden: Die Erwartungen jüngerer Generationen verlangen nach einem neuen Führungsverständnis. Hoffnungsvoll geführte Organisationen schaffen damit ein Gefühl der Zugehörigkeit, vermitteln ihren Angestellten einen Sinn und nutzen Unterschiedlichkeit als eine entscheidende Stärke.
3. Krisenkommunikation mit Haltung: Hoffnung zeigt sich nicht in auswendig gelernten Durchhalteparolen, sondern in glaubwürdiger Orientierung. Wer klare Ziele formuliert und selbst kleine Fortschritte gut sichtbar macht, ermöglicht seinen Mitarbeitenden Identifikation und verleiht Bedeutung selbst in widrigen Zeiten.
Persönliche Kompetenz
Dabei lässt sich Hoffnung auch trainieren, nicht nur als Haltung, sondern als bewusste Führungsdisziplin. Im ersten Schritt gilt es, ein Vorbild zu sein. Denn wenn die Führungskraft sie sichtbar lebt, kann Hoffnung auf die Mitarbeitenden überspringen. Hierbei braucht es jedoch ein wirklich emotionales Vorleben, statt nur einer einfachen Vision auf Papier. Zudem müssen Führungskräfte im Vorfeld auch einmal echte Grenzen setzen. Nur wer selbst psychisch stabil bleibt, kann für andere zum Hoffnungsträger werden. Burnout-Prävention und eine gesunde Selbstreflektion gelten deshalb nicht nur als ein scheinbarer Luxus, sondern erweisen sich als eine echte Pflicht. Auch das klare Zeigen von Resilienz nach Rückschlägen spielt eine wichtige Rolle. Hoffnung benötigt Raum zum Lernen. Um die psychologische Sicherheit im Team zu stärken, braucht es auch die Fähigkeit Scheitern, als einen Teil des Arbeitsprozesses annehmen zu können, um damit auch eine Entwicklung sichtbar zu machen. Schlussendlich müssen Führungspersönlichkeiten ihren eigenen Einflussbereich genau kennen. Uneingeschränkte Klarheit über gestaltbare Faktoren schützt so vor einem plötzlich aufkommenden Gefühl der Ohnmacht und fokussiert die teaminterne Energie auf das, was tatsächlich verändert werden kann. Genau in diesem Spannungsfeld wächst Hoffnung.
Strategisches Kapital
Führung bedeutet mehr als Strategie und Zahlen – sie verlangt Haltung. Hoffnung beschreibt in diesem Zusammenhang keine naive Wunschvorstellung, sondern eine produktive Kraft im Unternehmen, die Orientierung, Motivation und Verbundenheit im Team schafft. Entscheidend dafür ist jedoch eine Führung, die realistisch bleibt, Vertrauen aufbaut und die Zukunft glaubwürdig gestaltet. Nur wer Hoffnung nicht nur fordert, sondern sie auch selbst verkörpert, kann sie in seinen Mitarbeitenden pflanzen.“
Der Autor Ben Schulz ist Unternehmensberater, Vorstand der Ben Schulz & Partner AG und SPIEGEL-Beststeller-Autor.
Münchner Scale-up EcoG erhält 16 Mio. € Series B
EcoG stellt u.a. Referenzdesigns und ein standardisiertes Betriebssystem für Ladeinfrastruktur zur Verfügung und bietet eine der weltweit am schnellsten wachsenden Plattformen für Hersteller von Schnellladesäulen.

Während die europäische Autoindustrie vor strukturellen Veränderungen steht, wächst der Ladeinfrastrukturmarkt global weiter zweistellig – zunehmend auch an Schnellladestandorten für Logistik, Industrie und Handel. In diesem Umfeld sichert sich EcoG, ein internationales Scale-Up für Ladeinfrastruktur mit Hauptsitz in München und Detroit, 16 Millionen Euro von europäischen Investoren.
Die Runde wird angeführt vom Münchner GET Fund, Extantia und Bayern Kapital, die in das starke globale Wachstumspotenzial elektrifizierter Logistik- und Nutzfahrzeugflotten investieren.
Mit dem frischen Kapital will EcoG seine Softwareplattform für Ladesäulenhersteller weiter skalieren mit Fokus auf den Ausbau der gewerblichen Schnellladeinfrastruktur. Damit setzt das Unternehmen zunehmend den Standard als Betriebssystem für Schnellladeinfrastruktur. Die Technologie ist bereits heute in Europa, Indien und den USA in breitem Einsatz.
Als global orientiertes Unternehmen plant EcoG am Standort Bayern einen Innovationshub aufzubauen, um die Integration neuer Ladetechnologien wie bidirektionales Laden in Flotten oder Megawatt-Charging für E-Lkw und Ladehubs unter Realbedingungen mit Hardware- und Logistikpartnern weiter zu erproben. Mit Partnern wie Rittal stellt EcoG hierfür Laderreferenzdesigns für die Integration zur Verfügung und integriert diese zur CO2 und Kostenoptimierung mit Partnern in Geschäftsprozesse. Für den praxisnahen Aufbau der Hubs führen die Münchner aktuell Gespräche mit Depotbetreibern, Logistikern und sind offen für weitere Gespräche.
Jörg Heuer, CEO und Mitgründer von EcoG: „Die Anfangsjahre der E-Mobilität sind nun erfolgreich abgeschlossen. Jetzt stehen Professionalisierung und nachhaltiges Wachstum im Mittelpunkt. Ein Beispiel hierfür ist der Einsatz von elektrischen Lkws in der Stadtlogistik. Das ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern zunehmend eine echte Geschäftsgrundlage.”
Johannes Hund, CTO und Mitgründer von EcoG kommentiert: „Konzerne wie Amazon zählen bereits heute zu den größten Betreibern von Ladeinfrastruktur weltweit und unsere Ladeplattform kann Firmen wie diese zukünftig noch besser unterstützen.“
Precision Labs: Münchner FoodTech-Start-up sichert sich über 4 Mio. Euro
Das 2023 von Dr. Fabio Labriola, Malte Zeeck und Philipp von Plato gegründete Start-up steht mit seiner Marke Precision für eine neue Generation von Milchprodukten, die hochwertiges Milchprotein und wertvolle pflanzliche Inhaltsstoffe kombiniert.
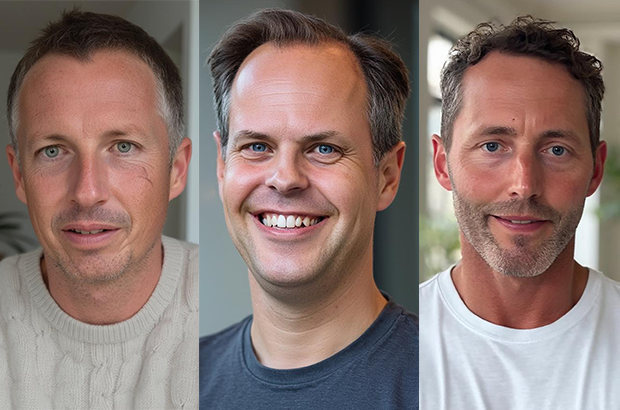
Das Münchner Food-Tech-Startup Precision Labs, Entwickler der nächsten Generation von Milchprodukten, hat seine Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt fließen im Rahmen der Investitionsrunde über vier Millionen Euro in das junge Unternehmen – eine überzeichnete Runde in einem nach wie vor herausfordernden Marktumfeld für Frühphasenfinanzierungen. Zu den Investor*innen zählen die Venture-Capital-Gesellschaft Elemental, Unternehmerpersönlichkeiten wie Stefan Tewes (Gründer Coffee Fellows), Marc-Aurel Boersch (ehemaliger CEO von Nestlé Deutschland) und Mic Weigl (Gründer von More Nutrition) sowie mehrere bekannte Spitzensportler*innen wie Joshua Kimmich und İlkay Gündoğan.
Das frische Kapital will Precision Labs in die Markterschließung in Deutschland und Österreich, die Forschung und Entwicklung weiterer Produkte sowie den Ausbau seiner Marke Precision investieren. „Es ist ein starkes Signal, dass wir unsere Runde in diesem Marktumfeld überzeichnet abschließen konnten“, sagt Dr. Fabio Labriola, Mitgründer von Precision Labs. „Es zeigt, dass Investor*innen und Konsument*innen bereit sind, Milch neu zu denken – indem sie traditionelle Kategorien hinterfragen und innovative Lösungen annehmen.“
Precision Labs steht mit seiner Marke Precision für eine neue Generation von Milchprodukten, die hochwertiges Milchprotein und wertvolle pflanzliche Inhaltsstoffe kombiniert, ganz ohne Konservierungsstoffe. Das erste Produkt, eine Milchalternative, vereint Geschmack, eine cremige Textur und Schäumfähigkeit mit einem überlegenen Nährstoffprofil. Parallel arbeitet das Team an der Entwicklung von vollständig kuhfreien Milchprodukten auf Basis eines naturidentischen Milchproteins das durch Präzisionsfermentation hergestellt wird – einer Technologie, die in den USA, Israel und Singapur bereits zugelassen ist. Die EU-Zulassung wird für 2027 erwartet. „Precision hat das Potenzial, eine neue Kategorie im Milchmarkt zu etablieren“, sagt Marc-Aurel Boersch, Investor und ehemaliger Nestlé Deutschland CEO. „Das Team verbindet unternehmerische Erfahrung mit einer klaren Vision für gesündere und nachhaltigere Ernährung.“
Das Gründer-Trios konnte gleich mehrere Spitzensportler*innen überzeugen, in Precision Labs zu investieren. Zu ihnen zählen die Top-Fußballer İlkay Gündoğan (ehemaliger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft), Serge Gnabry (Mitglied der deutschen Nationalmannschaft) und Joshua Kimmich (Kapitän der deutschen Nationalmannschaft), die Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, der Grand Slam Sieger und Impact-Unternehmer Dominic Thiem sowie die Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp. „Wenn ich an meine Sprünge denke, will ich so sauber und kraftvoll wie möglich sein. Und das gilt auch für das, was ich esse und trinke. Precision zeigt, dass man Milch neu denken kann – mit wertvollen Proteinen, einem verbesserten Nährstoffprofil und einer deutlich geringeren Umweltbelastung. Für mich ist das die Ernährung, die zu meinen Werten passt", so Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo über ihre Motivation zu investieren.
Der bundesweite Roll-out der ersten Produkte ist für 2026 geplant, die Expansion nach Österreich soll im selben Jahr folgen.
Gründer*in der Woche: Christiani.AI – ein System, das dich kennt
Wie die Christianis mit KI, Storytelling und Haltung die Kommunikation kleiner Unternehmen neu denken.

Die Idee kam ihnen nicht in einem Gründerzentrum, nicht in einer Loft-Küche mit Whiteboard, sondern zwischen Kaminfeuer und Käsefondue: Bei einem Familientreffen in den Schweizer Bergen saßen drei Männer zusammen, die mehr verbindet als ihr Nachname Christiani. Alexander, Constantin und Raphael, Vater und Söhne, reden über viel, wenn sie sich sehen. Aber immer wieder landen sie bei einem Thema: Warum tun sich so viele Menschen damit schwer, ihr Wissen verständlich zu kommunizieren?
„Wir kannten das aus der Praxis“, sagt Alexander, Storytelling-Experte mit über 20 Jahren Erfahrung. „Wir haben jahrzehntelang Unternehmen geholfen, gute Geschichten zu erzählen, aber je mehr Substanz jemand hatte, desto schwerer war es oft, diese nach außen zu bringen.“ Und dann war da dieser Satz von Constantin, der blieb: „Vielleicht liegt es nicht am Menschen. Vielleicht fehlt einfach das System.“ Ein paar Monate nach diesem Statement war das Start-up Christiani.AI geboren.
Zwischen Genialität und Sprachlosigkeit: Das Expert*innen-Paradox
Es ist ein vertrautes Problem, besonders in der Start-up-Welt: Du kannst etwas, du weißt etwas, du baust etwas mit echtem Wert. Aber sobald es darum geht, es in Worte zu fassen, geht das Stottern los und viele kommunizieren weit unter ihrem Potenzial. „Das ist das Experten-Paradoxon“, erklärt Raphael, der Technikexperte im Trio. „Den Menschen mit der größten fachlichen Tiefe fällt es am schwersten, sich einfach auszudrücken. Weil sie mit mehr Informationen arbeiten, anders differenzieren und abwägen. Und genau da setzt unsere Lösung an.“
Was die Christianis bauen wollten, war nie ein weiteres KI-Tool, das automatisiert Blogbeiträge ausspuckt. Ihr Ziel war größer und zugleich leiser: ein System, das Menschen in ihrer Tiefe versteht, ihre Haltung erfasst, ihre Sprache kennt und daraus glaubwürdige Kommunikation entwickelt. Ein KI-gestütztes Framework, das wie ein strategisches Marketingteam arbeitet, nur eben ohne Agenturhonorare.
Die Haltung hinter dem „Christiani-Code“
Christiani.AI ist kein Kind des KI-Hypes unserer Tage. Die Christianis kommen aus dem Storytelling. Sie denken in (Spannungs-)Bögen, nicht in Features. „Wenn wir ehrlich sind, geht’s heute doch überall nur darum, lauter zu sein“, sagt Constantin. „Lautere Claims, lautere Ads, lautere Versprechen. Wir glauben nicht, dass das nachhaltiges Marketing ist.“ Für ihn ist Kommunikation ein Dienst am Gegenüber, nicht bloß Mittel zum Zweck. „Deshalb haben wir ein Tool entwickelt, das hilft, die richtige Geschichte zu finden und sie authentisch zu erzählen. Das ist selten die lauteste.“
Im Gegensatz zu anderen arbeitet die komplexe Anwendung mit einem strategischen Unterbau, der sonst nur in High-End-Agenturen verfügbar ist. Sie analysiert nicht nur Keywords, sondern auch Werte. Nicht nur Produkte, sondern Perspektiven. Wer Christiani.AI nutzt, liefert der KI zunächst keine Themenliste, sondern Antworten auf tiefere Fragen wie: Wofür stehst du? Was willst du verändern? Was kannst du besser als andere und warum?
Ein ganzes Team im Taschenformat
Im Inneren von Christiani.AI arbeiten mehrere KI-Instanzen parallel: Eine extrahiert Expertise aus Gesprächen und Notizen. Eine zweite strukturiert diese entlang der Customer Journey. Eine dritte übersetzt sie in die gewünschten Formate: Social Posts, Website-Texte, LinkedIn-Serien, Mailings. Alles abgestimmt, alles im persönlichen Stil der Person, nicht der Maschine.
„Wir haben ein System geschaffen, das so denkt wie ein kleines Marketingteam“, erklärt Raphael. „Nur eben eines, das nie krank ist, nie Urlaub braucht und dein Unternehmen besser kennt als du selbst, wenn es gut läuft.“
Ein Pilotnutzer beschreibt es wie folgt: „Ich bin einfach begeistert ... Habe schon viel ausprobiert, aber hier die besten Möglichkeiten gefunden. Die Betreuung und die Umsetzung von Anregungen sind emphatisch und schnell. Hier sind drei wirklich helle Köpfe am Werk, die ihr Handwerk voll und ganz verstehen. Herzlichen Dank.“
Die Plattform ist modular aufgebaut und speziell auf Startups, Selbständige, KMUs und Expert*innen zugeschnitten, also auf diejenigen, die oft das größte Wissen und den kleinsten Kommunikationsapparat haben. Für sie soll Christiani.AI keine Software, sondern eine strukturelle Entlastung sein.
Der stille Anspruch: Kommunikation demokratisieren
„Es geht uns um mehr als Effizienz“, sagt Alexander. „Wir wollen Kommunikation demokratisieren.“ Es geht nicht um die Weltrevolution, sondern um handwerkliche Fairness: Darum, dass ein(e) gute(r) Steuerberater*in aus Kiel dieselben kommunikativen Chancen hat wie ein Berliner Start-up mit 50.000 Euro Monatsbudget für Paid Ads. „Christiani.AI ist unser Versuch, Kommunikation nicht länger davon abhängig zu machen, wie laut oder teuer jemand sein kann“, sagt Constantin, „sondern davon, wie gut seine Geschichte ist.“
Ein System mit Seele?
Kann man Software mit Haltung bauen? Die Christianis glauben daran. Sie sagen, Christiani.AI sei keine künstliche Intelligenz im klassischen Sinn, sondern eher eine strukturierte Erweiterung echter Intelligenz. Eine Brücke zwischen Wahrhaftigkeit und Sichtbarkeit. Ein Tool für alle, die kein Marketing machen, sondern einfach sagen wollen, was Sache ist. Klar. Ehrlich. Solide. „Dein Durchbruch ist nur eine Geschichte entfernt“, ist auf der Website des Unternehmens zu lesen. Wenn man mit den Christianis spricht, mutet der Claim weniger wie ein Werbeversprechen an, sondern wie eine klare Vision sowie ein tief in der „Christiani-DNA“ verwurzelter Wunsch und Auftrag.
Donnerstag.ai erhält 4,3 Mio. Euro Seed-Finanzierung
Donnerstag.ai bietet eine KI-gestützte Plattform für Forderungsmanagement, die speziell für Lieferant*innen konzipiert ist. Ziel ist es, Zahlungsausfälle zu vermeiden und volle Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.

Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai – 2025 in Frankfurt am Main von Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan gegründet – verbindet Leistungs-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten aus bestehenden Systemen, erkennt Abweichungen nahezu in Echtzeit und automatisiert die Abstimmung von Transaktionen über einen positionsgenauen Abgleich (Line-by-Line Reconciliation). Auf Basis künstlicher Intelligenz und autonomer KI-Agenten schafft Donnerstag.ai volle Transparenz über offene Posten, ermöglicht präzises KPI-Reporting und unterstützt ein aktives Forderungsmanagement zur Steuerung von Liquidität und Risiko.
Die Software verbindet Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen, erkennt Abweichungen in Echtzeit und gleicht Tausende von Transaktionen automatisch ab. Ihr intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziert fehlende Positionen und warnt Finanzteams, bevor Verluste entstehen. Durch kontinuierliches Lernen aus den Datenmustern jedes Kunden wird das System zunehmend präziser und verwandelt Abstimmungsprozesse in eine proaktive, intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens.
„Jedes Jahr gehen Lieferanten Milliarden verloren, weil sie keinen klaren Überblick darüber haben, was geliefert, abgerechnet und bezahlt wurde“, sagt Barbaros Özbugutu, Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai. „Mit unserer KI-Plattform aus Deutschland schaffen wir Transparenz in einer Branche, die für Europas Wettbewerbsfähigkeit zentral ist.“
Erfahrenes FinTech-Team trifft auf starke Investor*innen
Hinter Donnerstag.ai stehen die Gründer Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan, die beide langjährige Erfahrung im europäischen FinTech-Sektor mitbringen. Özbugutu war zuvor als Deutschlandchef bei Klarna tätig und war Mitgründer sowie CEO des Zahlungsdienstleisters iyzico. Dieser wurde 2019 von Prosus/Naspers übernommen. Der erfolgreiche Exit zählt zu den größten Fintech-Akquisitionen in der Türkei.
„In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz ERP- und Finanzsysteme grundlegend neu definiert, schafft Donnerstag.ai eine völlig neue Kategorie, die bislang technisch nicht adressiert werden konnte”, sagt Stefan Klestil, General Partner bei Speedinvest. „Barbaros und Volkan verbinden Produktkompetenz, strategisches Denken und Umsetzungsstärke auf einzigartige Weise. Wir sind stolz, als Lead-Investor Teil dieser Runde zu sein und gemeinsam mit Donnerstag.ai die Zukunft der europäischen Finanztechnologie zu gestalten.“
Donnerstag.ai will auch mithilfe des frischen Kapitals seine Präsenz in der DACH-Region ausbauen mit dem Ziel, sicheres Forderungsmanagement europaweit anzubieten.
Nullwachstum trotz KI-Boom
„Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.“ Ein Kommentar von Frank Thelen, Gründer und CEO, TEQ Capital.

Der Sachverständigenrat rechnet für Deutschland mit nahezu Nullwachstum und gleichzeitig investieren die großen US-Techkonzerne dreistellige Milliardenbeträge in KI-Infrastruktur. Das zeigt sehr deutlich, wohin die Reise geht. Wenn wir Energie, Genehmigungen und unsere Sondervermögen nicht radikal auf Zukunft ausrichten, verlieren wir im globalen Produktivitätsranking dauerhaft den Anschluss.
0,2 Prozent Wachstum versus 600 Milliarden Dollar KI-Boom
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache – und sie passen nicht zusammen. Auf der einen Seite steht Deutschland mit einem erwarteten realen Wachstum von gerade einmal 0,2 Prozent für 2025 und 0,9 Prozent für 2026, wie der Sachverständigenrat prognostiziert. Auf der anderen Seite steht eine historische Investitionswelle in Künstliche Intelligenz und digitale Infrastruktur, die in den USA längst Fahrt aufgenommen hat.
Nach zwei Jahren Rezession und anhaltender Schwächephase steckt Europas größte Volkswirtschaft faktisch in einer Phase der Stagnation, während wichtige Wettbewerber dreistellige Milliardenbeträge in die nächste Produktivitätsstufe investieren. Deutschland verwaltet den Status quo – andere Länder kaufen sich gerade die Zukunft.
Allein Meta hat angekündigt, in den kommenden drei Jahren rund 600 Milliarden US-Dollar in Infrastruktur und Arbeitsplätze in den USA zu investieren – vor allem in neue Rechenzentren für KI-Anwendungen, Energie- und Netzinfrastruktur sowie spezialisierte Computertechnik. Auch Microsoft, Alphabet und Amazon drehen ihre Investitionsprogramme deutlich nach oben. Es geht dabei nicht um ein paar zusätzliche Serverhallen, sondern um eine weltweite Investitionswelle, die über Rechenzentren, Chipindustrie, Sensoren und Energienetze die industrielle Landkarte neu zeichnet. Wer jetzt baut, setzt die Maßstäbe für die Wertschöpfung der nächsten Jahrzehnte.
Die Diagnose der Wirtschaftsweisen ist unbequem – und zutreffend
Das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen trägt den Titel „Perspektiven für morgen schaffen – Chancen nicht verspielen“. Tatsächlich aber leistet sich Deutschland den Luxus, genau diese Chancen auszubremsen. Statt Investitionshürden konsequent abzubauen, dominiert die Debatte, wie bestehende Sondervermögen verteilt werden sollen. Die strukturellen Bremsklötze sind bekannt: zu viel Bürokratie, zu hohe Kosten – allen voran bei Energie – und Genehmigungsprozesse, die eher an die analoge als an die digitale Epoche erinnern.
Rechenzentren sind im Kern riesige Maschinen, die Strom in Rechenleistung verwandeln. Ihr Geschäftsmodell steht und fällt mit günstiger, planbarer Energie und schnellen Entscheidungen der Behörden. Wer heute diese Voraussetzungen schafft, sichert sich einen dauerhaften Vorteil im KI-Zeitalter – bei Investitionen, hochqualifizierten Jobs und technologischer Souveränität.
Deutschland hingegen kombiniert hohe Energiepreise mit einem dichten Regelwerk und langwierigen Verfahren. Damit liefert der Standort die Begründung für schwache Investitionen und Wachstumsprognosen knapp über Null gleich mit. Die Frage ist daher nicht, ob die Prognosen des Sachverständigenrats zu pessimistisch sind – sondern wie lange sich eine Volkswirtschaft mit diesem Anspruch ein solches Politik-Setup noch leisten kann.
Der doppelte Rückstand
Die Konsequenz dieses Kurses ist ein doppelter Rückstand. Erstens droht ein Rückstand bei der Infrastruktur: Wenn Rechenzentren für KI, Chipfabriken und moderne Industriewerke vor allem dort entstehen, wo Energie preislich wettbewerbsfähig ist und Planungsprozesse Monate statt Jahre dauern, schrumpft der Kreis der Länder, die überhaupt noch als Standorte infrage kommen. Deutschland läuft Gefahr, von der Entwicklungs- zur reinen Anwendernation zu werden.
Zweitens entsteht ein Rückstand bei der Produktivität. Künstliche Intelligenz, Automatisierung und die systematische Nutzung von Daten erhöhen die Leistung pro Arbeitsstunde erheblich – und damit auch die Löhne, die sich langfristig darstellen lassen. Wenn aber der Zugang zu dieser Infrastruktur begrenzt bleibt oder deutlich teurer ist als anderswo, schlägt sich das unvermeidlich in niedrigeren Wachstumsraten nieder. Genau diese Entwicklung spiegeln die Prognosen des Sachverständigenrats bereits heute wider.
Ambivalente Aussicht für Investoren
Für Anleger ist der Befund eindeutig, aber nicht bequem. Der KI-Boom kommt, und die dafür notwendige Infrastruktur kommt ebenfalls. Die einzige offene Frage ist: mit oder ohne Deutschland.
Entscheidend wird sein, wo die nachhaltigen „Schaufelhersteller“ dieses Booms entstehen: von der Chipfertigung über hochpräzise Spezialmaschinen bis hin zu Energie- und Kühlungstechnik. Genau dort liegen die langfristig spannenden Chancen.
Aber diese Unternehmen brauchen verlässliche Rahmenbedingungen: günstige Energie, schnelle Genehmigungen, klare Regulierung und ein Umfeld, das Wachstum nicht bestraft, sondern beschleunigt. Einige Länder liefern das bereits – und genau dort werden die nächsten Gewinner entstehen. Die große Frage ist, ob Deutschland dazugehören wird oder ob wir Investoren zusehen müssen, wie diese Wertschöpfung an uns vorbeizieht.
Deutschland bringt eigentlich alles mit: starke Exportbranchen, hoch spezialisierte Zulieferer und eine industrielle Basis, um die uns viele Länder in Europa beneiden. Aber wenn wir unsere Wachstumsbremsen nicht lösen und Zukunftsinvestitionen nicht konsequent priorisieren, bleibt dieses Potenzial weit unter seinen Möglichkeiten.
Der nächste Produktivitätssprung entscheidet darüber, wer die neuen Standards setzt und wer sie am Ende nur importiert. Deutschland steht jetzt vor der Wahl: Nutzen wir den KI-Boom, um unsere Rolle als führende Industrienation neu zu definieren? Oder reagieren wir darauf mit Nullwachstum, hoher Energiebelastung und einem bürokratischen Überbau, der Innovation ausbremst?
Im Moment sieht man sehr deutlich, dass andere Länder entschlossener um diese Zukunft kämpfen. Die Frage ist, ob wir bereit sind, aufzuholen.
Wie teuer ist es, ein Start-up in Deutschland zu gründen?
Erfahren Sie, welche Kosten 2025 bei der Gründung eines Start-ups in Deutschland anfallen, von Stammkapital bis Notar- und Digitalisierungskosten.

Die Gründung eines Start-ups in Deutschland ist wie der Sprung in kaltes Wasser. Erfrischend, aufregend, aber nicht für alle. Zwischen Euphorie, Papierbergen und der ersten Steuer-ID beginnt das echte Abenteuer Unternehmertum. Begeisterung ist der Treibstoff, doch wer den Weg kennt, schwimmt leichter durch den Behördendschungel. Dies wird verlangt, um wirklich etwas Eigenes aufzubauen.
Die Grundlagen: Welche Kosten auf Gründer zukommen
Bevor ein Unternehmen offiziell an den Start gehen kann, fallen einige unvermeidbare Basiskosten an. Bei der Gründung einer GmbH ist das Stammkapital von mindestens 25.000 Euro der entscheidende Grundstein, wovon mindestens 12.500 Euro direkt eingezahlt werden müssen. Hinzu kommen Gebühren für den Notar, die Eintragung ins Handelsregister und die Veröffentlichung im Bundesanzeiger.
Insgesamt sollten Gründer für eine klassische GmbH zwischen 1.000 und 4.500 Euro an Gründungskosten einplanen, abhängig von Komplexität, Anzahl der Gesellschafter und individueller Beratung.
Auch günstigere Alternativen wie die UG (haftungsbeschränkt) bieten sich an. Diese Mini-GmbH kann schon ab 1 Euro Stammkapital gegründet werden, eignet sich aber eher für kleine oder testweise Projekte. Dennoch sollte niemand glauben, dass damit alle bürokratischen Hürden aus dem Weg sind, denn auch hier sind Notar- und Gerichtskosten Pflicht.
Mehr als nur Papierkram: Die digitalen Chancen
Die deutsche Gründerszene hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Dank neuer Technologien, staatlicher Förderungen und digitaler Plattformen ist der Einstieg einfacher geworden, zumindest organisatorisch.
Besonders künstliche Intelligenz (KI) hat zahlreiche Branchen revolutioniert und völlig neue Geschäftsfelder geschaffen. Start-ups entstehen nicht mehr nur in klassischen Bereichen wie Handel oder Produktion, sondern zunehmend online.
So erleben wir in der Unterhaltungsbranche einen Boom. Dank der zahlreichen Features und Innovationen gibt es jetzt Zugang zum zum Bonus Meister im Online Casinos, wo Deutsche beispielsweise entdecken können, wo es die besten Vorteile und Erfahrungen gibt.
Dieser aktuelle Trend zeigt, dass Innovation und Unternehmergeist längst nicht mehr nur in Werkhallen oder Büros entstehen, sondern im digitalen Raum. Oft mit nur einem Laptop und einer guten Idee.
Bürokratie und Notarkosten: Das unvermeidliche Fundament
Egal ob GmbH, UG oder GbR, an einem Schritt führt kein Weg vorbei: dem Gang zum Notar. Ohne seine Unterschrift bleibt jede Gründung nur ein guter Plan. Der Gesellschaftsvertrag muss beurkundet, das Unternehmen im Handelsregister eingetragen und eine Gesellschafterliste erstellt werden.
Die Kosten dafür variieren je nach Aufwand und Standort: Für die notarielle Beurkundung sollten Gründer mit 500 bis 1.000 Euro rechnen, die Eintragung im Handelsregister kostet meist zwischen 150 und 350 Euro. Hinzu kommt die Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger mit rund 100 Euro.
Die versteckten Kosten: Von der IT bis zur Kaffeemaschine
Viele Gründer konzentrieren sich auf die offiziellen Gebühren, vergessen aber die praktischen Ausgaben im Alltag. Büromöbel, Computer, Softwarelizenzen, Versicherungen und Marketingmaßnahmen gehören ebenso in den Finanzplan wie Gründungskosten. Diese Posten lassen sich zwar steuerlich absetzen, müssen jedoch zunächst bezahlt werden.
Gerade im ersten Jahr ist Liquidität entscheidend. Wer hier zu knapp kalkuliert, gerät schnell ins Straucheln. Experten empfehlen, einen Finanzpuffer von mindestens 20 % der geplanten Startkosten einzuplanen für Unvorhergesehenes, wie technische Probleme oder Nachzahlungen.
Finanzierung und Fördermöglichkeiten
Zum Glück gibt es in Deutschland eine Vielzahl staatlicher Förderungen und Programme, die Start-ups unterstützen. Die KfW-Bank, regionale Wirtschaftsförderungen oder spezielle Gründerstipendien helfen beim Start. Auch Business Angels und Venture Capital werden zunehmend wichtiger, um innovative Ideen auf die Straße zu bringen.
Doch egal ob Fremdkapital oder Eigenmittel: Eine solide Finanzplanung ist der Trick. Ein detaillierter Businessplan zeigt nicht nur Investoren, sondern auch den Gründern selbst, ob ihr Konzept langfristig tragfähig ist.
Digitalisierung als Wachstumsmotor
Die digitale Transformation hat den Gründungsprozess selbst vereinfacht: Online-Anmeldungen, elektronische Signaturen und digitale Buchhaltung sparen Zeit und Papier. Gleichzeitig entstehen unzählige neue Geschäftsmöglichkeiten, von KI-gestützten Tools bis hin zu datenbasierten Plattformen.
Wie stark diese Entwicklung die deutsche Wirtschaft verändert, zeigt sich besonders in Online Branchen, wo KI, Automatisierung und datengetriebene Prozesse Gründungen agiler machen.
Gründungskosten ja, aber unbezahlbare Chancen
Eine Unternehmensgründung in Deutschland kostet Zeit, Geld und Nerven. Doch wer diesen Weg geht, investiert in Freiheit, Kreativität und Selbstbestimmung. Die Hürden sind schon da, aber die Chancen größer denn je. Wer klug plant und flexibel bleibt, findet im deutschen Gründungsdschungel nicht nur den Weg nach oben, sondern auch nachhaltigen Erfolg.
Die Top 10 Grafikdesigntrends 2026
Grafikdesign setzt Impulse, um dein Branding aufzufrischen, deine Marke gekonnt zu inszenieren oder deine Zielgruppe persönlich und emotional anzusprechen. Daher gut zu wissen: Diese zehn Grafikdesigntrends werden von den Profis aktuell favorisiert.

2026 wird das Jahr, in dem Grafikdesign Menschlichkeit betont. Während KI im Alltag eine immer größere Rolle spielt, wächst die Sehnsucht nach Echtheit – nach Entwürfen, die berühren. Zu diesem Schluss kommt das Expert*innen-Team von VistaPrint auf Basis der umfassenden Beobachtungen seiner internationalen Freelancer-Community auf 99designs by Vista.
Die zentrale Erkenntnis: Grafikdesign wird wieder deutlich persönlicher. Es zeichnet sich ab, dass sich die Trends weg vom Glatten, hin zum Echten entwickeln. Marken wollen bei ihren Zielgruppen Gefühle wecken und setzen deshalb auf Geschichten statt Marketingbotschaften. So wird Design zur Bühne für Individualität und damit zum wirksamsten Werkzeug, um echte Verbindungen aufzubauen.
„Kleine Unternehmen haben den entscheidenden Vorteil, mutig, eigenwillig und authentisch auftreten zu können – großen Marken fällt das oft schwer,“ weiß Patrick Llewellyn, VP of Digital and Design Services bei VistaPrint. „In unserer laut und unpersönlich gewordenen Welt wirken unperfekte Designs ehrlich. Genau das macht sie so kraftvoll.“
Die Designtrends 2026 holen das Handgemachte ins Digitale, erzählen von kultureller Identität, feiern Unvollkommenheit und lassen Gefühle sichtbar werden. Nicht der Algorithmus, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt.
Die Designtrends 2026 im Überblick:
Elemental Folk
Tradition trifft moderne Gestaltung: Inspiriert von regionaler Handwerkskunst und kulturellem Erbe, entstehen warme, ausdrucksstarke Designs mit floralen Mustern, ornamentalen Details und kräftigen Farben. Die Gestaltung wirkt vertraut und zeitgemäß zugleich. Elemental Folk ist ein visueller Rückgriff auf das Ursprüngliche, der die Identität und Herkunft feiert.
Hyper-Individualism
Dieser Trend bringt frischen Wind ins Design. Er setzt auf surreale Bildwelten, spielt mit verzerrten Formen und bricht ganz bewusst mit Konventionen. Die Darstellungen wirken mal verspielt, mal provokant, aber immer individuell. Während viele ihre Gestaltungsprozesse komplett von der künstlichen Intelligenz erledigen lassen, begeistert dieser Stil mit der kreativen Handschrift der Menschen.
Tactile Craft
Stickerei, Stoffstrukturen und handgemachte Details finden ihren Weg zurück ins digitale Design. Was dabei entsteht, fühlt sich fast schon greifbar an: Die visuellen Oberflächen erzeugen eine besondere Tiefe, die den BetrachterInnen Wärme spendet. Zwischen DIY-Charme und nostalgischer Anmutung generiert dieser Trend – als Gegenentwurf zur glatten, oft distanzierten Ästhetik der digitalen Welt – eine emotionale Nähe.
Distorted Cut
Wenn Gestaltung zum Widerstand wird, entstehen visuelle Statements mit Ecken und Kanten. Klassische Collage-Techniken werden neu interpretiert, indem Bilder zerschnitten, Schichten überlagert und Formen fragmentiert werden. Das Ergebnis wirkt roh, rebellisch und voller Energie. Fest steht: Dieser Designstil will nicht gefallen – es geht darum, Haltung zu zeigen.
Candid Camera Roll
Kreative bringen mit diesem Trend das Echte zurück ins Visuelle. Unperfekte Schnappschüsse, Filmkorn, Blitzlicht und spontane Momente wirken persönlich und nahbar. Im Zusammenspiel mit reduzierter Typografie entstehen Designs, die mit ihrer Ehrlichkeit wirken und berühren.
Hyper-Bloom
Manchmal braucht es einen visuellen Rückzugsort – einen Ort zum Durchatmen. Sanfte Verläufe, zarte Blumenmotive und pudrige Pastelltöne entführen in eine Welt zwischen Traum und Realität. Der Stil wirkt wie ein Gegenpol zum hektischen Alltag und öffnet Raum für Leichtigkeit, Optimismus und ein bisschen Tagträumerei.
Digit-Cute
Die Ästhetik bewegt sich zwischen Nostalgie und digitaler Verspieltheit und sorgt vom ersten Moment an für richtig gute Laune. Klare Strukturen treffen auf bunte Pixelgrafiken, niedliche Figuren und kräftige Farben. Der Look versprüht den Charme der frühen Computerspiele und Popkultur. Gerade weil er so verspielt wirkt, ist er gestalterisch besonders raffiniert.
Micro-Industrial
Was früher rein funktional war, wird jetzt zum Gestaltungskonzept. Inspiriert von Verpackungen, technischen Etiketten und Informationsgrafiken bildet sich ein Designstil, der Klarheit feiert. Der gezielte Einsatz von Elementen wie Barcodes, QR-Codes und Rasterstrukturen verleiht den Entwürfen eine rohe, sachliche und zugleich moderne Ästhetik.
Neon Noir
Dunkel, intensiv und voller Spannung – der Stil erinnert an Szenen aus einem Neo-Noir-Film. Knallige Farben, wie elektrisches Rot, treffen auf tiefes Schwarz, kombiniert mit Bewegungsunschärfen und rauen Texturen. Der urbane, energiegeladene Look fällt sofort ins Auge und bleibt lange im Kopf.
Frutiger Aero Revival
Ein Hauch von Zukunft, so wie man sie sich früher vorgestellt hat: Glänzende Oberflächen, sanfte Farbverläufe und fließende Formen knüpfen an die Tech-Ästhetik der frühen 2000er an. Elemente wie Wasser, Himmel oder digitale Pflanzenwelten verleihen den Designs eine fast träumerische Leichtigkeit. Der Stil ist eine liebevolle Rückschau in eine Zeit, in der Technologie noch als Versprechen galt.
Fazit
Design darf wieder fühlen, Haltung zeigen und Ecken haben. Um als Marke aufzufallen, braucht man nicht mehr das glatteste Logo oder das perfekteste Bild, sondern Persönlichkeit, Mut und eine klare Botschaft. 2026 wird das Jahr, in dem Echtheit zählt. Das Beste daran: Es wird kreativ, lebendig und überraschend schön.
5 Marketing-Tipps für den Black Friday und das Vorweihnachtsgeschäft
Mit KI durch die Black-Friday-Week: Strategien für Sichtbarkeit und Wachstum im Jahresendgeschäft.

Der Countdown läuft: In Kürze erreicht der Handel mit dem Black Friday am 28. November, der Cyber Week und dem anschließenden Vorweihnachtsgeschäft den umsatzstärksten Zeitraum des Jahres. Bis zu 40 Prozent des Jahresumsatzes werden in diesen Wochen generiert – doch der Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Conversions ist so intensiv wie nie zuvor.
Performance-Marketing-Experten zeigen im Folgenden, wie Händler*innen und Marken in einem Umfeld aus Effizienzdruck, veränderten Konsument*innenbedürfnissen und KI-getriebener Marketingtransformation ihre Sichtbarkeit sichern und Wachstumspotenziale ausschöpfen können.
1. Der/die Kund*in wird zum/zur „Wert-Suchenden“ und sucht Markenbotschaften
Das Konsumklima hellt sich zwar auf, doch die Krisen und Unsicherheitsfaktoren der vergangenen Jahre haben Spuren hinterlassen. Die Kund*innen sind kritischer geworden, vergleichen stärker und achten auf ein adäquates Preis-Leistungs-Verhältnis. Rabattaktionen allein reichen daher nicht mehr aus, entscheidend sind Vertrauen und Qualität – und Erfolg hat, wer den Mehrwert einer Ware klar zu kommunizieren weiß. „Die Konsumenten haben ihr Einkaufsverhalten weiterentwickelt, nutzen gezielter Multi-Touchpoints, informieren und kaufen mittlerweile in Phasen. Außerdem achten sie nicht nur auf Rabatte, sondern wollen nachvollziehbare Qualität und sind empfänglich für verlässliche Markenbotschaften. Marken, die hier authentisch auftreten, profitieren gerade im härtesten Quartal des Jahres”, sagt Jan Honsel, Chief Division Officer der Smarketer Group.
2. SEA mit Google und Microsoft setzt auf Full-Funnel statt Last Click
Künstliche Intelligenz hat sich in alle Marketingprozesse integriert – von der Gebotssteuerung über die Erstellung hunderter Creatives bis hin zum Kampagnen-Monitoring. Doch ihr Wert steht und fällt mit den eingespeisten Daten. Dabei ist es wichtig, sicherzustellen, dass auch ohne Third-Party-Cookies stabile Daten für präzise Kampagnensteuerung zur Verfügung stehen. Gleichzeitig entwickeln sich Google und Microsoft von reinen Suchmaschinen zu Full-Funnel-Ökosystemen. Mit Hilfe von Performance Max, Demand Gen oder Audience Ads lassen sich Nutzer in allen Phasen der Customer Journey abholen – von der Inspiration bis zum finalen Kauf. Entscheidend ist dabei gerade im Vorweihnachtsgeschäft die frühe Präsenz, da die Kaufentscheidungen schon Wochen vor Black Friday Ende November vorbereitet werden – und die Suchvolumina früher anwachsen als in der Vergangenheit. „SEA ist heute kein reiner Conversion-Kanal mehr – und wer nur auf den letzten Klick optimiert, verschenkt enormes Potenzial. Erst wenn Unternehmen ihre Datenqualität sichern, intelligente Signale bereitstellen und gezielt Mid- und Upper-Funnel-Kampagnen, etwa über YouTube, einsetzen, entfaltet die Technologie ihr volles Potenzial. So lassen sich nicht nur neue Kunden effizient erreichen, sondern auch Budgets dynamisch aussteuern und der ROI nachhaltig maximieren.“, betont Marc Feiertag (Chief Revenue Officer) bei Smarketer.
3. Amazon Advertising wird zum Taktgeber im Deal-Marathon
Amazon bleibt auch im vierten Quartal der zentrale Schauplatz des Onlinehandels – mit immer längeren Deal-Phasen von Prime Day über die Black Week bis ins Weihnachtsgeschäft. Für viele Kunden ist Amazon fester Bestandteil der Einkaufsroutine und „Warensuchmaschine“ Nummer 1. Doch das Werbegeschäft des Handelsriesen hat sich gewandelt – klassisches Performance-Marketing mit den klassischen PPC-Metriken reicht alleine nicht mehr aus. Conversion Rates sind daher systematisch zu optimieren, wobei es sowohl auf Content-Qualität, Bildwelten und Produktbeschreibungen als auch auf die richtige Angebotsstrategie und eine intelligente Kampagnensteuerung ankommt. „Amazon hat sich vom reinen Verkaufskanal zu einem komplexen Ökosystem aus Suche, Produktpräsentation und Advertising entwickelt, das gerade in der Jahresendgeschäft sein volles Potenzial entfaltet und Deutschlands E-Commerce Wachstum treibt“, erklärt Robert Schulze, Geschäftsführer der Amazon-Full-Performance-Agentur Amzell. „Sichtbarkeit erfordert allerdings das perfekte Zusammenspiel von Werbung, Content und Promotions – wer das nicht findet, riskiert Umsatz- und Rankingverluste.“
4. Social & Video Advertising als Wachstumsmotor im härtesten Quartal
Social-Media-Plattformen wie Meta, TikTok und Reddit sind längst keine reinen Branding-Kanäle mehr. Sie haben sich zu Performance-Motoren entwickelt, die Kaufimpulse setzen, Interesse wecken und Produkte erklären. Neue Funktionen wie Value Optimization auf Meta, Creator-first-Strategien bei TikTok und Dynamic Product Ads bei Reddit sorgen für messbaren Umsatz und Reichweite im E-Commerce-Umfeld. „Gerade Reddit hat sich in der jüngsten Vergangenheit zu einem Kanal entwickelt, der auf Vertrauen und den persönlichen Austausch zwischen Menschen setzt. Die Plattform ist mit 14,5 Millionen wöchentlich aktiven Nutzer in Deutschland längst kein Nischenphänomen mehr und sollte nicht übersehen werden“, erklärt Josef Raasch, CEO des Social-Media-Spezialisten WLO.social. Der Schlüssel für den Erfolg liegt in der kreativen Vielfalt, in KI-gestützten Workflows und profitbasierten Kampagnenzielen. Auch Handelsunternehmen mit kleineren Teams und Budgets können so mithilfe von KI das volle Potenzial für Reichweite, Relevanz und Effizienz freisetzen.
5. KI-generierte Antworten werden zur neuen Währung der Sichtbarkeit
Ein weiterer Erfolgsfaktor, der in den nächsten Jahren zunehmend wichtig wird, ist die Präsenz in den neuen Antwortformaten wie AI Overviews und Chatbots. Immer mehr Kaufentscheidungen werden dort vorbereitet (und in Zukunft im Rahmen von Agentic Commerce auch abgewickelt). SEO nach den alten Regeln greift angesichts dieses Paradigmenwechsel vom Google-Ranking zur Antwortlogik zu kurz, ist aber weiterhin die Sichtbarkeitsgrundlage. Denn Sprachmodelle wie ChatGPT agieren nicht in Keywords und Rankings, sondern in semantischen Relevanzräumen, Entitätenbeziehungen und struktureller Klarheit. Unternehmen müssen ihre Inhalte daher neu denken – maschinenlesbar, modular aufgebaut und semantisch präzise – und sie so strukturieren, dass sie in diesen Kontexten sichtbar und zitierfähig sind. „Kaufentscheidungen beginnen zunehmend in KI-generierten Umfeldern. Wer hier nicht stattfindet, verliert in Zukunft Reichweite und Umsatz,“ erklärt Marcel Richter, Geschäftsführer der auf LLM-Sichtbarkeit spezialisierten Strategieberatung SMAWAX.
Ausblick auf 2026: Auf die richtigen strategischen Weichenstellungen kommt es an
Das diesjährige Vorweihnachtsgeschäft bietet trotz Effizienzdruck enorme Chancen – vorausgesetzt, Unternehmen denken kanalübergreifend, sichern ihre Datenhoheit und setzen die verfügbaren KI-Tools effizient und gezielt ein. „Brands, die ihre Marketingaktivitäten über alle Kanäle hinweg orchestrieren, Budgets agil und Performance-basiert steuern und auf saubere, eigene Daten setzen, können auch und gerade in der verlängerten und fragmentierten Peak-Saison sichtbar bleiben und profitabel wachsen“, fasst David Gabriel, Gründer und CEO der Smarketer Group, zusammen.



