Aktuelle Events
Anspruch und Position
Ein Name dient in erster Linie der Abgrenzung gegenüber „den Anderen“. So ist ein Name immer in Verbindung damit zu sehen und zu bewerten, wie das Umfeld des Unternehmens gestaltet ist. Grundsätzlich ist zu überlegen, ob man es ebenso machen möchte wie andere Unternehmen der Branche, oder ob man die „Norm“ durchbrechen will, um sich stärker zu profilieren. Damit einher geht die Einschätzung durch Dritte: Was werden andere von diesem Unternehmen erwarten, was werden sie von ihm halten? Und: Für was werden sie es halten? Was der Name idealer Weise ausdrückt, ist die Unternehmensidentität – die „Corporate Identity“. Die wichtigsten kommunikativen Ziele sind dabei: Unverwechselbarkeit, Wiedererkennungswert, Prägnanz, Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, Kontinuität und Sympathie.
Zunächst ist also die eigene Position zu bestimmen: Wo liegt der Schwerpunkt der eigenen Tätigkeit? Wer sind die Mitbewerber? Wo sind diese angesiedelt? Wie viele sind es? Auch das Niveau der angebotenen Leistungen spielt eine Rolle. Abhängig von den unternehmerischen Zielen bestimmt sich der Auftritt, die Botschaft und die Namensgebung. Das übergeordnete Ziel der Namensgebung sollte dabei ein fester Platz in den Köpfen der Zielgruppe sein. Fest im Sinne von Erinnerbarkeit ebenso wie hinsichtlich einer eindeutigen und „ansprechenden“ Position.
Die Akzeptanz der Kunden
Wenn man weiß, worauf es den Kunden ganz besonders ankommt, d.h. welchen (emotionalen) Gewinn sie bevorzugt anstreben, ist es sicherlich von Vorteil, die Erfüllung dieser Wünsche schon frühzeitig zu signalisieren. Dies kann, muss aber nicht durch den Namen erfolgen. Im Zuge der Namensfindung bietet sich aber zugleich die Gelegenheit, das Angebot und die eigene Marktposition gründlich zu überdenken: soll man sich tatsächlich darauf beschränken, lediglich den lokalen oder regionalen Markt zu bedienen? Gibt es vielleicht potenzielle Interessenten aus anderen Bereichen, die bisher noch nicht angesprochen wurden – oder sich nicht angesprochen fühlten? Welcher Mehrwert kann geboten werden? Es ist vorteilhaft, diese Fragen zuerst zu prüfen, bevor man sich zu sehr auf eine Marktposition fixiert.
Grundsätzlich sorgt ein enges Zusammenwirken von Unternehmenspersönlichkeit und Produktimage für einen schlüssigen Auftritt. Ein gutes Produkt einer negativ beurteilten Unternehmenspersönlichkeit wird langfristig ebenso erfolglos sein wie ein sympathisches Unternehmen mit einem schwachen Produkt. Beides muss in Übereinstimmung mit den Erwartungen und Bedürfnissen der Zielgruppe stehen und dieser eine klare Botschaft übermitteln, die auf mindestens einem Basis-Bedürfnis aufbaut: Sicherheit, Gewinn oder Erlebnis.
Möglichkeiten der sprachlichen Umsetzung
Abgesehen von besonderen Schreibweisen wie klein, groß, getrennt oder zusammen, bieten sich verschiedene konzeptionelle Ansätze für einen passenden Namen. Da wären zunächst einmal die inhabergeprägten Namen. Der Name des Inhabers bzw. Gründers steht in alter Unternehmertradition für persönliche Verantwortung. Von der Geschäftsführung erwartet man eine starke Identifikation mit den Geschicken des Unternehmens. Der Name signalisiert Vertrauen und Seriosität. Viele solcher Namen sind inzwischen zu Markenzeichen geworden: Bosch, Jacobs, Neckermann. Dies ist die älteste Namensform und daher tragen viele berühmte Unternehmen Gründernamen. Dabei hatten sie aber nicht deshalb Erfolg, weil sie den Inhabernamen führen, sondern schlicht und einfach, weil sie die Überlebenden einer Ära sind. Andere sind einfach verschwunden, wie z.B. Autos der ehemals erfolgreichen Marken Glas, Borgward, Panhard, Austin.
Nachteile eines solchen Namens: Oftmals haben sich die Besitzverhältnisse seit Gründung (mehrmals/ längst) verändert, so dass die Namenseinheit von Gründer, Inhaber und Geschäftsführer kaum noch gegeben ist. Ungünstig ist bei der bloßen Kombination von Personenname und Gesellschaftsform, dass der Geschäftszweck aus dem Nam-en nicht hervorgeht. Dies lässt sich durch einen Zusatz beheben. Dabei ist man mit der Frage konfrontiert, wie exakt die Beschreibung sein soll. Ist sie zu ungenau (z.B. „Chemische Werke“), weiß niemand, ob es sich um einen Pharmaproduzenten, einen Kunststoffhersteller oder ein Farbenwerk handelt. Ist die Bezeichnung dagegen zu detailliert („Handmalfarben“), hat man Probleme, seine Produktpalette später einmal zu erweitern oder gar ganz zu wechseln.
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:
Niedersachsens Labor der Zukunft ist digital
Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.
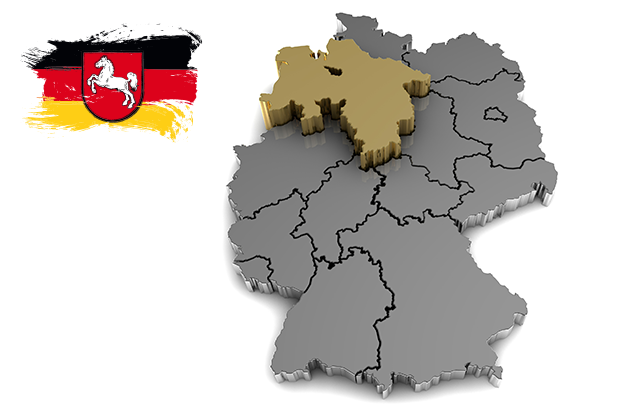
Die medizinische Diagnostik steht an einem Wendepunkt. Digitale wissenschaftliche Werkzeuge helfen beispielsweise dabei, Tumore besser und schneller zu erkennen sowie gezielter zu therapieren. Zwei mit dem niedersächsischen DurchSTARTer-Preis 2025 ausgezeichnete Spin-offs aus Göttingen, Histomography und GliTTher, zeigen, wie hochkomplexe Forschung zu marktreifer Technologie wird – und dass Niedersachsen sich zu einem Knotenpunkt der Biomedizin entwickelt.

Histomography digitalisiert komplette Pathologie-Proben zerstörungsfrei in 3D. Dazu nutzt das Laborsystem Röntgen-Phasenkontrast-Tomographie, eine Technologie, die feinste Strukturen sichtbar macht – ohne Gewebe zu färben oder zu schneiden. Die entstehenden 3D-Datensätze lassen sich direkt im Browser erkunden und auswerten. So werden kleinste Veränderungen und Tumore im Gewebe erkannt, die in 2D-Schnitten leicht übersehen werden. Histomography entwickelt dafür eine durchgängige Plattform: kompakter 3D-Scanner, Cloud-Infrastruktur und KI-gestützte Analysen greifen nahtlos ineinander. Langfristig soll die Technologie in Kliniken Routineuntersuchungen standardisieren – und die Diagnostik von der subjektiven Mikroskopie zu objektiven, datengetriebenen Entscheidungen führen.


