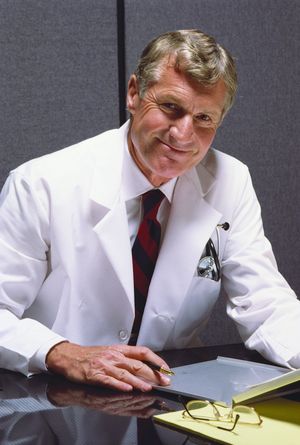Aktuelle Events
Diagnose: Krise im Anmarsch
Wie Sie als Gründer Schieflagen im Unternehmen vermeiden
Autor: Andrea Claudia DelpUnternehmenskrisen sind wie schmerzhafte Beschwerden: Wenn es wehtut, ist die Krankheit bereits voll ausgebrochen. Gerade Gründer sollten daher wissen, wie man Schieflagen vorbeugt und bei den ersten Anzeichen schnell und sicher agiert.
Je kleiner ein Unternehmen ist, desto vielseitiger sind die Aufgaben, die den Gründer erwarten. Die Gefahr, sich zu verzetteln oder einfach keine Zeit für wichtige Punkte zu haben, ist bei kleinen Unternehmen besonders groß. Als "Mädchen für Alles" in einer "One-Man-Show" übersieht man schnell, wenn es anfängt, an der einen oder anderen Stelle zu knirschen.
Niemand ist Alleskönner, obwohl die Führungsrolle in kleinen Unternehmen aber genau das verlangt. Mängel in der Unternehmensführung, geringe betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Nachfrageveränderungen und Finanzierungsprobleme - das sind die häufigsten Stolpersteine.
Wenn es in der Firma schlecht läuft, wirkt sich die miese Stimmung dann auch noch in der Familie aus. Fallstricke lauern praktisch überall. Diese zu erkennen und richtig darauf zu reagieren - das ist das große Geheimnis erfolgreicher Unternehmen. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.
Lernen, wie man selbst "tickt"
Die Früherkennung spielt - genau wie beim Zahnarzt - eine wichtige Rolle. Eine gute Beratung, ein gutes Coaching - das ist viel wert und hilft beim Bewältigen aller möglichen Hürden und eben auch bei der Krisen-Vorbeugung. Wichtig ist hier neben der fachlichen Kompetenz des Beraters vor allem die zwischenmenschliche Komponente. Vertrauen und eine offene Atmosphäre auf Augenhöhe sind die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg. Auf keinen Fall darf dabei die Persönlichkeit des Gründers außen vor bleiben.
Wenn es nicht rund läuft
Beim Kassensturz am Monatsende ist so mancher den Tränen nahe - der Grund: Viel Arbeit und es kommt einfach nie genug dabei heraus. Das erleben Unternehmer als zermürbendes Hamsterrad und sie sind keineswegs alleine damit. Trotz schlechter Ergebnisse auf dem Papier tun sich viele Unternehmen schwer damit, die eigene Lage zu realisieren und aktiv zu werden. Doch woran liegt das? Michael Drebs, Diplom-Theologe, Psychologe und Unternehmensberater weiß eine Antwort: "Wenn man nicht weiß, wie schmerzhaft eine Verbrennung ist und wenn einen auch niemand davor gewarnt hat, fasst man eine heiße Herdplatte nun einmal unvoreingenommen an. Hat man sich aber schon einmal verbrannt, lässt man die Sache mit der Herdplatte ganz bestimmt sein. Die Pleite an sich entzieht sich unserem Erfahrungsschatz und so kann man sich eben gar nicht vorstellen, dass das passieren könnte."
Die Beispiele machen deutlich: Impulse von außen sind hilfreich, um die Lage zu erkennen und zu handeln. Auf einen solchen - meist drastischen - Anstoß folgt oft die klare Einsicht: "So geht's einfach nicht weiter." Das Ergebnis kann eine Kehrtwende hin zu einer positiven Entwicklung bedeuten oder auch das freiwillige Ende einer Selbständigkeit. Wer den ausschlaggebenden Impuls nicht erlebt und nutzt, macht meist einfach weiter, bis es gar nicht mehr geht.
Wenn alle Hilfe zu spät kommt
Wer keinen unbezahlbaren Schuldenberg hat, kann ein Gewerbe einfach abmelden und vorhandene Schulden abbezahlen. Wer nur kurzfristige Probleme aufgrund von Nachfrageschwankungen hat, kann das Unternehmen unter Umständen mit Hilfe eines Investors retten, der das Unternehmen mit Eigenkapital versorgt. Allerdings ist hierfür ein überzeugendes und tragfähiges Geschäftskonzept notwendig, und je mehr die Zeit drängt, desto geringer ist die Chance, einen solchen Investor zu finden. Wer zu lange wartet, verspielt das Vertrauen in die unternehmerischen Fähigkeiten. Wenn nichts mehr geht, bleibt oft nur noch, beim zuständigen Amtsgericht die richtige Adresse für einen Insolvenzantrag zu erfragen.
Wie das abläuft, erklärt der Erfurter Fachanwalt für Insolvenzrecht Steffen Zerkaulen: "Zu der Antragstellung gehören auch noch ein paar Unterlagen: Eine Aufstellung der Vermögenswerte, die letzte Bilanz und eine Liste der offenen Forderungen und Verbindlichkeiten. Das Gericht bestellt dann einen vorläufigen Insolvenzverwalter, mit dem dann entschieden wird, ob eine Sanierung in Betracht kommt oder nicht." Für die meisten gescheiterten Unternehmen ist die Insolvenz eine Erleichterung. Der Gerichtsvollzieher kommt nicht mehr, die ständigen Mahnungen und Briefe von Inkassobüros bleiben endlich aus.
Aber auch wenn kein Schuldenberg zu bewältigen ist, bestätigen Unternehmer das Gefühl der Befreiung. Auch Thomas stimmt zu: "Endlich hat man den Kopf wieder für neue Wege frei und kann nach vorne schauen." Kurzum: Es ist wie mit einem kaputten Zahn, an dem immer hier und da ein bisschen herumgedoktert wird, ohne die Ursache zu bekämpfen. Manchmal muss der Zahn eben gezogen werden, um eine ernsthafte Besserung zu erreichen. Wie geht es weiter? Auch wenn das Aus zunächst bedrohlich wirkt, kann es aber sogar neue Perspektiven eröffnen.
Einer neuen Selbständigkeit steht auch im Rahmen einer Insolvenz nichts im Wege - auch die alte Selbständigkeit kann unter Umständen fortgeführt werden. "Der Insolvenzverwalter muss jedoch damit einverstanden sein. Eine neue Verschuldung ist während der Restschuldbefreiungsphase von sechs Jahren aber ausgeschlossen. Darüber hinaus bleibt auch der SCHUFA-Eintrag weitere drei Jahre bestehen", betont Rechtsanwalt Steffen Zerkaulen.
Die Autorin Andrea Claudia Delp betreibt das Portal amaveo.de
Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: